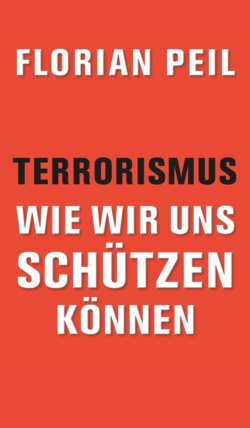Читать книгу Terrorismus - wie wir uns schützen können - Florian Peil - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 1
WAS TERRORISTEN WOLLEN
»Ein Radiosender ist für unsere Sache wichtiger als die Atombombe.«
Osama Bin Laden
Nach jedem Terroranschlag in Europa oder Nordamerika oder an beliebten Reisezielen westlicher Touristen beginnt das Schauspiel von Neuem: Aufnahmen von Tod und Zerstörung flackern über die Bildschirme, atemlose Moderatoren führen durch eilends anberaumte Sondersendungen, und in den Fernsehstudios sind Terrorismus-Experten gefragte Gäste. In der Phase unmittelbar nach einem Anschlag ist der Ton der Berichterstattung oft hysterisch, und in den sozialen Medien wuchern Gerüchte und Verschwörungstheorien.
Die Terroristen reiben sich bei diesem Spektakel die Hände: Der auf einen Anschlag folgende Aufschrei der Medien ist ein wesentlicher Teil ihres Plans. Denn Art und Umfang der Berichterstattung entscheiden maßgeblich über das Gelingen ihrer Tat: Je größer die Aufmerksamkeit, desto erfolgreicher ist ein Anschlag aus Sicht der Terroristen. Tatsächlich verfolgen Terroristen mit einem Anschlag eine Reihe von Zielen; das Töten unschuldiger Menschen ist dabei nur ein Mittel zum Zweck.
Was Terroristen sind
Terroristen sind entweder nichtstaatliche Gruppen oder Individuen, die politische Ziele verfolgen und in der Regel ideologisch motiviert sind. Entscheidend ist, dass sie machtlos sind und durch die Anwendung von Gewalt versuchen, ihren politischen Einfluss zu vergrößern, um eine bestehende Ordnung zu attackieren. Terroristen sind per Definition schwach.
Terroranschläge sind somit eine Taktik im Kampf kleiner Gruppen gegen so mächtige Gegner wie Nationalstaaten. Wären Terroristen stark, könnten sie ihren Gegnern in einer militärischen Auseinandersetzung gegenübertreten, statt sie mit terroristischen Mitteln anzugreifen. Aufgrund ihrer Schwäche wählen die Terroristen jedoch Angriffe aus dem Hinterhalt, denn in einer direkten Konfrontation mit ihrem Gegner wären sie unterlegen und ohne Chance.
Welche Ziele Terroristen mit Anschlägen verfolgen
Mit der Durchführung von Anschlägen verfolgen Terroristen fünf wesentliche Ziele:
1 / Terroristen wollen Aufmerksamkeit für ihre Sache, ihr politisches Ziel. Aufmerksamkeit ist die Luft zum Atmen für Terroristen, ohne mediale, gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit können sie nicht existieren. Ein Anschlag, der keine Beachtung findet, hat keine Wirkung; er verändert nichts.
2 / Terroristen wollen Angst und Schrecken verbreiten. Das geht bereits aus dem lateinischen Wort »terror« hervor: Es bedeutet »Schrecken«. Jeder Anschlag ist ein Schock für die betroffene Gesellschaft. Panik, Hysterie, Einschüchterung und Lähmung sind nicht nur verständliche Reaktionen der Gesellschaft und Medien, sondern beabsichtigte Effekte. Terroristen wollen unser Denken besetzen, so drückte es der Journalist Franz Wördemann in den 1970er- Jahren aus; sie wollen einen festen Platz in unseren Köpfen. Es geht ihnen darum, den jeweiligen Gegnern ein Gefühl der Unsicherheit und permanenten Bedrohung zu vermitteln.
3 / Terroristen wollen provozieren. Ein Anschlag soll den Gegner zu überzogenen Reaktionen verleiten. Terroristen fordern Staaten heraus, indem sie durch Anschläge deren Machtmonopol infrage stellen und den Bürgern suggerieren, dass der Staat nicht in der Lage sei, sie zu schützen. Um diesem Eindruck entgegenzuwirken, reagieren Staaten meist mit groß angelegten Polizeieinsätzen und Razzien – oder rufen wie im Falle der USA nach dem 11. September gar einen »Krieg gegen den Terror« aus.
4 / Terroristen wollen polarisieren. Mit Anschlägen versuchen Terroristen, einen Keil zwischen verschiedene Bevölkerungsgruppen eines Landes zu treiben. Die in jeder Gesellschaft existierenden Bruchlinien dienen dabei als Hebel, um den sozialen Kitt einer Gesellschaft aufzulösen, innenpolitisch für Unruhe zu sorgen und Staaten auf diese Weise zu destabilisieren. Eine solche Polarisierung kann auch entstehen, wenn bislang unbeteiligte Bevölkerungsgruppen infolge von Anschlägen unverschuldet unter strengen Repressionen des Staates wie Razzien oder regelmäßigen Polizeikontrollen zu leiden haben und sich infolge dessen radikalisieren.
5 / Terroristen wollen mobilisieren. Ihre Terroranschläge sind auch eine Botschaft an den sogenannten »interessierten Dritten«, der bis dahin unbeteiligt und neutral war. Dieser potenzielle Sympathisant soll zunächst Interesse für die Sache der Terroristen entwickeln, um dann nach und nach zum Unterstützer zu werden; im Idealfall schließt er sich im letzten Schritt den Terroristen an. Jeder Anschlag ist somit auch ein Propagandaakt in eigener Sache, mit dem Ziel, die eigene Basis zu verbreitern und damit den eigenen Einfluss in der Gesellschaft zu vergrößern.
Jeder Terroranschlag ist eine Botschaft
Entgegen der landläufigen Meinung geht es Terroristen in vielen Fällen erst in zweiter Linie um das Töten unschuldiger Menschen. In erster Linie wollen Terroristen Gehör für ihre Sache finden. Dass dabei Menschen ihr Leben lassen, dient – so bitter dies ist – vor allem dem Ziel, Aufmerksamkeit zu erzeugen, und ist damit fast immer lediglich Mittel zum Zweck.
Nüchtern betrachtet ist jeder Terroranschlag eine Botschaft. Um die jeweilige Botschaft zu transportieren, wählen Terroristen Ziele, die eine symbolische Bedeutung haben. Die Botschaft versteckt sich in dieser Symbolik: Jeder Anschlag enthält Zeichen, die sich lesen lassen. Das wichtigste Zeichen ist das Ziel des Anschlags, denn es verrät, wen die Terroristen treffen wollten. Weitere wichtige Hinweise können der Ort und das Datum des Anschlags sowie die gewählte Vorgehensweise liefern.
Nur wenn es gelingt, die Botschaft eines Anschlags richtig zu deuten, sind wir in der Lage, angemessen zu reagieren. Unsere Reaktion entscheidet ganz erheblich darüber, inwieweit ein Terroranschlag ein Erfolg für die Terroristen wird.
Die Botschaft entschlüsseln
Am Morgen des 11. September 2001 rasen kurz nacheinander zwei Passagierflugzeuge in die beiden Türme des World Trade Centers in New York City. Ein drittes Flugzeug stürzt in das Pentagon, das US-amerikanische Verteidigungsministerium; eine weitere Maschine stürzt in Pennsylvania ab. Es war vermutlich auf dem Weg nach Washington, um entweder das Weiße Haus oder als Ausweichziel das Kapitol anzugreifen.
Der Einsturz der beiden Türme wird live im Fernsehen übertragen. Überall auf der Welt kann man dabei zusehen, wie Menschen aus dem 100. Stockwerk springen, um den Flammen zu entgehen, und den quälend lang wirkenden Flug in den sicheren Tod beobachten.
Es sind die dramatischsten aller Bilder. Die Welt ist im Schock, wie festgefroren, unfähig, sich von den Bildern auf den Bildschirmen abzuwenden. Vielleicht ergeht es Ihnen auch so, dass bereits diese wenigen Zeilen ausreichen, um die Bilder von damals wieder vor Ihrem inneren Auge ablaufen zu lassen. Vermutlich kann sich jeder, der den 11. September bewusst miterlebt hat, noch genau daran erinnern, wo er war und was er tat, als die Nachricht des Anschlags ihn erreichte. Psychologen nennen dies Blitzlichterinnerungen: detaillierte und genaue Erinnerungen an dramatische Ereignisse von weltweiter Bedeutung, die emotional bewegen. Rund 3000 Menschen kommen an diesem Tag bei dem Anschlag ums Leben. Der 11. September ist ein terroristischer Massenmord – und der aus Sicht der Terroristen erfolgreichste Anschlag in der Geschichte des Terrorismus.
Wie nun lässt sich die Botschaft dieses Terroranschlags der Superlative entschlüsseln? Was wollten die Terroristen der Welt mitteilen, wie lautete ihre Botschaft? Um den Anschlag zu deuten, gilt es, sechs Kernfragen zu beantworten:
1 / Wer steckte hinter dem Anschlag? Der Anschlag wurde von der Terrororganisation al-Qaida geplant und durchgeführt. Deren Anführer Osama Bin Laden bekannte sich jedoch erst 2004 endgültig zu dem Anschlag.
2 / Wann geschah der Anschlag? Das Datum des 11. September 2001 hatte für den Anschlag selber keine besondere Bedeutung, wurde jedoch zu einem wichtigen Referenzdatum für folgende Anschläge. Die Zuganschläge in Madrid am 11. März 2004 zum Beispiel fanden in der Berechnung der Attentäter exakt 911 Tage nach 9/11 statt.
3 / Wo fand der Anschlag statt? Von den angegriffenen Orten sind die Städte New York City und Washington DC relevant. New York City ist eine der Megastädte der USA. Für viele Menschen auf der ganzen Welt symbolisiert New York wie keine andere Stadt die USA und ihre Werte. Auf einer höheren Ebene kann der Anschlag als Angriff auf die gesamte westliche Welt und ihre Werte verstanden werden. Das World Trade Center wiederum symbolisierte die Finanzmacht der USA. Die beiden alles überragenden Türme waren ein Symbol par excellence: Sie standen für das Kapital und für die wirtschaftliche Macht der USA, in der Wahrnehmung vieler Nicht-Amerikaner, nicht nur im Nahen Osten, aber ebenso für den Imperialismus der USA, für eine aggressive Außenpolitik und die Unterwerfung der übrigen Welt.
Das Pentagon bei Washington stand und steht für die militärische Macht der USA und galt bis dahin als nicht angreifbar. Damit bildete es aus Sicht der Terroristen das perfekte Ziel, um der Welt die tatsächliche Verletzlichkeit der USA vor Augen zu führen.
Es bleibt unklar, ob das vierte Flugzeug, das in Pennsylvania abstürzte, tatsächlich das Kapitol in Washington DC oder das Weiße Haus zum Ziel hatte. Beide Gebäude sind in der ganzen Welt bekannte Symbole für die politische Macht der USA.
4 / Wie gingen die Terroristen vor? Die insgesamt 19 Terroristen entführten vier Passagierflugzeuge, um diese in die ausgewählten Ziele zu steuern. Die Attentäter waren Selbstmordattentäter; alle 19 starben bei dem Anschlag. Die ausgewählten Ziele waren von beachtlicher Größe, daher erforderte die Zerstörung dieser Ziele geeignete Waffen: Flugzeuge.
5 / Gegen wen richtete sich der Anschlag? Ziele des Anschlags waren zivile und militärische Gebäude, die Machtzentren der amerikanischen Politik, Wirtschaft und des Militärs symbolisierten. Die Opfer waren überwiegend Zivilisten, aber auch Militärs. Militärs repräsentieren die amerikanische Regierung und in einem weiteren Sinne auch die amerikanische Außenpolitik. Zivilisten wiederum repräsentieren als Bürger der USA ein gesellschaftliches System und die damit verbundenen Werte.
6 / Warum wurde der Anschlag verübt? Das Warum eines Anschlags erklärt sich entweder aus einem Bekennerschreiben oder -video der Attentäter oder, sofern dieses fehlt, allein aus der Symbolik des Anschlags. In vielen Fällen ist es eine Mischung aus beidem. Im Falle des 11. September ist die Symbolik des Anschlags sehr deutlich: Die Summe der Ziele repräsentiert all das, was die Terroristen hassten und vernichten wollten. Ihre Botschaft lautete: Amerikaner, zieht euch aus der islamischen Welt zurück, hört auf, die Muslime in aller Welt zu unterdrücken. Zieht euch zurück, oder ihr seid nicht sicher, nirgendwo. Ihr mögt eine Supermacht sein und die Welt beherrschen. Doch wir können euch treffen, wann und wo immer wir wollen, selbst in euren hoch gesicherten Zentren. Ihr könnt euch nicht schützen. Euer Staat kann euch nicht schützen. Wir werden euch vernichten.
Der 11. September hat uns die Funktionsweise des Terrorismus in brutaler Klarheit vor Augen geführt: eine präzise Botschaft, ein politisches Ziel, der Einsatz von Gewalt und die maximale Aufmerksamkeit der ganzen Welt. Kein anderer Anschlag hatte einen derartigen Einfluss auf den Verlauf der Weltgeschichte. Die USA riefen in Reaktion auf 9/11 den »Krieg gegen den Terror« aus und bombardierten zunächst die Taliban in Afghanistan, bevor sie in das Land einmarschierten. Im Jahre 2003 stürzten die USA Saddam Hussein im Irak. Als Reaktion auf die Anwesenheit von US-Truppen im Land bildeten sich schnell zahlreiche Widerstandsgruppen, aus denen 2014 auch der Islamische Staat hervorging. Das hervorstechendste Ergebnis des »Kriegs gegen den Terror« ist das Erstarken der weltweiten dschihadistischen Bewegung. Die Folgen bekommen wir heute in Form einer wachsenden Zahl von Terroranschlägen zu spüren, auch in Europa.
Der Anschlag vom 11. September war aus Sicht des Terrorismus auch deshalb so erfolgreich, weil er in medialer Hinsicht brillant inszeniert war. Auch 15 Jahre später sind die Bilder des Anschlags so mächtig, dass wir sie noch in den Köpfen haben: als eine apokalyptische Erfahrung, als Erinnerung an einen Tag, an dem die Welt stillzustehen schien.
Wie das Beispiel zeigt, kalkulieren Terroristen bei der Planung eines Anschlags die anschließende Berichterstattung bereits mit ein. Aus Sicht der Terroristen bemisst sich der Erfolg eines Anschlags heutzutage vor allem an seiner medialen Verbreitung. Überspitzt formuliert: Für Terroristen ist Sendezeit wichtiger als die Zahl der Opfer. Denn dank der Massenmedien können auch kleine Anschläge durch eine geschickte Inszenierung eine große Wirkung entfalten.
Die Verbreitung der Bilder eines Terroranschlags durch die Massenmedien ist also ein essenzieller Teil des Plans und des terroristischen Kalküls: Die Terroristen wissen, dass es eine allzeit bereite Maschinerie gibt, die ihnen ihr Material bereitwillig abnimmt und verarbeitet. Und sie wissen diese Maschinerie der Medien zu nutzen und zu manipulieren, indem sie ihre Terroranschläge mediengerecht inszenieren. Terroristen und Massenmedien leben somit in einer Symbiose. Beide profitieren voneinander, da sie die stete Suche nach größtmöglicher Aufmerksamkeit gemeinsam haben.
Das Dilemma der Medien
Die Medien, allen voran das Fernsehen, stecken bei der Berichterstattung über Terroranschläge in einer Zwickmühle: Einerseits haben sie die Aufgabe, ihre Leser oder Zuschauer zu informieren, und dies möglichst wahrheitsgetreu und objektiv. Auf der anderen Seite spielen sie mit den blutigen Bildern der Anschläge den Terroristen in die Hände. Die Berichterstattung über Terroranschläge ist damit eine ständige Gratwanderung zwischen der Verpflichtung zur Information und der Gefahr, zu Erfüllungsgehilfen der Terroristen zu werden. Journalisten müssen deswegen immer wieder infrage stellen und diskutieren, ob und inwieweit sie Bilder der Anschläge zeigen, wie sie diese kommentieren und ob sie nicht die von den Terroristen gewünschten Bilder durch eigene Recherchen relativieren können.
Diese Aufgabe lösen die unterschiedlichen Medien unterschiedlich gut: Die Breaking News oder Eilmeldungen mit ihrer atemlosen und mitunter etwas hysterischen Live-Berichterstattung stehen einer ausgewogenen Berichterstattung gegenüber, die ausgewählte Bilder zwar zeigt, diese aber entsprechend kommentiert, einordnet und durch eigene Recherchen ergänzt. Auf der einen Seite dominieren Spekulationen und Gerüchte, auf der anderen Recherche und Analyse. Die einen sind schnell, die anderen langsam. Der Filter der einen ist grob, die anderen bemühen sich um einen feineren Filter.
Ein Beispiel für den überlegten Umgang mit brutalen Bildern lieferte das heute-journal im ZDF im September 2014, als der IS mit dem Journalisten Steven Sotloff eine weitere seiner Geiseln vor laufender Kamera enthauptet hatte. Moderator Claus Kleber kommentierte dies so: »Heute veröffentlichte die Terrorgruppe Islamischer Staat ein Video wohl von der Enthauptung eines zweiten amerikanischen Journalisten, den sie in Geiselhaft hatten. Damit ist zu den Fakten alles gesagt. Wir sehen dieses Mal keinen journalistischen Grund, Ihnen auch noch Bilder dazu zu zeigen.« Damit hatte Kleber ein Zeichen gesetzt und indirekt zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den brutalen Bildern des Terrors aufgerufen. Leider lässt sich der Verzicht auf Bilder im Fernsehen nicht beliebig oft wiederholen, denn wenn die Bilder in einer Berichterstattung fehlen, wandern die Zuschauer ab und suchen sich die Bilder anderswo. Besonders die sozialen Medien haben in vielen Bereichen den traditionellen Medien den Rang abgelaufen und sie als Informationsquelle abgelöst. Denn in den sozialen Netzwerken gibt es Informationen in Echtzeit und ungefiltert. Gerade brutale Bilder können das Internet zeitweilig geradezu fluten. Man kann diesen Bildern kaum mehr entkommen – und dafür sind viele von uns verantwortlich.
Die Medien-Experten der Dschihadisten wissen diese Lust am Bild für sich zu nutzen. Sie sind Meister der Propaganda und haben die Inszenierung von Terroranschlägen, Enthauptungen und Hinrichtungen praktisch zu einer Kunstform erhoben. Ihre Videos werden von mehreren Kameras mit hoher Auflösung und unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen und durch geschickte Schnitte bearbeitet. Die Unterlegung mit dschihadistischen Kampfgesängen und eine effektive Dramaturgie machen die Videos so wirkungsvoll, dass sich der Zuschauer kaum abwenden kann. Ihre Inszenierungen sind eine Pornografie des Terrors.
Tod in Echtzeit
Am Abend des 14. Juni 2016 lauerte Larossi Abballa in der französischen Stadt Magnanville nahe Paris dem Polizisten Jean-Baptiste Salvaing vor dessen Haus auf und tötete ihn mit einem Messer. Dann brach er in das Haus ein und schnitt der Frau des Polizisten die Kehle durch. Anschließend filmte sich der 25 Jahre alte Franzose marokkanischer Abstammung im Haus seiner Opfer dabei, wie er seinen Treueeid gegenüber dem Islamischen Staat und seine Motivation für die Tat erklärte. Sein Video vom Tatort lud er live bei Facebook hoch.
Abballa wurde kurz darauf von einem Sondereinsatzkommando der französischen Polizei erschossen. Der IS veröffentlichte nach seinem Tod eine bearbeitete Fassung des Videos über seine Amaq-Medienstelle auf dem Videokanal YouTube.
Der Anschlag von Magnanville ist deshalb bemerkenswert, weil ein Terrorist zum ersten Mal in der Geschichte des Terrorismus live vom Tatort sendete, wenn auch nicht die Tat selber.
Das hatte mehr als ein Jahr zuvor bereits Amedy Coulibaly versucht. Der 32 Jahre alte Franzose malischer Abstammung stürmte gegen Mittag des 9. Januar 2015 einen koscheren Supermarkt in Paris. Er schoss zunächst wild um sich und tötete dabei drei Menschen. Die übrigen Anwesenden nahm er als Geiseln. Eine der Geiseln tötete Coulibaly später. Sein Morden hatte er mit einer kleinen Videokamera aufgenommen, die er sich um den Bauch gebunden hatte. Aussagen von Ermittlern zufolge versuchte er erfolglos, das sieben Minuten lange Video aus dem Supermarkt heraus zu verschicken. Vieles spricht dafür, dass es Coulibaly aufgrund von Verbindungsproblemen nicht gelungen ist, die Aufnahmen per Mail an einen Helfer zu verschicken.
Doch was Coulibaly nicht gelang, wird anderen gelingen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Terroristen ihr Morden live ins Internet übertragen. Die entsprechende Technologie existiert bereits. Kleine und robuste, dabei hochauflösende Kameras, die sich an Helm oder Körper tragen lassen, ermöglichen ungefilterte Bilder. Bislang werden diese Kameras vor allem im Sportbereich eingesetzt. Doch auch für Terroristen ist diese Möglichkeit besonders interessant, denn die düstere Faszination des Mordens wird ohne Zweifel für die erwünschte Aufmerksamkeit sorgen. Damit ist eine weitere Stufe im Kampf um Aufmerksamkeit erklommen, der sich von immer brutaleren Bildern hin zu immer aktuelleren entwickelt. Der Vorteil für die Terroristen besteht darin, dass auf diese Weise auch kleine Taten große Wirkung entfalten können.