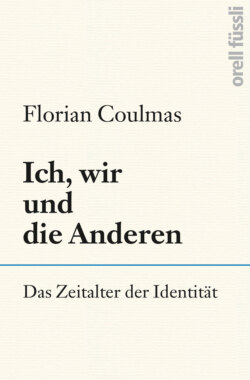Читать книгу Ich, wir und die Anderen - Florian Coulmas - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Imbroglio – verwickelt Mein innerstes Selbst: Tektonik für Teenager
ОглавлениеAuf der Schwelle zur Moderne steht prototypisch der junge Werther. Überschreiten kann er sie nicht. Der tragische Held von Goethes spektakulär erfolgreichem Briefroman lebt bis zum selbst herbeigeführten Ende neben einer unglücklichen Liebe die Krämpfe und Verwicklungen eines bürgerlichen Intellektuellen, der sich nicht in die feudalistische Hierarchie eingliedern kann und daran scheitert, einen Platz in der Gesellschaft zu finden, an dem er mit sich selbst im Einklang ist. Diesen Platz nannte nicht Goethe, aber nennen wir heute »persönliche Identität«. Und die Irrungen und Wirrungen, an denen der junge Werther leidet, können wir anachronistisch »Identitätskrise« nennen, eine nicht bewältigte Identitätskrise.
Zweihundert Jahre nach Werther war »Identitätskrise« in aller Munde. In den 1950er und 60er Jahren hatte der Psychoanalytiker Erik Erikson den Begriff bekannt gemacht; in den 70ern war er zum Gemeingut geworden. Wie Goethe mit dem ersten bürgerlichen Roman hatte der Schüler Sigmund Freuds mit seiner Seelenheilkunde für Heranwachsende den Finger am Puls der Zeit und brachte auf den Begriff, was viele seiner Zeitgenossen mehr oder weniger vage empfanden und erlebten. Sich selbst zu finden, war nicht einfach in einer Gesellschaft, die das nicht nur erlaubt, sondern jedem einzelnen zur Aufgabe macht. Freud hatte das Fundament gelegt, indem er die Person bzw. das neugeborene menschliche Wesen, das eine solche werden soll, in drei Teile zerlegte: das allein seinen Trieben gehorchende Es, das gesellschaftliche Werte und Normen beinhaltende Über-Ich und das zwischen beiden eingeklemmt sich formende Ich. Erikson zeigte, dass in diesem Prozess der Ausformung der Persönlichkeit, auch Ich-Identität genannt, einiges schiefgehen kann, worunter insbesondere Heranwachsende leiden. (Dass die Menschen in ihrer Umgebung darunter u. U. auch leiden, ist weniger von Belang.)
Eine Krise ist nach Erikson nicht ein kritischer Punkt am Rande des Abgrunds, sondern, etwas weniger dramatisch, eine notwendige Entwicklungsphase auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Ein Wendepunkt, an dem man vor oder zurück, nach links oder nach rechts gehen muss, um dem eigenen Leben eine Bestimmung, eine Richtung zu geben. Denn die ist nicht per se gegeben, so will es jedenfalls der Geist der Aufklärung, dem zufolge die Menschen – leicht modifiziert mit Jean-Jacques Rousseau sprechend – zwar überall in Ketten liegen, aber immerhin frei geboren sind. Daraus ergibt sich ein Anspruch, den es für viele Menschen in vormoderner Zeit nicht gab. Denn wenn der Adel erblich ist, der Sohn des Leibeigenen Leibeigener bleibt, der Sohn des Tischlers Tischler, und die Tochter standesgemäß verheiratet wird, braucht man sich nicht viele Gedanken darüber zu machen, wer man ist oder was man werden will. Identitätskrisen erübrigen sich.
Anders in unserer heutigen Gesellschaft, die eine Gesellschaft der Qual der Wahl ist. Gewiss empfindet nicht jeder diese Wahl als Qual. Nicht gebunden zu sein, sondern frei entscheiden zu können, sich Beruf, Wohnort, Lebenspartner und vieles andere selbst aussuchen zu können, empfinden viele als großes Glück, das ihre Vorfahren nicht hatten. Dennoch lässt sich kaum leugnen, dass es anstrengend sein kann, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Auswählen, Entscheidungen treffen, selbst bestimmen, was geschieht, das sind die charakteristischen Kennzeichen der egalitären und freien Gesellschaft, wie sie der westlichen Welt seit der Französischen Revolution vorschwebt. In ihrem Zentrum steht das autonome Individuum, das weiß, was es tut, es zumindest wissen soll und somit selbstverantwortlich ist.
Die meisten Menschen, die nicht zum Psychiater gehen, erreichen dieses Ziel. Oder, besser gesagt, umgekehrt: All diejenigen, die ihre Pubertät ohne bleibende Schäden hinter sich lassen, gehen nicht zum Psychiater. Ihre Identitätskrise beschränkt sich darauf, zwar ab und zu über die eigenen Füße zu stolpern, aber das wirft sie nicht so aus der Bahn, dass sie psychologischen Beistands bedürften, um sich wieder zurechtzufinden.
Zurechtfinden müssen sie sich allerdings immer, und dazu gehört, dass sie sich finden müssen. Ein bisschen Breakdance, Tecktonik, The Floss mögen dabei hilfreich sein, insbesondere in Gesellschaft derer, die gleiche Vorlieben haben. Der Anspruch ist nicht nur, zu entscheiden, was sie sein wollen, sondern herauszufinden, was sie sind. Die zugrunde liegende Annahme ist, dass das möglich ist. Einerseits erschaffen wir uns, was wir andererseits nur können, indem wir unser »wahres Selbst« finden, das irgendwo in unserem tiefsten Innersten steckt, unverwechselbar und unveränderlich. Das ist Identität in der individualistischen Gesellschaft – zumindest für die, die daran glauben.
Das ist nicht selbstverständlich; ist diese identitätsbesessene Gesellschaft doch auch eine solche, die ihre Mitglieder ständig dazu auffordert, sich »neu zu erfinden«, um glücklicher, produktiver und zufriedener als jemals zuvor zu werden, um mit der Sprache der Werbung zu sprechen, die, wie es ihre Art ist, das Wichtigste unausgesprochen lässt: Nämlich dass wir uns immer wieder neu erfinden müssen, um den Motor der Gesellschaft in Gang zu halten, den Konsum. Neue Kleider, neue Frisur, neue Sonnenbrille, die einzigartige Ferienreise, das neuste SUV-Modell – du möchtest auf dem letzten Stand sein? Wir zeigen dir, was du unbedingt haben musst. Wer so speziell ist wie du, verlangt spezielles Marketing, zugeschnitten auf deine Identität.
Zwischen dem »wahren Selbst« und der »neu erfundenen Identität« entfaltet sich das Leben in der Konsumgesellschaft. Nicht allen fällt es leicht, im Spannungsfeld dieser ja durchaus widersprüchlich erscheinenden Pole ihren Weg zu finden. Wie soll man denn sein wahres Selbst neu erfinden? Veränderung mit Beständigkeit zu versöhnen, ist schwierig, wenn man nicht wie Groucho Marx bereit ist zu sagen: »Dies sind meine Prinzipien; wenn sie Ihnen nicht gefallen, habe ich auch andere.«
Dass Menschen mit dem Lavieren zwischen Prinzipientreue und Erneuerung Mühe haben, kommt u. a. darin zum Ausdruck, dass unter Identitätskrisen nicht mehr nur die Halbwüchsigen leiden. Von dieser Zivilisationskrankheit werden inzwischen auch Menschen anderer Altersgruppen befallen, wenn sie z. B. im Zuge einer Scheidung, des Verlusts einer Anstellung oder sonstiger drastischer Einschnitte »außer sich geraten«, plötzlich Zweifel an sich selbst bekommen und auf die Frage, »Wer bin ich denn eigentlich?«, keine befriedigende Antwort finden, sie aber auch nicht achselzuckend beiseiteschieben können. Das sind diejenigen, die zu sehr an das wahre Selbst glauben. Wenn sie etwas tun oder ihnen etwas zustößt, das mit ihrer Vorstellung davon nicht in Einklang zu bringen ist, reagieren sie darauf mit einer Krise.
Leichter haben es diejenigen, die eine der für das gesellschaftliche Leben wichtigsten Fähigkeiten erlernt haben, die Fähigkeit nämlich, Identität darzustellen, Identitätsakte zu vollziehen. Das ist es, was uns nach Auffassung mancher Psychologen, die Identität als relational verstehen, in einer Gesellschaft abverlangt wird, in der Status nicht schicksalhaft, da erblich ist. Wir selber sind es, die unser wahres Selbst in der Beziehung zu anderen herauskehren und damit überhaupt erst konstruieren. Das so überaus wichtige Konzept der Selbstverwirklichung besagt eben dies; es verlangt von uns aktiven Einsatz. Nicht durch Demut und Vertrauen in den Lauf der Dinge kommen wir in der Welt voran, sondern durch Arbeit an uns selbst, durch wohlüberlegte Entscheidungen, durch Einstudieren und Proben, kurz, durch die Inszenierung des Auftritts, den wir heute Vormittag beim Kundengespräch, später mit dem neuen Abteilungsleiter und am Abend im Restaurant mit der Angebeteten haben werden.
Shakespeare wusste das in seiner Komödie
»Wie es euch gefällt« schon vor vierhundert Jahren:
Die ganze Welt ist Bühne
Und alle Fraun und Männer bloße Spieler.
Sie treten auf und gehen wieder ab,
Sein Leben lang spielt einer manche Rollen
Durch sieben Akte hin.
Nicht jeder und jedem liegt freilich das Rollenspiel, was in einer Gesellschaft, in der alle dem Ranking und Rating ausgesetzt sind, ein Grund dafür ist, dass manche besser vorankommen als andere. Wer die Dinge laufen lässt, hat keine guten Chancen. Im Kleinen – zum Beispiel im Supermarkt beim Einkaufen – wie im Großen – zum Beispiel bei der Stellensuche oder bei der Vergabe von Aufträgen – sind wir ständig gefordert, auszuwählen und Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet Freiheit, aber eben auch Qual, die sich etwa darin äußert, was Psychologen Entscheidungsmüdigkeit nennen. Entscheidungen zu fällen kostet Energie, denn damit wird die Fähigkeit in Anspruch genommen, sich selbst zu beherrschen. Wenn diese Energie erschöpft ist, leidet der Mensch unter Entscheidungsmüdigkeit und trifft deshalb unter Umständen die falsche Entscheidung.
Eine Grundannahme der individualistischen Gesellschaft ist es, dass jeder Mensch eine Identität hat, ein ureigenes Wesen, das unabhängig von prägenden Faktoren der Umwelt – Rasse, Religion, Klasse u. a. – in die er hineingeboren wird, existiert. Wachsender Wohlstand in der westlichen Welt seit dem zweiten Weltkrieg hat dazu geführt, dass wir uns immer mehr erlauben können, im materiellen wie im übertragenen Sinne. In den hippen 1960er und 70er Jahren entstanden unkonventionelle Familienstrukturen, und immer mehr Menschen entschieden, dass bürgerlicher Konformismus nicht die einzige Leitlinie im Leben sein sollte. Gleichzeitig wurde das Warenangebot immer bunter und zwang uns dazu, auszuwählen. Und die Toleranz für Vielfalt, nach der jeder sein »wahres Selbst« ausleben können soll, nahm nicht nur zu; die Freiheit, dieses Selbst zu realisieren, es auszuleben, ist zu einem kategorischen Imperativ geworden. Das bedeutet wiederum Entscheidungen darüber, wie dieses Selbst in eine präsentable Identität auf der Bühne der Gesellschaft darzustellen ist: Freiheit für alle!
Dass dieser Imperativ manche überfordert, bezeugen die Leiden der jungen Werthers von heute, die sich tanzend den »Snakes« oder den »Dead Boys« überlassen oder von einer Identitätskrise heimgesucht werden. Sie ziehen sich von der Bühne der Gesellschaft zurück oder betreten sie gar nicht erst: die Heranwachsenden, die unter Sozialphobie leiden, die NEETs (Not in Education, Employment or Training) Jugendliche ohne Schul- oder Berufsausbildung und Anstellung, die italienischen bamboccini (erwachsenen Babys) und die japanischen hikikomori, die sich jahrelang in ihr Zimmer einschließen und mit niemandem reden, um nur drei Beispiele von Unangepassten zu nennen, die es in einer freiheitlichen Gesellschaft, die sich zur Achtung jedes einzelnen Menschen bekennt, eigentlich gar nicht geben sollte.
Es gibt sie aber. Die Gesellschaft, in der niemand an den Rand gedrängt wird, existiert nur im Paradies und gewiss nicht dort, wo das Grundprinzip der Achtung des Menschen a priori durch das des Konkurrenzkampfes der Menschen konterkariert wird. Um in diesem Kampf zu bestehen, stützen wir uns auf unsere Identität. Dabei wird aus der Ich-Identität des »wahren Selbst« unversehens die »Wir-Identität« der Gruppenzugehörigkeit. Denn so wahr und achtbar das individuelle Selbst auch sein mag, auf sich allein gestellt, ist es oft zu schwach, um Toleranz für seine Besonderheit einfordern zu können. Aus der Identität des »ich kann nicht anders«, denn »Ich bin ich. Das allein ist meine Schuld!« wird deshalb die Identität des »ich bin eine/r von uns«. In diesem Übergang von »Identität« zu »sich identifizieren mit« ruht der Keim der Intoleranz, den nicht alles überwuchern zu lassen, die größte unerfüllte Aufgabe der Aufklärung ist. Da der Mensch ein soziales Wesen ist, wird sich dieser Keim nie ausmerzen lassen, aber individuelle Identität als Idee und als Forderung birgt die Möglichkeit, kollektive Identität nicht als unentrinnbares Geschick zu begreifen. Die Betonung der individuellen Identität kann man als Aufforderung verstehen, sich nicht gedankenlos einer kollektiven Identität zu überlassen.