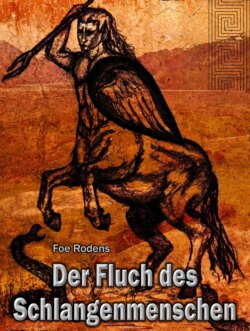Читать книгу Der Fluch des Schlangenmenschen - Foe Rodens - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Fürst und der Krieger
ОглавлениеDie Kentauren im Zentrum der Gruppe verlangsamten ihr Tempo, die an den Seiten wurden schneller und bildeten so einen Halbkreis um sie herum, alles ohne Befehl. Alle wussten, was sie zu tun hatten; alles geschah schweigend, konzentriert und doch mühelos.
Jetzt konnte Temi es nicht mehr übersehen: Die Kentauren waren ihr ganz offensichtlich nicht freundlich gesinnt. Sie hatten ihre Schwerter gezogen, einige richteten Pfeile oder Lanzen auf sie. Ihre Gesichter erschienen ihr wie hasserfüllte Grimassen.
Nicht zum ersten Mal an diesem Tage setzte Temis Herz einen Schlag aus. Ihr wurde abwechselnd heiß und kalt. Das Shirt klebte an ihrer Haut, sie zitterte und auf ihren Handflächen bildeten sich kleine Seen von Angstschweiß. Sie schloss für eine Sekunde die Augen; als sie sie wieder öffnete, hatten die Pferdemenschen den Kreis um sie geschlossen.
„Als ob das nötig wäre!“, dachte Temi bitter. Sie hätte zu Fuß ohnehin nicht entkommen können, vermutlich nicht mal zu Pferd. Jetzt konnte sie wirklich nur noch hoffen, dass das Ganze ein Traum war.
„Bist du hier, um uns auszuspionieren, Mensch?!“, blaffte einer der Männer sie an. Es war wohl eine rhetorische Frage, denn er ließ ihr gar keine Zeit, zu antworten. „Was sollst du rausfinden? Die Zahl unserer Krieger? Wo wir unsere Lager haben?“
Zu ihrem eigenen Erstaunen verstand Temi, was er sagte. Doch wie er „Mensch“ ausgesprochen hatte, so verächtlich und zornig, das verhieß nichts Gutes!
Trotzdem traf sein Schlag sie unerwartet. Er schmetterte seinen Handrücken in ihr Gesicht und die Wucht des Schlages ließ sie gegen den nächsten Pferdekörper zurücktaumeln. Sie schnappte nach Luft und sah einen Moment sogar Sternchen – doch ein fester Griff um ihren Nacken holte sie sofort wieder in die Gegenwart zurück. Der Kentaur hinter ihr packte sie unsanft am Hals. Seine Finger waren wie eine Schraubzwinge und sie fürchtete schon, dass er mit ihr kurzen Prozess machen und ihr das Genick brechen würde. Als das nicht geschah, wagte sie es, die Hand zu heben und sich die brennende Wange zu halten.
„Tharlon hat dich was gefragt!“, knurrte der Kentaur hinter ihr. „Antworte!“
„Ich ... ich will nicht spionieren!“, stammelte Temi. Sie ahnte, dass niemand ihr glauben würde.
„Was machst du dann hier vor unserem Lager?!“, donnerte Tharlon. Er warf ungeduldig den Kopf zurück. Seine langen, dunkelbraunen Haare waren auf der Mitte seines Kopfes wie ein Helmbusch hochgebunden und flogen wie ein Pferdeschwanz hin und her. Alle anderen trugen Helme: Manche hatten nicht mehr als einfache Kappen aus Leder auf, andere eiserne Helme mit Zacken oder Flügeln. Viele hatten Hirsch- oder andere Geweihe daran befestigt. Diese martialisch anmutende Mischung ließ diesen Trupp noch viel wilder und gefährlicher wirken. Temi schluckte.
„Ich wusste nicht ...“, setzte sie an, doch Tharlon unterbrach sie: „Lüg nicht! Jeder Bewohner dieses Landes weiß, dass Thalas uns gehört. Wenn ihr Menschen anfangt, unsere Lager zu beobachten, dann kann das nur eines bedeuten. Ihr wollt uns wieder vertreiben! Doch du wirst das nicht mehr erleben!“ Die letzten Worte spie er ihr regelrecht ins Gesicht.
Temi zuckte bei fast jedem Wort zusammen. Er war verdammt wütend und voller Hass. Ihr Herz rutschte ihr bis in die Hose, und sie spürte, wie alle Farbe aus ihrem Gesicht wich. Hatte sie irgendeine Chance, sich zu verteidigen?
Einige Kentauren stampften mit den Hufen auf den Boden, wie Stiere vor einem Angriff. Wie viel Zeit blieb ihr noch? Was konnte sie tun? „Ich habe nicht ... ich wusste nicht ... ich bin nicht von hier!“, brachte sie hervor, aber die Kentauren schienen sie nicht mal zu hören. Was sollte sie sonst sagen? Sie hatte keinerlei Ahnung, wieso sie eine Spionin sein sollte. Offenbar hassten sich Menschen und Kentauren, doch sie hatte sich nicht gerade unauffällig verhalten, wie es ein Spion wohl getan hätte. Aber das war den Kentauren anscheinend egal.
Schnaubend wie ein Pferd bäumte sich der Rossmensch auf seine Hinterbeine. Temi hielt den Atem an. Ein imposanter Anblick! Die Kentauren waren ohnehin viel größer als sie, aber nun überragte Tharlon sie um mehr als das Doppelte. Dass er sie nicht mit den Hufen zermalmte, verdankte sie wohl dem Kentauren, vor dessen breiter Pferdebrust sie noch immer stand. Dabei war sie sich sicher, dass diese Wesen ihre Gegner mit wuchtigen Tritten außer Gefecht setzen konnten, ohne ihre Artgenossen auch nur zu berühren. Selbst wenn sie so dicht gedrängt standen wie hier.
Mit einem wütenden Schrei hob der Kentaur sein Schwert.
„Halt!!“ Eine schneidende Stimme gebot ihm Einhalt.
Der Befehl fuhr Temi eisig durch Mark und Bein. Den Kentauren ging es ähnlich: Tharlon erstarrte in der Bewegung. Er tänzelte noch einen Moment auf seinen Hinterläufen, dann setzte er mit einem wuchtigen Stampfen die Vorderläufe wieder vor ihr auf den Boden. Temi wagte kaum aufzusehen und hielt angespannt den Atem an. Als sie schließlich doch den Blick hob, sah sie ihn auf der Kuppe des Hügels.
Schon aus der Ferne wirkte dieser Pferdemensch furchteinflößender als alle anderen, die um sie herumtänzelten, sichtlich in Aufregung versetzt. So stolz die Krieger wirkten und waren – er war majestätischer als sie und war sich dessen auch bewusst. Er strahlte ein Selbstbewusstsein und eine Autorität aus, die man fast greifen konnte.
Seine Schultern waren straff gespannt, die Muskeln tanzten an seinen nackten Armen und am Oberkörper. Pechschwarzes Haar fiel über die blassen Schultern und wehte wild im Wind. Die Beine mit dem dunkelbraunen Fell waren ebenfalls von steinharten Muskeln bepackt. Düstere Schatten huschten über sein Gesicht. Er schritt auf sie zu, zielstrebig, aber ohne jede Eile.
Tharlon senkte widerwillig, aber gehorsam die eiserne Klinge und neigte respektvoll den Kopf vor dem nahenden Artgenossen. Hatte sie bisher ihn für den Anführer gehalten, so gab es jetzt keinen Zweifel: Der Neue war der Befehlshaber.
Nervös wichen die Kentauren vor ihm zurück, als er langsam in den Kreis trat. Es entging Temi nicht, dass die Kämpfer regelrecht erschrocken über sein Auftauchen waren.
Sie hörte ihr Gemurmel, ohne es zu verstehen, bis Tharlon es mit einem strengem Blick unterband.
Nun stand der Schwarzhaarige vor ihr. Wortlos blickte er einige Sekunden, die ihr ewig lang vorkamen, auf sie hinunter. Die Kälte in seinem Blick ängstigte sie beinah noch mehr als der pure Hass in den Gesichtern der anderen.
„Wie ist das möglich?“, fragte Tharlon verblüfft. Die Kentauren schienen Temi völlig vergessen zu haben. Alle Blicke ruhten nur auf dem Neuankömmling, als wäre er von den Toten auferstanden. Dabei sah er so aus, als könnte er den Tod persönlich dazu bringen, von seinem Opfer abzulassen.
Und nun starrte er sie an, musterte Temi, als könnte er ihre Gedanken lesen.
„Sie haben Euch gefangen genommen. Man entkommt nicht einfach aus ihren Kerkern“, fuhr Tharlon mit erstickter Stimme fort.
„Noch sind es auch unsere Kerker und unsere Leute halfen, sie zu bauen!“, antwortete der Schwarzhaarige kühl, ohne Temi aus den Augen zu lassen. „Ich habe Anhänger in der Stadt, die mich unterstützen. Vergesst das nicht.“
Temi wagte es nicht, ihren Blick von ihm zu lösen – hoffte aber inständig, dass er sich dadurch nicht herausgefordert fühlte. Wenn die Sagen stimmten, waren Kentauren streitlustige Gesellen, äußerst aggressiv und heißblütig. Bisher sprach alles dafür. Und ausgerechnet sie musste ihnen begegnen.
„Sie stammt nicht von hier“, wechselte der schwarzhaarige Pferdemensch plötzlich das Thema. Alle Blicke wanderten zu ihr. Temi schluckte. Die Kentauren starrten sie unverhohlen an, bis ihr Anführer sie laut anherrschte. „Seht sie euch doch an. Habt ihr schon mal derartige Kleidung gesehen? Ein solches Band um ihren Arm?“ Temis Blick fiel auf ihre Armbanduhr, die stehengeblieben war. „Oder so rote Haare an einem Menschen und so kurze Haare an einer Frau?“, fuhr der Kentaur fort. „Sie ist nicht wie die anderen.“
„Alles nur Tarnung!“, brauste Tharlon auf. Doch mit einer scharfen Handbewegung schnitt der andere ihm das Wort ab. „Helle Haut, rote Haare. Sie müsste eine Sagengestalt aus dem hohen Norden sein, wenn sie aus dieser Welt wäre.“
„Verzeiht, Xanthyos!“ Tharlon senkte den Kopf.
Xanthyos. Temis Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Schon der Name klang bedrohlich. Zu viele dunkle Vokale und Konsonanten in diesem Wort. A und O, X, T, S. Fast die gleichen wie bei Thanatos, dem Gott des Todes, nach dem sie eben gerade den kleinen Kater benannt hatte. Doch der war im Gegensatz zu ihr schlau genug gewesen, sich zu verkrümeln, als es gefährlich wurde ... bevor es tödlich wurde. Die Ähnlichkeit der Namen machte Temi nun nicht gerade Mut.
Xanthyos’ Stimme riss sie aus ihren Gedanken. „Ich werde sie zu Aireion bringen.“
„Was?!“ Tharlon sah mit einem Ruck auf. Nicht nur er war entsetzt. Auch die anderen Kentauren scharrten mit ihren Hufen den Boden auf und tänzelten unruhig.
„Tut das nicht!“ – „Er wird Euch wieder gefangen nehmen, Majestät.“ – „Er wird Euch nicht noch einmal entkommen lassen!“
Majestät? Kerker? Wie passte das zusammen?
Aber sie wagte nicht nachzufragen. Sie wollte die Aufmerksamkeit der Kentauren nicht unnötig auf sich ziehen. Und ganz sicher war sie nicht in der Position, Fragen zu stellen.
„Das ist mir bewusst.“ Harsch unterband Xanthyos jegliche Diskussion. Respektvoll schwiegen die anderen Pferdemenschen, aber die Blicke, die sie einander zuwarfen, wirkten verstört und ungläubig. Sie verstanden seine Entscheidung nicht und waren nicht damit einverstanden.
„Warum ist ihr Leben so wichtig?“, wagte Tharlon zu fragen. Er scharrte mit den Hufen und senkte ehrerbietig den Kopf, als Xanthyos ihn mit zusammengekniffenen Augen ansah. Er hatte wohl nicht das Recht, die Entscheidung seines Anführers infrage zu stellen.
„Woher kommst du?“, fragte Xanthyos kühl. Er fragte sie.
„Aus ... aus Trier“, brachte sie mit krächzender Stimme hervor.
„Wo ist das?“, fragte er, wie aus der Pistole geschossen – so schnell, dass sie sicher war, dass er das auch gefragt hätte, wenn sie Berlin, Honolulu oder Wellington gesagt hätte: Der Name spielte keine Rolle.
„Nicht ... hier. Ich glaube, nicht in diesem Land ... in dieser Welt.“
„Eine Außenweltlerin also“, schloss Xanthyos. Es war keine Frage, sondern eine Feststellung und sie war nicht an sie gerichtet, sondern an seine Krieger. Er sah seine Leute herausfordernd an und niemand widersprach. Einer nach dem anderen senkte leicht den Kopf, signalisierte seinem König oder Fürst, oder was auch immer Xanthyos war, seine Unterstützung.
„Steig auf meinen Rücken!“
Was?! Temi traute kaum ihren Ohren. Eben noch sollte sie getötet werden, jetzt durfte sie gar auf einem Kentauren reiten? Die anderen Pferdemenschen starrten Temi finster an. „Majestät, wenn Ihr es wünscht, werde ich sie für Euch tragen“, bot sich Tharlon an. Seiner Stimme war deutlich anzuhören, wie viel Überwindung ihn diese Worte kosteten. Doch Xanthyos schüttelte den Kopf. „Ich gehe alleine.“
„Das könnt Ihr nicht!“ Entsetzt sahen die Krieger ihn an.
„Schweigt! Es bringt niemandem etwas, wenn meine Befehlshaber mit mir gefangen genommen werden.“ Xanthyos’ Stimme duldete keinerlei Widerspruch. Er knickte mit seinen Vorderläufen ein, damit Temi leichter auf seinen Rücken klettern konnte. Sie zögerte. Ihre Knie zitterten. Sie musste wohl gehorchen, aber durfte sie wirklich ...? Sie machte ein paar Schritte nach vorne, bis sie nur ein paar Zentimeter von Xanthyos’ massigem Pferdeleib trennten. Ihr Herz klopfte wie wild, als sie den Pferdekörper berührte. Verärgern wollte sie ihn auf keinen Fall! So vorsichtig wie möglich hielt sie sich an der Mähne fest, die aus dem Pferderücken wuchs und dann in feinere kurze schwarze Haare am menschlichen Teil des Körpers überging.
„Lasst den Feind die feindlichen Handlungen beginnen, bevor ihr zuschlagt. Und wartet auf meine Rückkehr!“
Mit diesen Worten trabte er erhobenen Hauptes los. Temi fiel fast von seinem Rücken, weil sie es nicht wagte, ihre Beine so fest gegen seinen Körper zu pressen, wie sie es beim Reiten tun musste. Zu fest an seiner Mähne reißen wollte sie auch nicht. Er konnte ihr Zögern wohl spüren. „Halt dich richtig fest!“, befahl er ihr. Ihre Hände zitterten, aber sie gehorchte und drückte ihre Schenkel so fest an seinen Körper, wie sie nur konnte.
Kaum merkte er das, wechselte er aus dem Trab, kanterte ein paar Sätze lang und verfiel dann in einen regelmäßigen Galopp. Trotz ihrer Anspannung atmete Temi auf. Beim Reiten hatte sie beim Trab immer mehr Probleme als bei der schnelleren Gangart. Und der Kentaur rannte so leichtfüßig über die Wiese, dass sie zu fliegen meinte. Er hielt genau auf das befestigte Lager zu und Temi erwartete schon, dass ihnen aus den Zelten Wachen entgegenkommen und sie gefangen nehmen würden. Doch es war weit und breit niemand zu sehen. Xanthyos wurde auch nicht langsamer. Er rannte weiter durch die leeren Gassen und schoss nach wenigen Sekunden durch das offene Holztor auf der anderen Seite des Lagers hinaus. Als er eine leichte Kurve lief, wagte Temi es, einen Blick zurückzuwerfen. Die anderen Kentauren waren, wie Xanthyos befohlen hatte, tatsächlich zurückgeblieben. Sie verfolgten sie von der Anhöhe aus mit Blicken.
Unvermittelt neigte Xanthyos im vollen Lauf den Kopf zur Seite und blickte sie aus den Augenwinkeln an. „Wie heißt du?“, fragte er und sprang über einen kleinen Graben, ohne auf den Boden zu sehen. Er schien die Gegend in- und auswendig zu kennen.
Seine Stimme klang barsch, sein Blick hingegen verriet zu Temis Verwunderung eher Neugier und Interesse. Das war ein gutes Zeichen, entschied sie.
„Temi“, antwortete sie schnell.
„Wie bist du hier hergekommen?“
„Ich weiß es nicht. Einen Moment war ich in meinem Zimmer in Trier, den nächsten hier. Also dort hinten“, korrigierte sie sich stotternd. „Aber ich weiß nicht mal, wo hier ist. Oder wie es passiert ist.“ Sie hoffte, dass er ihr das glaubte. „Eure Majestät!“, ergänzte sie. Die Krieger hatten ihn so genannt; dann war es vermutlich klüger, das auch zu tun.
Xanthyos runzelte die Stirn, während er weiter geradeaus über die Ebene galoppierte. „Ich glaube dir, dass du nicht weißt, wo hier ist. Ich habe noch nie etwas von einer Menschenstadt namens ... Trier gehört. Und kein Mensch unserer Welt würde mich freiwillig Majestät nennen, nicht einmal, um sein Leben zu retten.“
Temi zuckte mit den Schultern. „Aber wenn Ihr König seid ...“ Sie verstummte. Menschen und Kentauren hatten hier wohl kaum einen gemeinsamen König. Die Kentauren hassten die Menschen. „Ehre, wem Ehre gebührt, heißt es da, wo ich herkomme“, erklärte sie und wagte ein kleines Lächeln. Xanthyos presste die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. Er blickte wieder nach vorne, sodass Temi sein Gesicht nicht mehr sehen konnte, und stoppte dann so plötzlich, dass Temi bei einem Pferd wohl vornüber geflogen wäre. So aber prallte sie gegen seinen menschlichen Oberkörper.
Sie wollte sich entschuldigen, aber Xanthyos kam ihr zuvor. „Verzeih!“, sagte er. „Ich bin es nicht gewohnt, jemanden auf meinem Rücken zu tragen.“ Temi versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Das Ganze wurde immer verworrener. Der König bat sie um Verzeihung, obwohl Menschen und Kentauren verfeindet waren. Wie sollte sie das verstehen?
Xanthyos drehte sich wieder zu ihr um. „In deiner Welt sind Kentauren und Menschen nicht verfeindet?“, fragte er ungläubig. Temi öffnete und schloss den Mund sofort wieder. Wie sollte sie ihm erklären ...? Gab es irgendeinen sanften Weg? Kaum – zumindest fiel ihr auf die Schnelle nichts ein und er wartete auf ihre Antwort.
„Bei uns ... gibt es keine Kentauren“, murmelte sie, halb in der Hoffnung, dass er sie nicht hörte und nicht nachfragen würde. Aber das war natürlich ein frommer Wunsch. Er hatte sie gehört – und verstanden.
Seine Augen weiteten sich. Dann wandte er sich erneut ab und ging ohne ein Wort wieder los. Er ging die nächsten Meter, langsam, wohl in Gedanken versunken, ehe er wieder antrabte. „Außenwelt ... vielleicht sollte man es Fremdwelt nennen“, sagte er, mehr zu sich selbst als zu ihr. „Ich hätte es wissen müssen.“
Temi schwieg. Woher hätte er es wissen müssen? Wieso nahm er so einfach hin, dass es in ihrer Welt keine Kentauren gab? Seine Artgenossen hatten ihr noch nicht mal geglaubt, dass sie überhaupt aus einer anderen Welt stammte. Auch die meisten Menschen in ihrer Welt hätten sie für verrückt erklärt, wenn sie behauptet hätte, aus einer anderen Welt zu stammen. Doch Xanthyos schien das alles nicht wirklich zu überraschen.
Er hielt erneut an. „Steig bitte ab. Ich möchte dein Gesicht sehen“, forderte er sie auf. Temi glitt gehorsam von seinem Rücken.
„Du bist nicht die Erste, die vollkommen anders gekleidet ist als die Menschen hier.“ Sie starrte ihn an. Meinte er etwa ... „Es waren schon andere Außenweltler hier?“
Xanthyos nickte und Temis Herz schlug schneller vor Aufregung. „Viele?“, fragte sie vorsichtig; diesmal schüttelte Xanthyos sofort den Kopf. „Eine Hand voll vielleicht. Doch keiner war so nahe an unserem Lager.“ Er verzog keine Miene, als er fortfuhr; er beobachtete sie nur genau. „Leider hat keiner von ihnen lange genug überlebt. Sie sind zwischen die Fronten geraten und entweder von uns oder den Menschen getötet worden. Aber wir sind nicht einmal ganz sicher, ob sie wirklich aus der Außenwelt stammten.“
Temi spürte, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Auch sie war ja nur knapp dem Tod entronnen. Xanthyos bemerkte ihre Angst.
„Sobald du in der Stadt bist, bist du außer Gefahr“, beruhigte er sie. „Ihr wollt mich in die Stadt der Menschen bringen? Ihr solltet Euch nicht in Gefahr bringen. Setzt mich doch lieber in der Nähe der Stadt ab, dann könnt ihr ungefährdet wieder verschwinden!“, sprudelte es aus ihr heraus. Sie hatte zwar im ersten Moment furchtbare Angst vor dem Kentauren gehabt, aber er schien doch freundlich zu sein, und sie wollte nicht, dass ihm etwas zustieß.
Xanthyos lachte auf. Das Lachen machte ihn noch sympathischer. Sein langes schwarzes Haar hüpfte und sprang umher, an seinem Mund bildeten sich kaum sichtbare Lachgrübchen. Seine Augen funkelten in der Sonne moosgrün wie Smaragde.
„Nein, nach Šadurru zu gehen, wäre Selbstmord und ich bin noch nicht bereit, zu sterben. Ich werde dich zu Fürst Aireion bringen, dem Herrscher unseres Volkes.“ Die Verachtung, mit der Xanthyos das Wort „Fürst“ aussprach, war nicht zu überhören. Es klang aus seinem Mund wie ein Schimpfwort. Das Lächeln war verschwunden, jetzt funkelten seine Augen vor Wut. „Er und seine Anhänger sind schwach und feige. Sie sind Menschenfreunde. Sie sehen nicht, dass uns nur noch der Krieg Frieden bringen kann.“
„Aber wieso ...“, fragte Temi.
„Ich bin sicher, der Fürst wird dir alles erklären; er wird sich freuen, dich zu sehen“, unterbrach Xanthyos sie unwirsch. Temi schluckte. Es war wohl klüger, jetzt den Mund halten. Sie hatte offenbar einen wunden Punkt berührt und es war besser, den Kentauren nicht weiter reizen. Sonst überlegte er es sich vielleicht anders und hielt sie doch für einen Menschen aus seiner Welt. Das wollte sie nicht riskieren.
„Komm, steig auf“, befahl er ihr, aber mit eher sanfter als herrischer Stimme. „Je schneller wir da sind, desto weniger kann passieren.“ Er hatte sich wieder im Griff.
Kaum saß sie auf seinem Rücken, startete Xanthyos und nach wenigen Sprüngen Anlauf flogen sie regelrecht über die Wiese. Das Gras musste Xanthyos bis zu den Knien, an mancher Stelle fast bis zum Bauch reichen, doch mit kräftigen Sprüngen katapultierte er sich über das Dickicht hinweg. Wenn es ihn behinderte, merkte Temi nichts davon. Von hier oben wirkte die Wiese wie ein wogendes grünes Meer, nicht einmal durchsetzt von Blumen oder kleinen Büschen. Doch Xanthyos hielt nun auf einen Wald zu. Die sanften Hügel hatten sie längst hinter sich gelassen und Temi konnte nicht erkennen, wie groß der Wald war oder was dahinter lag. Selbst im gleißenden Sonnenlicht wirkte er dunkel und bedrohlich. Zumindest bis sie näherkamen. In einer Geschwindigkeit, die Temi den Atem stocken ließ, schossen sie auf die Bäume zu und erst ein paar Sekunden, bevor sie die erste Baumreihe passierten, bemerkte sie einen schmalen Pfad im Wald – der aus der Nähe doch lichter wirkte. Xanthyos preschte mit unverminderter Geschwindigkeit auf den engen, von Moosen und Efeuranken überwucherten Waldweg. Vögel flogen schimpfend auf, wie die Amseln, die sich gestört fühlten, wenn man „ihren“ Garten betrat, ihren Garten zu Hause in Deutschland.
Der Weg wurde offenbar nicht oft benutzt. An einigen Stellen war er zugewachsen und mehrmals duckte sich Xanthyos in letzter Sekunde vor tief herabhängenden Zweigen. Den einen oder anderen bekam Temi dann ab, obwohl der Kentaur fürsorglich den Arm hob und die Zweige aus dem Weg schlug.
„Duck dich!“, rief er ihr zu, als wieder einmal ein kleiner Ast in ihr Gesicht peitschte. Das war leichter gesagt als getan. Es war ohnehin schwierig genug, auf dem hohen Pferderücken das Gleichgewicht zu halten. Ducken konnte sie sich nur, indem sie näher an Xanthyos heranrückte. Sie zögerte kurz, aber als ihr der nächste Zweig an den Hals schlug, schmiegte sich Temi scheu an seinen Körper und schlang ihre Arme um seinen Oberkörper. Sie spürte, wie Xanthyos seine Muskeln kurz anspannte. Seine Sprünge wurden stockender, staccatohafter, als kämpfte er mit sich selbst, ob er diese ungewohnte Berührung zulassen oder sie abschütteln sollte. Doch bald entspannte sich der Kentaur und seine Sprünge wurden wieder länger und rhythmischer.
Der Wald schien kein Ende zu nehmen; Nadel- und Laubbäume wechselten sich ab; hier sprang Xanthyos unvermittelt über einen Bach, dort wurde er langsamer, weil er sich einen Pfad durch ein Dickicht aus Schlingpflanzen und Brennnesseln bahnen musste. Dabei blieb die Landschaft flach; Temi bemerkte keine wesentlichen Anstiege oder Punkte, von denen sie die Umgebung hätte überblicken können. Etwas Gutes hatte der mühsame Ritt durch das Unterholz aber: Die sengende Sonne schimmerte nur hin und wieder durch das dichte Blätterdach. Es musste definitiv Sommer sein, oder sie befand sich in einem Land, in dem schon im Frühling die Temperaturen so hoch waren wie im deutschen Sommer. Vielleicht waren sie in Thessalien, den griechischen Sagen zufolge dem Heimatland der Kentauren.
Temi verlor jedes Zeitgefühl und ihre Armbanduhr funktionierte in dieser Welt nicht. Irgendwann, Temi schätzte nach einer Stunde oder vielleicht anderthalb, lichtete sich urplötzlich der Wald. Ein paar Hügel und eine Wiese mit hohen Gräsern breiteten sich vor ihnen aus. Und dort, nicht weit von ihnen entfernt, ragte eine steinerne Stadtmauer in die Höhe, nur überragt von einer Veste in der Stadt.
Xanthyos hielt abrupt an und erlaubte ihr, die Szenerie zu erfassen. Kleine Gestalten sprangen im Schatten der Mauer umher und jagten einander nach, über die sonnengeflutete Wiese bis zu einem einsamen Baum auf halbem Weg zwischen Mauer und Waldrand, und zurück. Temi sog hörbar Luft ein: Es waren Kinder – spielende Kentaurenkinder! Sie hatte sich noch nie Kentaurenkinder vorgestellt. Ihr Herz zerschmolz bei dem Anblick. Doch sie hatte keine Zeit, diesen Wesen mit den langen staksigen Beinen zuzusehen, denn ein klarer Trompetenton erscholl aus der Stadt. Die Soldaten auf den Stadtmauern waren auf sie aufmerksam geworden. Die Kentaurenkinder erstarrten in ihren Bewegungen, mit weit gespreizten Beinen, wie Fohlen, die sich verjagt hatten. Sie warfen wild den Kopf in alle Richtungen, um die Gefahr ausfindig zu machen, vor der die Trompete gewarnt hatte. Aus dem offenen Tor schossen mehrere Krieger heraus und galoppierten auf Xanthyos zu. Sie trugen keine massigen Eisenrüstungen, sondern Lederharnische und Helme mit wild flatternden Helmbüschen aus Pferdehaar – oder vielleicht ihrem eigenen Haar. Ein Ruck ging durch Xanthyos’ Körper, als er aus dem Stand losgaloppierte. Eins der Kinder zeigte auf sie und mit einem Aufschrei stoben plötzlich alle auseinander und in Richtung Stadttor.
Temi richtete ihre Aufmerksamkeit jetzt ganz auf die acht Krieger, die ihre Schwerter gezogen hatten und fast gleichzeitig mit ihnen den einsamen Baum erreichen würden. Als hätte er ihre Gedanken erraten, wurde Xanthyos langsamer.
„Xanthyos!“, stieß eine der Wachen hervor, als sie Temi und den Schwarzhaarigen erreichten und ein, zwei Meter von ihnen entfernt zum Halt kamen.
„Das bin ich“, gab Xanthyos überheblich zurück. Er legte eine Hand auf Temis Arm – eine Geste, die den anderen Pferdemenschen nicht verborgen blieb. Das Gesicht des Kommandanten der Stadtwache verhärtete sich noch mehr. Temi ahnte wieso: Wenn sie in der Stadt in Sicherheit sein sollte, wie er behauptet hatte, dann erzwang Xanthyos sich freien Eintritt in die Stadt, indem er sie „in der Hand“ hatte. Aber seltsamerweise störte es sie nicht einmal, dass er sie als Pfand benutzte. Der schwarzhaarige Kentaur war ihr auf seltsame Art sympathisch, obwohl seine Krieger Menschen hassten. Wieso die Stadtwachen ihn gefangen nehmen wollten, verstand sie immer noch nicht. Sie musste sich jetzt einfach darauf verlassen, dass die „Menschenfreunde“, wie Xanthyos sie genannt hatte, Temi nicht in Gefahr bringen wollten – und deshalb Xanthyos nicht zu nah kamen.
Sie ergriff seine Hand, die auf ihrem Arm lag, und hielt sie fest. Sichtlich verblüfft drehte er sich um. Temis Mundwinkel zuckten leicht nach oben. Damit hatte er wohl nicht gerechnet.
Der Befehlshaber schnaubte verärgert, drehte sich mit einer ungestümen Bewegung um und setzte sich an die Spitze der kleinen Gruppe. „Folgt mir. Fürst Aireion wird euch sprechen wollen.“ Xanthyos nickte kurz und im Trab näherten sie sich der Stadt und gingen dann kurz vor dem Tor ins Schritttempo über. Temi entging es nicht, dass die Wachen Xanthyos in die Mitte genommen und ihre geraden und gekurvten Schwerter noch nicht weggesteckt hatten. Auf der Stadtmauer standen mehrere Kentauren mit Bogen und locker aufgelegten Pfeilen, bereit, auf sie zu zielen. Im Torbogen standen zwei weitere Pferdemenschen mit Lanzen, die die Sarissen der makedonischen Infantrie wie Besenstiele aussehen ließen: Sie hatten gebogene Spitzen und auf der Innenseite kleine Zacken, die wie Widerhaken wirken würden, wenn die Lanze ihr Ziel traf.
In sicherem Abstand zum Tor, außerhalb der Mauer, standen immer noch einige Kinder. Sie wichen ängstlich zurück, als Temi in ihre Richtung sah. Ein Mädchen und ein Junge starrten sie neugierig an – oder eher Xanthyos?
Eskortiert von den Wachen schritt der würdevoll mit erhobenem Kopf durch das Stadttor. In der Stadt hatte sich ihre Ankunft schon herumgesprochen: Am Straßenrand versammelten sich Männer, Frauen und Kinder und musterten sie unverhohlen. Nervös drückte Temi Xanthyos’ Hand fester. Sie hasste es, angestarrt zu werden. Dass es Kentauren waren, zwischen denen sie auffiel wie ein bunter Hund, machte es nicht besser. Es behagte ihr nicht, ihnen hilflos ausgeliefert zu sein. Allerdings schauten diese Pferdemenschen sie nicht so voller Hass an, wie Xanthyos’ Krieger, sondern neugierig, wie ein exotisches Tier, das sie noch nie zuvor gesehen hatten.
„Dir wird nichts geschehen!“, flüsterte Xanthyos ihr zu. Temi wollte ihm nur zu gerne glauben. Doch ihre Angst ließ nur langsam nach. Schritt für Schritt näherten sie sich der Veste. Es war erstaunlich! Wie konnten Halbmenschen mit einem tierischen Unterleib derartig hohe Gebäude errichten? Schließlich waren sie weder in der Lage zu klettern noch auf Mauern zu balancieren. Die Stadtmauer war freilich breit genug, dass zwei Kentauren hintereinander stehen konnten, aber wie hatten sie sie gebaut?
Temi nahm sich vor, Xanthyos später danach zu fragen, wenn sie die Gelegenheit haben würde. Wenn!
Die Häuser, an denen sie vorbeitrabten, waren braun, aus gebrannten Ziegeln oder Stein. Nur hier und dort waren Gebäude weiß getüncht, die meisten waren einfach und schmucklos. Die Mauer der Veste war dagegen ganz aus weißem Stein, der an manchen Stellen schwarz angekohlt und von Wind und Wetter abgerieben und grauer war.
Das schwere eisenbeschlagene Tor der Veste öffnete sich knarrend. Die Sonne schien hinter der Stadt, als sie die Veste betraten. Doch als sich das Tor hinter ihnen schloss, wurden die Strahlen ausgesperrt. Im dämmerigen Licht erkannte Temi zunächst nichts, schnell aber gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit. Hier lagen weitere Wohnhäuser, geräumiger als die in der Stadt. Und nicht zu übersehen war der Palast, das größte und prachtvollste Gebäude im Zentrum der Veste. Exakte, stilvoll gearbeitete Reliefs und Malereien zierten seine Wände.
Mit offenem Mund ließ Temi ihren Blick über die Wände gleiten, die von tanzendem Fackellicht nur spärlich erhellt wurden. Hier jagten Kentauren und reitende Menschen mehreren Stieren hinterher. Dort wölbte sich ein gekrönter Kentaur in edler Rüstung aus dem Stein hervor. An einer anderen Wand kämpften zwei Pferdemenschen mit Schwert und Stab gegeneinander – ob aus Spaß oder erbittertem Hass konnte Temi ihren Gesichtern nicht entnehmen. Eins war klar: Die Kentauren waren ganz anders, als sie in den griechischen Sagen beschrieben wurden.
Die Wache neben ihr schien ihre Überraschung deutlich in ihrem Gesicht abzulesen. „Wir sind nicht so unzivilisiert wie die Menschen behaupten. Wir sind nicht von den Musen verlassen. Wir lieben die Kunst und schmücken unsere Wohnhäuser innen aus. Der äußere Schein trügt.“
Staunend schüttelte sie den Kopf. Und da hieß es in den Sagen, Kentauren wären grausame und rohe Burschen! Abgesehen von der ersten – ziemlich furchteinflößenden – Begegnung mit Xanthyos’ Kriegern machte sie ganz andere Erfahrungen. Allerdings hatte Xanthyos sie auch nur aus dem einen Grund verschont, dass sie aus einer anderen Welt stammte. Auf die Menschen hier wirkten die Kentauren wahrscheinlich wirklich bedrohlich, wenn die Pferdemenschen ihnen so begegneten wie Temi zuerst. Außerdem wurde in jedem Konflikt, in jedem Krieg, der Feind als schlecht, unzivilisiert, böse dargestellt. Sich selbst konnte man dann besser als Opfer oder Inbegriff der Tugend inszenieren. Als Unschuldige, denen von einem barbarischen Feind ein Konflikt aufgezwungen wurde. Ein Konflikt, der eine gewaltsame Reaktion rechtfertigte. Ein gerechter Krieg.
Und am Ende setzte sich die Sicht des Siegers durch. In ihrer Welt gab es keine Kentauren. Gab es keine Kentauren mehr? Die menschliche Sicht hatte sich ganz offensichtlich durchgesetzt.
„Das ist wunderschön!“, stieß sie hervor, als die Wache neben ihr sie neugierig ansah: Er wartete auf ihre Meinung. Sie meinte es ernst. „Etwas Vergleichbares habe ich noch nicht gesehen. Ich wünschte, ich könnte so malen“, seufzte sie leise. Der Kentaur lächelte geschmeichelt.
Kentauren waren schon lange ihr Lieblingsmotiv beim Malen, doch obgleich sie viel übte, hatte sie noch immer Probleme mit den Proportionen des Pferdekörpers und der Beine. Sie musste nachher unbedingt noch mal wiederkommen und sich das genauer ansehen!
Der Befehlshaber, der hinter Xanthyos schritt, lachte auf. „Das ist dir wohl noch nie passiert, dass ein Mensch deine Werke würdigt, oder Kehvu? Es wird dir niemand glauben!“ Temi musterte den blonden Kentauren neben ihr verblüfft. Hatte dieser Krieger die Malereien und Skulpturen geschaffen?
Sie wollte gerade nachfragen, als sie das Ende des Ganges erreichten – und damit den Thronsaal. Eigentlich war es kein richtiger Saal, eher eine Art Innenhof, von Säulengängen umgeben. Und natürlich gab es auch keinen Thron – wie sollte ein Kentaur sich auch auf einen Stuhl setzen! Aber die weiße steinerne Tafel und die prächtigen Banner an der Seite – blau mit silbernen Rändern und einem stilisierten galoppierenden Kentauren in der Mitte – erinnerte Temi an einen Thronsaal.
„Achtung! Fürst Aireion!“, verkündete eine Wache an der gegenüberliegenden Tür, bevor sie sich weiter umsehen konnte. Die Wachen hielten an und glaubten wohl, dass Xanthyos ebenfalls stoppen würde. Doch der stolze Krieger ging einfach weiter, bis schließlich zwei der Kentauren ihre Lanzen vor ihm kreuzten. Alle außer Xanthyos knickten mit ihren Vorderläufen leicht ein und beugten ihren Oberkörper nach vorne. Der Schwarzhaarige dagegen senkte nicht einmal den Kopf, richtete seinen Blick stattdessen starr, fast ein wenig arrogant auf die Tür.
Der Kentaur, der eintrat, wirkte ebenso stolz wie Xanthyos – das erkannte Temi sofort. Sein Blick lag unbewegt und streng auf seinem Gegenspieler. Xanthyos erwiderte den Blick, ohne mit der Wimper zu zucken. Wer wohl als Sieger aus diesem stummen Duell hervorgehen würde? Temi hielt den Atem an, die Wachen warteten angespannt auf ein Zeichen des Fürsten. Niemand sagte ein Wort.
Temi nutzte die Sekunden der Stille, in denen man eine Feder auf dem Boden hätte aufschlagen hören können, um den Fürsten möglichst unauffällig zu mustern. Seine Statur war der Xanthyos’ sehr ähnlich, doch anders als sein Gegenüber hatte er nicht pechschwarze, sondern schneeweiße, nein, silberne Haare. Sein Alter konnte Temi unmöglich einschätzen; graue oder silberne Haare waren normalerweise eher ein Zeichen des Alters, aber sein Gesicht war faltenlos und seine Hände, die locker an seinen Seiten herunterhingen, waren ebenso jung wie die von Xanthyos. Temi hatte keine Ahnung, wie alt Kentauren überhaupt werden konnten. In der griechischen Sagenwelt war der weise Cheiron unsterblich gewesen, bis er eine tödliche Wunde erlitten hatte und an den Sternenhimmel versetzt worden war, um sein Leiden zu beenden. Das Leben aller anderen berühmt-berüchtigten Kentauren war in Schlachten oder Zweikämpfen gewaltsam beendet worden.
Das stille Duell der beiden endete in diesem Moment – ohne Sieger. Beide Männer sahen gleichzeitig zur Seite, als ob sie es vorher verabredet hätten. Da lösten sich auch die Wachen aus ihrer Starre. Der Befehlshaber der Stadtwache stampfte an Xanthyos vorbei. Seine Augen funkelten vor Wut, doch er hatte sich vor seinem Fürsten unter Kontrolle. Ehrerbietig neigte er nochmals den Kopf vor Aireion.
„Wir haben ihn am Waldrand aufgegriffen. Er war alleine, nur das Menschenmädchen war bei ihm. Er ...“, kurz drehte er sich zu Temi um „... hielt sie fest. Deshalb konnten wir ihn noch nicht verhaften, ohne sie zu gefährden.“
„Er hat mir nichts getan, ich wollte nicht, dass ihm etwas geschieht!“, platzte es aus Temi heraus, und fügte schnell ein leises „mein Fürst“ hinzu. Wachen und Fürst sahen sie überrascht an. Zu ihrer Erleichterung war der Silberhaarige aber nicht wütend darüber, dass sie sich so respektlos einmischte. Aireion musterte sie neugierig.
„So, das wolltest du also nicht.“, wiederholte er ihre Worte nachdenklich. Vorsichtig nickte sie.
„Du wirst verstehen, dass wir deinem Wunsch nicht nachkommen können. Zwischen unserer Art und der deinen herrschen gewisse Spannungen.“ Er ließ sie nicht antworten. „Und Xanthyos ist ein Kriegstreiber. Wir können ihn nicht ziehen lassen.“
Bevor sie etwas erwidern konnte, mischte sich Xanthyos mit barscher Stimme ein. „Kriegstreiber ... Die Menschen verhalten sich seit Jahren uns gegenüber feindselig, in den letzten Monaten wurde es immer schlimmer. Du bist blind, Fürst, wenn du immer noch auf Einigung hoffst. Doch das Schlimmste ist, dass du mit dieser naiven Hoffnung das Volk blendest und in trügerischer Sicherheit wiegst!“, fuhr er den Herrscher an und um seine Worte zu unterstreichen, stampfte er mehrmals mit den Hufen auf den Boden.
Aireion ignorierte den Ausbruch vollkommen: „Wieso hast du das Mädchen gerettet, Xanthyos?“, fragte er laut. Ein paar Sekunden lang schwieg Xanthyos, wütend darüber, dass sein Vorwurf übergangen wurde. Seine Nasenflügel zitterten, als schnaubte er lautlos, und seine Kiefer mahlten aufeinander, ehe er leicht nickte. „Sie stammt nicht von hier“, antwortete er kühl. „Sie ist unschuldig.“
Er atmete tief durch und drehte sich zu ihr um. „Steig ab!“, wies er sie an. Temi gehorchte sofort. Sie rutschte von seinem Rücken. Kehvu, der blonde Künstler, zog sie auf der Stelle von ihm weg. Die anderen Wachen richteten wie auf Befehl ihre Schwerter auf Xanthyos. Der rührte keinen Muskel.
Vor Angst biss sich Temi auf die Lippen. Wollten sie Xanthyos etwa hier und jetzt umbringen? Würde er sich einfach so niederstechen lassen?
„Bringt ihn in den Kerker!“, befahl Aireion, bevor sie etwas Unüberlegtes tun konnte. „Los!“, befahl der Kommandeur der Stadtwache, aber Xanythos blieb stur stehen. Temi schwankte zwischen Bewunderung und Unverständnis über das Verhalten des schwarzhaarigen Kentauren. Nun nahm einer der Wachen eine Lanze, die wie zur Dekoration an der Wand neben ihm gestanden hatte. Doch er setzte nicht die furchterregende Spitze gegen Xanthyos ein, sondern stieß ihm den vier Meter langen Holzschaft in den Rücken. Der Schwarzhaarige blieb stehen. Am liebsten hätte Temi ihn selber angetrieben. Er wollte den König und seine Wachen provozieren, aber zu welchem Preis?
„Xanthyos“, sagte Aireion – fast sanft. „Zwing die Wachen nicht dazu, dich zu fesseln.“ Er hob eine Hand und ein Kentaur mit grauem Fell und hellbraunen Haaren betrat den Thronsaal – mit zwei Fesseln in der Hand, die wie Handschellen wirkten, nur mit einer deutlich längeren Eisenkette dazwischen. Sie waren zu breit für die Handgelenke, also mussten sie für die empfindlichen Beine sein. Eine Erniedrigung für einen sprungkräftigen Kentauren wie Xanthyos?
„So lange du nicht einsichtig bist, gibt es nur einen Weg für dich hier hinaus. Der in den Kerker.“ Ein Funken Hoffnung glimmte in seinen Augen, doch als er Xanthyos’ kühlem Blick begegnete, wich die Hoffnung der Enttäuschung.
Ob die Worte des Fürsten Ausschlag gaben oder der Kentaur mit den Fesseln, der näher kam: Xanthyos ließ sich erhobenen Hauptes mit einem letzten flüchtigen Blick auf Temi aus dem Thronsaal abführen. Als er nicht mehr zu sehen war, drehte sie sich um, um den Fürsten zu bitten, noch einmal über seine Entscheidung nachzudenken – doch Aireion stand auf einmal direkt vor ihr. Erschrocken wich sie zurück.
„Bevor du über die Ungerechtigkeit klagst, solltest du wissen, was geschehen ist“, kam der Kentaur mit den silbernen Haaren ihr zuvor. „Doch verrate mir erst, wie du heißt und wie du hierhergelangt bist.“ Aireion hatte seine Stirn nachdenklich in Falten gelegt. Jetzt erst bemerkte Temi seine ungewöhnlichen Augen: Aus der goldenen Iris stach die schwarze Pupille unheimlich hervor. Doch sie empfand keine Angst. Ihr Herz klopfte nur hastig: Wie oft wurde man schon von einem Fürsten etwas gefragt? Unwillkürlich musste sie schmunzeln. Sie war in einer Welt mit Kentauren und sie hielt einen Wortwechsel mit einem Herrscher für etwas Besonderes?
„Temi Rothe“, antwortete sie. „Ich weiß eigentlich nicht, was genau geschehen ist.“ Stockend erzählte sie Aireion, dass sie ein Buch über Mischwesen berührt hatte und dann lange gefallen und schließlich auf einer Wiese gelandet war.
Seine Ohren zuckten, als sie das Buch erwähnte, doch er sagte kein Wort, bis sie fertig war. „Xanthyos hat dich vor seinen eigenen Leuten gerettet. Ich verstehe, dass du, ein Mensch, der nie hier unter den Menschen gelebt hat, dankbar bist und dich zur Loyalität ihm gegenüber verpflichtet fühlst.“ Sie wollte protestieren, dass sie sich zu gar nichts verpflichtet fühlte, doch er fuhr schon fort: „Aber er ist eine zu große Bedrohung für unser Volk.“
Ungläubig kniff sie die Augen zusammen sie. Warum bedrohte Xanthyos sein eigenes Volk? Sein Hass richtete sich doch gegen die Menschen. „Erklärt es mir, bitte!“, bat sie ihn. Erneut nickte der König. „Ich will es versuchen.“ Er hielt kurz inne. Sein Blick glitt über die Reliefs und Wandmalereien an den Wänden des Thronsaals, ehe er anfing, zu sprechen: „Vor Jahrhunderten leben Kentauren und Menschen gemeinsam in diesen Landen. Die Menschen wohnten in den Städten; wir errichteten nur eine einzige befestigte Stadt, diese hier. Thaelessa. Denn der Großteil unseres Volkes zog es vor, in Freiheit zu leben. Unter Blättern statt unter steinernen Dächern, in der Natur statt zwischen Mauern. Wir ernährten uns von Quellwasser und frisch gejagtem Wild, anstatt Brunnen zu bauen oder Fleisch zu trocknen und zu lagern.
Deshalb glaubten die Menschen, wir seien unzivilisiert. Es war uns gleichgültig. Wir hatten wenig miteinander zu tun. Die Menschen sammelten für sich und die Ihren Reichtümer an. Es störte uns nicht. Sollten sie doch auf ihrem Land bleiben und Hab und Gut anhäufen. Uns war die Freiheit wichtiger.“
Temi nickte. Das klang eher nach friedlicher Koexistenz. Nicht nach Freundschaft, doch auch nicht nach so unbändigem Hass, wie sie ihn in den Augen von Xanthyos’ Kriegern gesehen hatte.
„Das erste Mal eskalierte die Situation, als die Menschen begonnen hatten, den Boden seiner Schätze zu berauben. Denn sie fanden einen Stein, dessen Farbe meiner Augenfarbe ähnlich war. Sie wollten ihn um jeden Preis besitzen und jagten ihm nach. Wir überließen ihnen die Ziersteine, die wir vom Boden aufgehoben hatten. Wir empfanden auch den schlichten grauen Stein als schön, vielleicht sogar als ansehnlicher als diesen goldenen.“
Innerlich seufzte Temi auf. Die Menschen hatten Blut geleckt bzw. Gold gesehen. Sie ahnte, was nun kam: Sie waren gieriger nach diesem Edelmetall geworden. „Das ist bei uns auch so ...“, sagte sie. „Den meisten Menschen geht es ums Geld. Ums Gold“, korrigierte sie sich; wahrscheinlich wussten die Kentauren nicht, was Geld war.
Aireion runzelte die Stirn. Vielleicht hatte er gedacht, ihre Welt wäre vollkommen anders. Dann nickte er leicht und fuhr fort:
„Doch irgendwann reichte ihnen nicht mehr, was sie bei sich fanden. Ohne Vorwarnung sandten sie ein Heer in unser Land und drangen in unsere Stadt ein. Wir versuchten, uns zu wehren, aber die Menschen hatten uns überrascht. Sie töteten unseren König und die Erbin seiner Krone. Unsere Vorfahren mussten fliehen, doch sie sammelten sich. Ein paar Tage später eroberten sie die Stadt zurück. Viele starben damals. Kentauren wie Menschen.“ Aireion schüttelte, sichtlich aufgewühlt, den Kopf.
„Nach dieser Schlacht waren beide Völker so entsetzt über die eigenen Verluste, dass sie einen Friedensvertrag schlossen. Diejenigen, die weiteres Töten verhindern wollten, waren lange in der Überzahl. Die Menschen hörten auf, in unserem Land nach Reichtümern zu suchen, und wir hielten uns von den Grenzen der Menschen fern. Aber unsere Beziehungen waren nicht mehr die besten. Dann gab es eine Zeit, 50 Jahre später, auf die wir hier in Thaelessa nicht stolz sind. Es kam ein König an die Macht, der mit silberner Zunge viele in eine Richtung trieb, die sie sonst nicht eingeschlagen hätten. Ilokhas marschierte gegen den Stamm der Heqassa, dessen Land am nächsten an unserem liegt. Es war Glück, müssen wir heute eingestehen, dass er in dieser ersten Schlacht fiel. Doch mit ihm leider auch ein Großteil der Jugend unseres Volkes, die seiner Silberzunge blind gefolgt waren. Die Heqassa suchten Vergeltung und erlitten fast ebenso große Verluste. Danach wurde der Friedensvertrag erneuert. Das Misstrauen war seitdem zwar groß, aber es passierte nie etwas und 500 Jahre später hielt der Friede immer noch. Es war eine gute Zeit und sie reichte bis meine Kindheit. Mein Vater half dem König der Menschen in einer schwierigen Situation, als Šadurru, die Stadt der Heqassa, von einem anderen Menschenstamm belagert wurde. Sie bekräftigten danach den Frieden, indem sie ihre ältesten Söhne als Versicherung in die Hauptstadt des anderen Volkes schickten. Doch dann gab es bei den Kentauren und bei den Menschen unerklärliche Tode, und in beiden Städten begann es bei den Bewohnern zu brodeln. Wenn sie nicht den fremden Königs- bzw. Fürstensohn selbst des Mordes verdächtigten, sahen sie in dessen Anwesenheit ein schlechtes Omen.“
Temi atmete hörbar aus. Das konnte ja nicht gutgehen. Irgendetwas musste passiert sein, das die Beziehungen ernstlich gefährdet hatte.
„Mein Vater hatte meinen älteren Bruder, Tisanthos, zu den Menschen gesandt. Der Menschenkönig hatte ihn mit aller nötigen Achtung aufgenommen. Doch konnte er ihn nicht schützen. Sie erschlugen ihn wie ein Tier, als er eines Nachts durch die Gassen wanderte, wie er es gerne tat. Der König trauerte um ihn. Mein Vater sandte den Sohn des Menschenkönigs heimlich zurück. Sonst wäre er ganz sicher aus Rache getötet worden – und er ist der einzige Erbe des Königs.
Mein Vater allerdings starb aus Gram über den Tod seines Ältesten. Ich übernahm mit 17 Jahren die Herrschaft in Thalas. Der Menschenherrscher bat mich, den Friedensvertrag zu bestätigen und ich tat es. Ich war mit seinem Sohn Imalkuš aufgewachsen. Ihn traf keine Schuld.“
Aireion sah Temi plötzlich an. Hatte der Fürst eben noch in Gedanken verweilt, war sein gerade noch abwesender Blick nun wieder äußerst klar.
„Den Friedensvertrag gibt es immer noch. Doch er ist in Gefahr. Der König war schon betagt, als mein Bruder zu ihm kam. Es gibt Gerüchte, dass er an einer Seuche erkrankt ist, die die Stadt heimgesucht hat. Selbst wenn das nicht wahr ist, muss er das Ende seiner Tage bald erreicht haben. Wie Imalkuš uns gegenüber eingestellt ist, wissen wir nicht. Nach seiner Rückkehr hatten wir keinen Kontakt mehr, und das ist nun 14 Jahre her. Wir haben ein paar Jahre unserer Kindheit miteinander verbracht, aber ob er sich an unsere Freundschaft erinnert oder ob er zu unserem Feind geworden ist ...?“ Aireion zuckte resigniert mit den Schultern. „In so vielen Jahren kann sich vieles ändern.“ Dann verfiel er in Schweigen. Temi fasste Mut: „Und wieso ist dann Xanthyos eine Bedrohung?“, fragte sie erneut.
„Er ist der Anführer der Gruppe unseres Volkes, die den Krieg für nötig hält oder aus persönlichen Gründen will. Er verwand den Tod des Prinzen nie und konnte nicht akzeptieren, dass es keine Rache gab. Seine Anhänger werden immer zahlreicher und er hat leider in einer Sache Recht: Es gibt immer mehr Übergriffe – von beiden Seiten – und jedes Haar, das gekrümmt wird, schürt den Hass zwischen unseren Völkern. Schon damals gab es auch unter den Beratern des Menschenkönigs solche, die uns feindlich gesinnt waren. Sie dürften dort ähnlichen Zuspruch erhalten wie Xanthyos hier. Es ist eine Spirale, aus der wir noch keinen Weg hinaus gefunden haben.“
„Xanthyors möchte also Krieg?“, fragte Temi. Sie hatte es eigentlich die ganze Zeit geahnt.
„Er möchte Rache. Er hält es für gerecht. Und die Schwierigkeiten an der Grenze bestärken ihn nur. Nur eine Prophezeiung hielt ihn bisher davon ab, den Krieg gegen die Menschen zu beginnen. Die Prophezeiung ist der Grund, warum er dich vor seinen Kriegern gerettet hat. Sie tauchte irgendwann während des ersten Krieges zwischen unseren Völkern auf; wer sie äußerte und wie sie sich verbreitete, können wir heute nicht mehr nachvollziehen, aber ihr Sinn ist seitdem in unseren Archiven niedergeschrieben. Ein Mensch, der die Vergeltung nährt und den Tod gezähmt hat, ohne sein finsteres Antlitz zu sehen, ein Mensch, der Kentauren liebt und doch ihr Herz in Stücke reißt, wird Gerechtigkeit bringen und dauerhaften Frieden. Den Menschen hier traut er es nicht zu. Die Fremden aber, die in den vergangenen Jahren immer wieder in unsere Welt geraten sind, versucht er zu finden und zu retten. Bislang vergeblich. Einige von ihnen starben, ob es noch mehr gab und ob sie wieder in ihre Welt zurückkehrten, weiß niemand. Ich halte es aber für wahrscheinlich, dass sie alle von kriegslüsternen Menschen oder aber von Kentauren getötet worden sind.“
Temi versuchte zu begreifen, was Aireion gerade gesagt hatte und musste fast lachen. Das waren Forderungen, die sie nicht erfüllen konnte. „Den Tod gezähmt?“, wiederholte sie. „Ich glaube, da ist Xanthyos an die Falsche geraten. Ich kann genauso sterben wie alle anderen Menschen.“ Sie schüttelte den Kopf. „Ich wünsche mir trotzdem, dass er wieder freigelassen wird.“, fügte sie dann leise hinzu.
Der Kentaur drehte sich so abrupt weg, dass seine langen Haare durch die Luft flogen. Das war dumm! schoss es Temi durch den Kopf.
„Du weißt nicht, was du verlangst. Xanthyos ist unberechenbar. Er wird den Frieden und unser Volk durch sein Verhalten gefährden.“
„Er ist nicht so unvernünftig und kriegslustig!“, behauptete Temi kühn. „Er hätte mich wohl kaum gerettet, wenn er nicht noch Hoffnung auf eine gerechte Lösung hätte.“
Aireion sah nachdenklich auf sie hinab. „Du, Menschenmädchen, meinst ihn so gut zu kennen, ja?“
Seine Stimme klang sanft, aber Temi zog ihren Kopf ein, als hätte er sie barsch angefahren. „Nein ... natürlich nicht“, gab sie kleinlaut zu und klammerte sich dann an einen Strohhalm: „Aber Ihr? Ihr hofft doch selbst, dass er nur Gerechtigkeit will und einen Krieg zu vermeiden versucht. Ihr kennt ihn doch gut.“
Kaum hatte sie zu Ende gesprochen, senkte sie den Blick. War sie wahnsinnig? Solche Forderungen zu stellen ... wie konnte sie es wagen? Sie kannte Xanthyos wie lange? Seit drei Stunden? Viele Worte hatten sie nicht gewechselt und über sich hatte er gar nichts preisgegeben. Und da maßte sie sich an, Aireion zu sagen, wie Xanthyos dachte?
Das Klappern der Hufen auf dem Steinboden ließ sie aufhorchen und aufsehen. Aireion ging weg. Hilflos sah sie dem Kentauren hinterher. Alles sprach dafür, dass Xanthyos die Menschen hasste und einen Krieg in Kauf nahm. Dennoch, ihr Gefühl sagte ihr, dass er unbedingt frei sein musste.
Als Aireion die Tür erreichte, blieb er nocheinmal stehen. Temi sah nur seinen Rücken, seinen ständig hin und her zuckenden Pferdeschwanz. Angespannt wartete sie auf seine Antwort: „Ja, ich kenne ihn gut.“ Seine Stimme war leise, aber dennoch klar verständlich. „Er ist mein Bruder.“