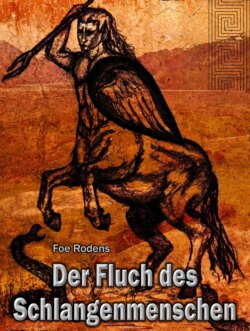Читать книгу Der Fluch des Schlangenmenschen - Foe Rodens - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Frieden in Thaelessa
ОглавлениеTemi starrte noch lange die Tür an, durch die er verschwunden war. Eigentlich hätte sie es sich denken können. Das war der Grund, warum die anderen Xanthyos mit „Majestät“ anredeten – natürlich hätte er auch ein Anwärter auf den Thron, ein Konkurrent sein können. Doch hätte ein erbitterter Rivale Aireion so respektlos ansprechen können, ohne dafür bestraft zu werden?
Und es erklärte auch, warum ihn der Tod des Fürstensohnes so getroffen hatte: Es war schließlich auch sein Bruder gewesen.
Und Aireion? Wie schwer musste es für ihn sein, dass sein eigener Bruder ihn so verachtete und für unfähig hielt? Dass er seinen Bruder in den Kerker werfen musste, um den Frieden zu bewahren, da der grimmige Rebell in Freiheit zu gefährlich war?
Temi schluckte. Der Fürst war verschwunden, ohne ihre Antwort abzuwarten, und hatte sie ihren Gedanken überlassen. Sie stand alleine im Innenhof, doch sie hatte das Gefühl, dass sie beobachtet wurde, auch wenn sie niemanden sah. Sie würde in Aireions Position nichts anderes befehlen.
Was also sollte sie nun tun? Aireion zu folgen kam nicht in Frage; er hatte sie quasi entlassen und sie hatte keine Ahnung, wo sie landen würde, wenn sie eine der Türen an den Seiten des Thronsaals öffnete.
Suchend sah sich Temi um. Erst jetzt bemerkte sie Malereien an einigen der Säulen. Neugierig trat sie näher. Das war unglaublich. In Italien hatte sie Wandbilder mit unheimlich zarten Pinselstrichen gesehen, realistisch und schön, wie die Naturszene in der Villa di Livia, und eindrucksvolle Mosaike wie das Alexandermosaik im Haus des Faun. Aber die Malerei hier war atemberaubend. Und das konnte Kehvu nicht alles alleine gemalt haben; es musste noch mehr begnadete Künstler geben.
Vorsichtig berührte sie das Bild des dunkelhaarigen jungen Kentauren in silber glänzender Rüstung. War das Xanthyos, als er noch im Palast lebte und hier mit Aireion um die Wette lief? Er auf der einen Seite der Säule, sein Bruder auf der anderen, das Ziel direkt vor ihr als Betrachter. Das Ganze wirkte durch feine Relieferhebungen räumlich. Ihr lief ein Schauer über den Rücken. Die Zeiten hatten sich geändert. Aber sie wünschte sich, die beiden wieder zusammenzubringen. Xanthyos hatte ihr das Leben gerettet. Schuldete sie ihm da nicht ihre Hilfe?
Und was war mit der Prophezeiung? Sie liebte Kentauren, wie die Prophezeiung es verlangte, aber ihr Herz in Stücke zu reißen? Einen Kentauren töten? Das würde sie nicht! Und den Tod zu zähmen? Hieß das, nicht zu sterben? Das konnte kein Mensch! Bedeutete das also, dass niemand helfen, niemand den Krieg verhindern konnte? Die Vergeltung nähren ... das klang eher so, als sollte sie das Feuer schüren als den Konflikt zu verhindern.
Plötzlich fühlte sie sich müde und mutlos und ließ ihre Schultern sinken.
Aber wer sagte, dass der Orakelspruch stimmte? Vielleicht war er auch im Laufe der Überlieferung immer weiter verändert worden. Sollte sie unabhängig davon versuchen, zu helfen? Aber wie? Sie kannte niemanden hier und viel hinderlicher: Niemand kannte sie. Warum sollte da irgendjemand auf sie hören? Andererseits: Sie liebte Kentauren. Und sie war hierhergeraten. Nicht irgendjemand, der nicht einmal wusste, was Kentauren waren, oder der sich nicht für griechische Mythen interessierte, oder dessen Lieblingsgestalten Greife waren, oder der Minotaurus. Nein, sie. Die für Kentauren schwärmte. Das war schon ein ziemlich großer Zufall.
Was konnte und sollte sie tun? Sollte sie Aireion ihre Hilfe anbieten? Konnte sie vielleicht – von Mensch zu Mensch – leichter mit dem Thronfolger der Menschen sprechen? Ihn an die Zeit erinnern, als er mit Aireion aufgewachsen war? Oder sollte sie einfach in Thaelessa warten, bis sie irgendwann wieder nach Hause kam?
Was, wenn es keinen Rückweg gab? Die anderen Menschen, die aus ihrer Welt hierhergelangt waren, waren vielleicht gestorben – war helfen der einzige Weg, um zu entkommen? Temis Puls schoss in die Höhe und ihr Atem wurde immer schneller. Sie schlang ihre Hände ineinander und presste Fingernägel in ihre Haut. Beruhig dich!, versuchte sie, sich wieder unter Kontrolle zu bringen. Du weißt nicht mal, wo du bist! Vielleicht kennen die Kentauren den Weg ja auch! Vielleicht kennen ihn die Menschen in Šadurru. Vielleicht haben die Außenweltler es einfach nicht geschafft. Oder sie haben einen einfachen Weg zurück gefunden, bevor sie den Kentauren überhaupt begegnet sind!
Langsam ließ das Zittern ihrer Hände nach und sie nahm sich vor, diese Fragen gleich als Erstes zu klären, sobald sie einen Kentauren sah.
Das Geräusch klappernder Hufen ließ sie aufblicken. Kehvu trat ein. Er trug keine Rüstung mehr; sein Oberkörper war nackt, nur ein weit ausgreifender Umhang wurde vor seinen Schultern mit einer Fibel zusammengehalten und bedeckte einen Teil seiner Oberarme und fast seinen ganzen Pferderücken. Es war wohl mehr Dekoration als wärmendes Kleidungsstück. Temi vermied es, den muskulösen Oberkörper länger als einen Augenblick anzusehen. Falls er ihren Blick bemerkt hatte, ließ er es sich nicht anmerken. „Sie gefallen dir?“, fragte er leise. Temi blinzelte verwirrt. Was meinte er? Ach ja, die Säulen. „Sehr!“, gab sie zurück und fügte bewundernd hinzu. „Sie sind wirklich wunderschön.“
Ein leises Lächeln breitete sich auf dem Gesicht des blonden Kentauren aus. Doch es verschwand wieder, als er sah, dass ihre Mimik ernst wurde. „Könnt Ihr mir sagen, wo ich bin? Also ich weiß inzwischen“, stotterte sie, „dass euer Land Thalas heißt ... aber um wieder nach Hause zu kommen ... muss ich vielleicht wissen, wo Thalas überhaupt liegt.“
Kehvu sah sie nachdenklich an. Durfte er ihr das sagen? Andererseits konnte es kein großes Geheimnis sein; die Menschen, die hier lebten, wussten es schließlich auch genau.
„Komm“, sagte er, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Er ging nicht in die Richtung, aus der sie gekommen war. Das Tor der Veste musste irgendwo rechts von ihnen liegen. Temi versuchte, die Orientierung zu behalten, als sie neben ihm hereilte – obwohl er langsam ging, musste sie fast laufen. „Du musst mich übrigens nicht mit ‚Ihr‘ anreden“, sagte Kehvu lächelnd. „Ich bin nur ein einfacher Soldat. Ich bin Kehvu“, sagte er und streckte ihr im Gehen die Hand entgegen, mit der Handfläche nach oben. Als er die Hand nicht zurückzog, streckte sie ihren Arm und legte zaghaft ihre Hand auf seine. Er ergriff ihr Handgelenk, drückte es kurz und ließ sie dann wieder los.
„Ich bin Temi.“
Kehvu blickte wieder nach vorne. Der Gang, in dem sie waren, war dunkel, nur von Fackeln beleuchtet, die den ganzen Flur erhitzten. Der Boden war bedeckt mit festgetretener Erde. Hatten die Kentauren einfach Erde aufgeschüttet und Mauern darum gebaut? Der Gang führte steil nach oben. Auf glattem Stein hätten die Kentauren wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt haben, nicht zu rutschen. Die Erde aber war zwar festgedrückt, gab aber genug nach, damit die Pferdebeine sicheren Halt fanden.
Doch, einen Steingrund musste es geben, überlegte Temi. Sie bewegten sich in einer Spirale nach oben, wie auf einer Wendeltreppe. Nur dass es eben eine steile Rampe war.
Drei Mal mussten sie um die Innenachse herumgegangen sein, als Kehvu plötzlich anhielt und sich umdrehte. Der Gang war gerade breit genug, dass Kehvu zwischen den zwei Wänden stehen konnte, ohne sich verrenken zu müssen. Aber vor Kehvu lag gar keine Wand mehr, sondern eine Holztür, die in derselben Farbe und mit demselben Muster bemalt wie die Steine. Sie verschmolz regelrecht mit der Wand.
Bevor Temi darüber nachdenken konnte, was hinter einer so geheimnisvoll versteckten Tür liegen mochte, öffnete Kehvu sie. Das erste, was Temi sah, waren Fenster. Es überraschte sie; eine Veste sollte doch uneinnehmbar sein. Kentauren mochten hier nicht hochklettern können, Menschen allerdings schon.
Kehvu machte eine einladende Handbewegung und ohne zu zögern ging Temi hinein. Ihr Herz schlug schneller. Er konnte jetzt einfach die Tür zumachen und sie wäre hier gefangen. Sie trat ans Fenster. Es war definitiv zu hoch, um herunterzuspringen. Aber ihre vage Befürchtung blieb unbegründet.
Es war draußen mittlerweile fast dunkel und das Zimmer nicht viel heller als der Gang. Kehvu hatte eine Fackel von der Wand draußen genommen und kam nun damit herein. Er ging zu einem Becken, hielt die Fackel daran und einen Herzschlag später schossen Flammen fast einen Meter in die Höhe. Kehvu zuckte nicht einmal, während Temi zusammenfuhr. Dasselbe wiederholte er auf der anderen Seite. Nun war der Raum in ein rot glühendes Licht getaucht.
Temi sah sich um. Zwei Fensteröffnungen gab es, beide etwa zwei mal zwei Meter groß. Es stand eine massige Holzkiste an der Wand auf der anderen Seite des Zimmers und daneben ein runder Tisch, auf dem sich mehrere Figuren befanden. Es erinnerte sie an ein Schachspiel, nur mit deutlich weniger Figuren.
An der langen Wand, die den Fenstern gegenüberlag, befand sich ein riesiges Gemälde. Es begann direkt hinter der Tür und bedeckte die gesamte Wand.
Jetzt verstand Temi, wieso Kehvu sie hierhergebracht hatte: Es war eine Karte. Etwa eine Elle von den Rändern entfernt, zierten breite blaue Ranken das ansonsten beige- oder ockerfarbene Bild – im Fackellicht war es nicht ganz zu erkennen. Zwischen den Ranken und dem Rand waren kleine Figuren zu sehen: Kentauren, in verschiedenen Schlachtformationen. Menschen, die auf einem Hügel vor einer Stadt standen und den Kentauren entgegenstürmten. Hatte Kehvu deshalb gezögert, ihr das Bild zu zeigen?
Kehvu zeigte jetzt mit einer Hand auf eine Stelle auf der Karte. Auf eine befestigte Stadt mit hellen Mauern, braunen Häusern im Inneren und einer weißen Veste. Temi musste nicht nachfragen, um zu erkennen, dass das Thaelessa war. Die Stadt lag in der unteren Hälfte des Gemäldes, umgeben von mehreren Waldflächen; nur nach Norden hin schloss sich eine baumlose Ebene an. Hinter dem Wald links folgte ein Gebirge. Entweder war es so hoch, dass es gut und gerne an den Himalaya heranreichen musste, oder die Maßstäbe waren nicht so groß, wie Temi gehofft hatte. Es konnte natürlich auch sein, dass die Berge in Wahrheit flacher waren, dass sie nur für den Effekt auf dem Gemälde so hoch aussahen, so wie die Stadt wohl gegenüber den Wäldern auch größer gemalt war, damit sie auf der Karte nicht unterging.
Xanthyos und sie mussten aus dem Süden oder Osten an Thaelessa herangeritten sein. Sie konnte sich nicht daran erinnern, in der Ferne ein Gebirge gesehen zu haben, als sie sich der Stadt genähert hatten – aber das wollte nichts heißen. Sie hatte wahrlich auf anderes geachtet als auf den Horizont.
Etwa zwei Armlängen über der Stadtzeichnung war ein Strich, der – leicht kurvig – von Ost nach West reichte, bis er vor einer von Gebirgsgipfeln umgebenen Ebene abrupt aufhörte. Ein Fluss? Es gab noch mehr schlängelnde Linien, aber keine so dick wie diese. Vielleicht die Grenze des Landes? Um die Farben zu erkennen, reichte das Licht nicht aus.
„Das ist Thalas“, sagte Kehvu und fuhr mit der Hand über die untere Hälfte der Karte, bis zu dem dickeren Strich heran. Also war es wohl wirklich eine Grenze. „Hier beginnt Hešara, das Land der Menschen. Es gibt verschiedene Menschenstämme, aber nur eines ihrer Reiche grenzt an Thalas. Das der Heqassa. Dort liegt ihre Hauptstadt, Šadurru. Drei Tagesläufe von Thaelessa entfernt.“
Es war noch eine andere befestigte Stadt auf der Karte zu sehen, und darauf wies Kehvu jetzt. Drei Tagesritte! Das war weniger, als Temi gedacht hätte. Das bedeutete, das Gebirge im Westen war nicht weit entfernt, und die Karte endete zwei Tagesritte weiter im Süden. Weiter im Osten gab es ein größeres Gewässer, ob ein See oder ein Meer konnte man nicht erkennen: Die Karte endete dort mit Ranken am Rand.
„Hilft dir das weiter?“, fragte Kehvu. Temi unterdrückte ein Seufzen. Nicht wirklich. „Wer wohnt denn dann weiter im Süden?“
„Niemand“, antwortete Kehvu sofort. „Einige aus unserem Volk haben sich ein paar Tagesritte südlich von Thaelessa niedergelassen, aber niemand wohnt weiter weg als in 10 Tagesritten zu erreichen. Dahinter ... gehört das Land niemandem. Wir könnten es wohl beanspruchen, aber wofür? So viele sind wir nicht. Wir schicken regelmäßig Späher gen Süden, um zu erkunden, ob das Land immer noch unbewohnt ist. 50 Tage sind sie in verschiedene südliche Regionen gelaufen und sind niemandem begegnet.“
Deshalb lohnte es wohl auch nicht, eine weitere Karte anzufertigen.
„Und die anderen Himmelsrichtungen?“, fragte Temi. Sie versuchte, nicht ernüchtert oder frustriert, sondern neugierig zu klingen. „Das Gebirge im Westen und das Meer im Osten sind unüberwindbar. Und im Norden ... ja, da leben einige andere Menschenstämme. Weshalb ...“, begann er, schüttelte dann aber den Kopf. „Schon gut. Natürlich willst du wissen, welche Stämme deines Volkes hier leben. Vielleicht ist ja sogar deiner dabei.“ Das bezweifelte sie, aber sie sagte nichts.
Kehvu ging zu der Kiste, öffnete sie und holte eine dünne Lederrolle heraus. Mit geübten Händen entrollte er sie. Es war ein Pergament, auf dem etwas geschrieben stand. Mit dem Kopf bedeutete Kehvu ihr, näherzukommen. Er legte das Pergament auf die Kiste. Das Fackellicht war hier nicht mehr stark genug, daher entzündete er noch eine dritte Feuerstelle, in der Ecke direkt neben der Kiste. Auf dem Pergament war ebenfalls eine Karte zu sehen. Temi erkannte sofort das Gebirge und das Meer an den Rändern wieder. Der Zeichner der Karte hatte die Bergspitzen im Westen einfach unendlich weitergezeichnet. Ob das auch so war, würde sie wohl nicht herausfinden. Was konnte das für ein Gebirge sein? Das Zagros-Gebirge? Der Kaukasus?
„Wie heißt das Gebirge?“, fragte sie.
„Enessu.“
Na das ist hilfreich, dachte Temi bitter. Das klang nicht mal annähernd nach einem der beiden Gebirge in der (näheren und weiteren) Umgebung Griechenlands.
Sie sah sich die Karte genauer an. Die beiden Städte fand sie dann auch schnell wieder; diesmal ging die Landschaft aber gen Norden weiter. Dort waren den Grenzstrichen nach zu urteilen fünf, nein sechs weitere Länder eingezeichnet. Zwei davon grenzten an Hešara, allerdings getrennt durch ein Gebirge. Alles in allem lagen die beiden Reiche Hešara und Thalas recht isoliert.
Diese Karte war, im Gegensatz zu der großen an der Wand, mit Schrift versehen – die sie aber nicht lesen konnte. „Wie heißen diese Länder?“, fragte sie Kehvu und war mehr als dankbar für seine Geduld.
„Das ist Šur, das Land der Suraju“, sagte er und wies auf das Land im Nordosten Hešaras. „Und daneben Paras, das Reich der Paršava.“
Temi kniff die Augen zusammen. Diese Namen klangen vertraut. Mehr als das. Es waren leichte Abwandlungen von Völkernamen aus ihrer Welt. Aus der Vergangenheit ihrer Welt. Paras war der aramäische Name Persiens, Paršava war dem Wort Parθava, dem altpersischen Wort für die Parther, ähnlich, ein antikes Volk im heutigen Iran.
Und wenn sie sich in dieser Region der Erde befanden, dann fehlte vor dem anderen Länder- und Volksnamen nur ein „Aš-“, und schon hatte man die Assyrer bzw. ihre Stadt Aššur. Wenn das eine zufällige Ähnlichkeit war, dann wollte sie nichts mehr mit Antike zu tun haben.
Natürlich war es das nicht. Die Frage war: Befand sie sich in der Vergangenheit oder – was die wilde Mischung der Namensvariation (und vielleicht auch die Existenz der Kentauren) nahelegte – in einer seltsamen parallelen Welt?
„Hier, in Kaarun wohnt ein Volk, das sich Kharaala nennt. Das Land daneben ist Masoor, dann Kumen, Palkhonna und das ganz schmale Land im Norden ist Thuile.“ Temi hatte bei den weiteren Namen schon die Schultern hängen lassen – kein einziger davon klang auch nur ein bisschen vertraut. Erst den letzten konnte sie wieder einordnen. Auch wenn das kein bisschen half, denn die „Insel Thule“ war eine Insel, die der griechische Entdecker Pytheas beschrieben hatte – nur leider existierte sie nicht. Es war ein mythischer Ort, kein realer. Und sie konnte sich nicht darauf verlassen, dass sie es wirklich mit Persern und Assyrern zu tun haben würde – wenn sie denen überhaupt begegnete. Das war wohl, wenn sie Kehvu richtig verstand, eher unwahrscheinlich.
Sie suchte die Karte ab nach irgendeinem Hinweis. War das alles? Im Norden von Thuile schloss sich erneut ein Gebirge an und damit endete auch diese Karte und für die Kentauren offenbar ihre Welt.
„Danke“, sagte sie schließlich, als das Schweigen schon allzu lang dauerte. Jetzt konnte sie nicht mehr verhindern, dass sie unglücklich klang. Was bedeutete das für ihren Rückweg? Vielleicht, dass du aufhören musst, nach einer logischen Lösung zu suchen!, schalt sie sich selbst. Du bist beim Berühren eines Buches hierhergefallen, Himmeldonnerwetter noch mal! Hatte sie da erwartet, zu Fuß nach Trier zurückkehren zu können?
„Du wirst sicher einen Weg finden“, sagte Kehvu, als hätte er ihre Gedanken gelesen – aber dieses Mal war es wohl nicht allzu schwer. Sie zwang sich zu einem Lächeln. Kehvu konnte nichts dafür und er hatte recht. Sie war ja gerade erst angekommen. Es würde einen Weg geben, sie musste ihn nur finden. Wenn sie aus einem Grund hierhergekommen war, dann musste sie diesen Grund – ihre Aufgabe oder was immer – vielleicht einfach nur erfüllen und dann gelangte sie zurück nach Hause.
Das brachte sie zu dem Problem zurück. Sie nickte leicht, mehr um sich selbst zu sortieren, als um Kehvu zu antworten. Aber der sah es als Zeichen, dass er ein anderes Thema ansprechen konnte: „Fürst Aireion bittet dich um eine Entscheidung. Soll Xanthyos sein Gefangener bleiben oder frei sein.“ Stumm starrte Temi Kehvu an. Der Fürst überließ tatsächlich ihr die Entscheidung? Warum? Hatte es mit der Prophezeiung zu tun? Wie sollte sich entscheiden? Sie musste Zeit gewinnen.
„Darf ich noch mal mit Xanthyos sprechen, bevor ich mich entscheide?“
„Du hast Zeit. Es ist spät und du musst müde sein.“
Wie auf Befehl gähnte sie. Sie hatte es in den letzten Minuten verdrängt, aber der Adrenalinschub, der sie durch diesen unglaublichen Tag gebracht hatte, ließ nun deutlich nach. Draußen war es stockdunkel. Durch die Flammen im Zimmer konnte sie nicht einmal erkennen, ob der Mond schien oder viele Meter unter ihnen in der Stadt Fackeln die Straßen erleuchteten oder nicht. Es war einfach pechschwarz. Sie gähnte noch einmal. „Jetzt, wo du es sagst?!“, scherzte sie dann und Kehvu schmunzelte.
„Ich bringe dich auf dein Zimmer.“
Hatten sie hier Betten? Kentauren legten sich ja wohl nicht wie Menschen hin.
Kehvu legte seine Hand in ihren Rücken, um sie in die richtige Richtung zu lenken, zog sie dann aber so rasch wieder zurück, als hätte er etwas Unrechtes getan. Temi lächelte ihn aufmunternd an. Es hatte sie nicht gestört.
Kehvu errötete und drehte sich schnell um. Dabei verrutschte der Umhang von seinen Schultern, sodass er jetzt fast ganz auf seiner rechten Seite herunterhing. Temi betrachtete verstohlen den Übergang zwischen Mensch und Pferd, als sie hinter ihm herging. Dass die Natur so etwas hervorgebracht hatte! Stoppeliges Pferdehaar wurde zu sichtlich weicherem Flaum und dann zu menschlicher Haut, ohne übermäßige Behaarung.
Jetzt war sie es, die rot wurde, aber er sah es glücklicherweise nicht. Für den Rest des Weges – es ging weiter die Rampe aufwärts – betrachtete sie den Boden und achtete darauf, dass sie nicht in Kehvu hineinlief. Dennoch passierte genau das beinah, als er plötzlich anhielt.
Sie standen vor einer Treppe mit einigen steilen Stufen, zu schmal als dass ein Kentaur leicht hinaufkäme.
„Verzeih, wenn es dort oben staubig ist. Wir betreten das Zimmer nur selten und ungern.“ Wie auch. Zumindest konnte es nicht einfach sein.
„In diesem Zimmer haben die Botschafter der Menschen genächtigt, als wir uns noch gegenseitig Botschafter gesandt haben, und dann der junge Prinz, Imalkuš. Du wirst Kleidung darin finden, die dir vielleicht passt. Sie wäre für den jungen Prinzen gewesen, wenn er länger in der Stadt geblieben wäre.“
Temi nickte. Sie war aufgeregt. Wie wohl die Kleidung eines menschlichen Prinzen hier im Land aussah? Die Kleidung des Kentaurenkönigs war nicht besonders prunkvoll, daher konnte sie wohl nichts allzu Wertvolles erwarten. Aber außergewöhnlich war es für sie allemal!
„Ich hoffe, du kannst dich ein wenig erholen. Es wird gleich noch jemand kommen und dir Essen an die Treppe bringen. Falls du noch etwas brauchst ...“ Kehvu schien einen Moment überlegen zu müssen, was dann war. „Dann musst du leider bis ganz runter gehen. Die Wachen der Veste sind zwar informiert, dass ein Außenwelter in der Stadt ist, aber ich weiß nicht, wie sie reagieren, wenn du in ihre Privatgemächer tappst.“
Temi prustete los und Kehvu lachte leise. „Am Thronsaal sind aber immer Wachen. Und dort unten kannst du dich auch erfrischen. Ich fürchte, heute Nacht nur mit kaltem Wasser.“ Temi nickte und ihre Wangen wurden erneut rot. Hauptsache, dort gab es dann auch soetwas wie eine Toilette, auch wenn Kehvu es nicht extra erwähnte.
„Danke. Schlaf gut!“, sagte sie dann.
Er nickte ihr zu. „Du auch!“
Damit reichte er ihr die Fackel, die er in der Hand hatte, und nahm selbst eine andere von der Wand.
Rasch stieg sie die Treppe hinauf. Die schwere Tür dort ließ sich nicht leicht öffnen. Erst als sie ihr ganzes Körpergewicht dagegendrückte, ging sie knarrend auf. Wie in dem Raum mit der Karte gab es vier hohe Behälter, mit Öl vermutlich. Mit weit ausgestrecktem Arm hielt sie die Fackel an die Schale und Flammen schossen in die Höhe. Zweimal wiederholte sie das und dann war das Zimmer in flackerndes Licht getaucht. Auf dem Boden neben Feuerschalen lagen deckelähnliche Gegenstände, jeweils mit einem einen halben Meter langen Stab, damit man zum Löschen des Feuers nicht zu nah herangehen musste.
Temi steckte die Fackel in eine Halterung an der Wand und sah sich um. Natürlich gab es ein Bett im Zimmer der Botschafter! Auch einen offenen Schrank und an der Wand mehrere einzelne Regalbretter, die aber allesamt leer waren. Die Möbel waren eingestaubt, aber wenigstens sah sie keine Spinnen im Zimmer. Im Schrank hingen Kleider. Neugierig begann Temi, die Kleidung zu inspizieren. Bis auf ein bisschen Staub waren sie sauber und rochen frisch. Es waren mehrere Sets aus Hosen, Hemd und Umhang. Sie entschied sich für einen Umhang, der im roten Licht grün aussah, ein Velourlederhemd und eine dünne und bequeme Hose und legte alles auf das unterste, am wenigsten eingestaubte Regalbrett.
Sie sah sich im Zimmer um und musste schmunzeln. Das Fenster war zu hoch, um einen Blick nach draußen zu werfen. Ein Konstruktionsfehler wohl: Es war nicht für menschliche Botschafter ausgelegt, sondern für die größeren Kentauren. Und sie mit ihren 1,66 Meter war erst recht zu klein. Temi rückte einen Stuhl an die Wand und kletterte dann hinauf.
In der Zimmermitte hatte sie keine Geräusche gehört – das war ungewohnt! In Trier lag ihre Wohnung zwar auch nach hinten raus, sodass es nachts immer leise war, aber so gar nichts zu hören, war seltsam. Direkt am Fenster hörte sie ein Tier schreien, vielleicht einen Fuchs oder Schakal. Aber keine menschlichen bzw. Kentaurenstimmen.
Sie sah hinaus – und sah in der Ferne, die weißen Spitzen eingetaucht in Mondlicht, das Gebirge. Genauergesagt sah sie, egal ob sie sich eher nach links oder nach rechts aus dem Fenster lehnte, nichts als Berge. Der Karte nach musste ein Wald zwischen der Stadt und dem Gebirge liegen. Deshalb hatte sie sie wohl von unterhalb der Stadtmauern nicht bemerkt.
Dann sah Temi direkt nach unten und fuhr unwillkürlich zurück. Sie war nicht schwindelfrei und das war ihr definitiv zu hoch.
Bei dem kurzen Blick hatte sie kleine Fackeln zwischen den Häusern lodern sehen, aber genauer wollte sie sich das nicht angucken – oder konnte es nicht, ohne dass ihr schwindelig werden würde.
Vielleicht hatte sie ja morgen noch Gelegenheit, sich die Stadt genauer anzusehen. Sie hoffte es – wann konnte man schon mal eine Kentaurenstadt besichtigen?
Am nächsten Morgen schreckte Temi hoch und saß senkrecht im Bett. Das hier war nicht ihr Bett, nicht ihr Zimmer. Nicht ihre Welt. Es war kein Traum gewesen. Ihr Herz raste und sie sprang aus dem Bett. Sie hatte gut geschlafen, kein bisschen unruhig. Aber sie hatte keine Ahnung wie lange? Wie spät war es? Draußen war es hell, aber das war kein Anhaltspunkt. Selbst in Deutschland war es im Sommer um 5 Uhr morgens schon hell. Sie wünschte, ihre Uhr ginge, oder dass sie ihr Handy hätte – nicht dass das hier Empfang gehabt hätte. So musste sie eben versuchen, sich an der Natur zu orientieren. Zurück zu den Wurzeln.
Sie stellte sich auf den Stuhl und sah nach draußen. Die Sonne schien ihr mitten ins Gesicht, stand aber noch relativ niedrig, ganz dicht über dem Gebirge. Temi blinzelte und ihre Augen fingen an zu tränen. Das Gebirge erstreckte sich, soweit das Auge reichte. Kein Wunder, dass die Zeichner der Karte dachten, dass dies der Rand der Welt wäre. Die höchsten Gipfel waren schneebedeckt, dazwischen mussten unzählige Täler und Pässe liegen – aber wenn das Eis selbst im Sommer nicht schmolz, war es vielleicht tatsächlich unmöglich, es bis zur anderen Seite zu schaffen. Oder es war tatsächlich der „Rand“ dieser Welt. Glaubten die Kentauren, dass die Erde flach war?
Temi warf einen vorsichtigen Blick nach unten und zog ihren Kopf gleich wieder zurück – das Zimmer lag wirklich sehr hoch oben! Unten in der Stadt waren die Sonnenstrahlen noch nicht angekommen. Der Wald, der zwischen Thaelessa und dem Gebirge lag, wirkte dunkel und bedrohlich, ein harscher Kontrast zu den hellgrünen Wiesen und dem glänzenden Schnee in den Bergen. Die Bäume wuchsen auch auf den Berghängen hinauf, doch ab einer gewissen Höhe waren die Hänge grau und kahl. Es schien, als hätte jemand jenseits dieser Linie alle Bäume gefällt.
Fasziniert betrachtete Temi die Landschaft. Sie konnte nicht einschätzen, wie weit das Gebirge entfernt war, wie groß der dunkle Wald zwischen ihnen und der Stadt war. Die Berge erschienen so massig und endlos. Kehvu hatte gesagt, es waren zwei Tagesritte, aber wie weit konnte ein Kentaur an einem Tag laufen?
„Temi?“
Sie fuhr herum, als sie Kehvus leise Stimme durch die Tür hörte. Sie stieg vom Stuhl und wollte zur Tür rennen, als sie sich erinnerte, dass sie sich vielleicht besser anziehen sollte – ein bisschen mehr als ein T-Shirt und eine Unterhose sollte sie schon tragen. Temi wurde rot. „Ich komme sofort!“, rief sie durch die geschlossene Tür und zog schnell die Kleidung an, die sie in der Nacht im Dunkeln rausgesucht hatte. Der Umhang war in der Tat grün, wenn auch ein bisschen heller, als sie gedacht hatte. Die Hose war weinrot, nicht schwarz oder dunkelbraun. Auch gut!
Als sie an sich herab sah, staunte sie über die Veränderung. So passte sie in diese Welt; sie sah aus, wie sie sich die Menschen in früheren Zeiten vorgestellt hatte. Jetzt war sie eine von ihnen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Was war das nur für ein Abenteuer!
Sie ging zur Tür und merkte jetzt erst, wie kalt der Steinboden unter ihren nackten Füßen war. Richtig, sie hatte ihre Schuhe ausgezogen, sobald sie ihre Wohnung betreten hatte – und sie sich natürlich nicht wieder angezogen, als der Schlangenmensch sie attackiert hatte. Ob es hier in der Stadt auch Schuhe gab? Ein Extra-Paar für den Menschenprinzen, irgendwo in der Veste?
Sie schob den Gedanken beiseite und ging die schmale Treppe hinunter, bis sie Kehvu sah, genau dort, wo er sie gestern zurückgelassen hatte. Als er sie aus den Augenwinkeln sah, drehte er sich zu ihr herum und betrachtete sie von oben bis unten mit großen Augen. „Ich habe fast vergessen, wie menschliche Kleidung aussieht“, sagte er dann erstaunt, vor allem mit Blick auf die Hose. Temi sagte nichts, sondern schmunzelte nur. Natürlich trugen Kentauren keine Hosen – aber sie hatte das Bild prompt vor ihrem geistigen Auge.
„Sie steht dir“, sagte er dann. „Ich war mir nicht sicher, wie lang ihr Menschen schlaft und ob du schon wach bist. Der junge Prinz und die Gesandten sind immer erst sehr spät aus dem Zimmer gekommen.“
„Kommt ganz drauf an“, erwiderte Temi.
„Also nicht anders als bei uns“, sagte Kehvu. „Komm. Es gibt unten etwas zu essen und dann können wir zum Kerker gehen.“
Temis gute Laune schwand bei diesem Wort und ihr schlechtes Gewissen meldete sich prompt. Hätte sie doch darauf bestehen müssen, dass Xanthyos sofort freigelassen wurde? Jetzt hatte er die Nacht im Kerker verbringen müssen, während sie hier oben hervorragend geschlafen und danach in aller Ruhe den Blick über die Landschaft genossen hatte.
Sie schüttelte den Kopf. „Können wir zuerst zu Xanthyos gehen?“, fragte sie. Kehvu blickte sie nachdenklich von der Seite an. „In Ordnung“, sagte er, nicht mehr ganz so gut gelaunt. Es schien ihm nicht zu gefallen, dass sie Xanthyos mochte. Niemandem hier schien es zu gefallen. Machte sie einen Fehler, wenn sie darum bat, ihn freizulassen?
Der Thronsaal war bis auf zwei Wachen leer. Die Sonne schien hier noch nicht herein, dafür stand sie noch lange nicht hoch genug. Kehvu blieb nicht stehen. Sie gingen an den Wachen vorbei, die sich ebenso neugierig zu ihr umdrehten, wie Temi sie im Vorbeigehen musterte. Aber sie sahen zu imposant aus, um mit einem kurzen Blick alles zu erfassen, und Temi blieb stehen, um sich jedes Detail im Gedächtnis einzubrennen. Die Wachen hatten lange Lanzen in der Hand, ähnlich wie die Krieger, die gestern im Torbogen gestanden hatten. Aber das war nicht das beeindruckendste: Sie waren von Kopf bis Huf gepanzert. Ihre Helme hatten eine ähnliche Form wie phrygische Helme – doch daran angebracht waren aufwendig ziselierte, bronzene Flügelformen. Sie waren zur Seite gerichtet und nach vorne gekrümmt. Das war sicher nichts für die Schlacht, aber eindrucksvoller hätte der Anblick kaum sein können. Von den Schultern abwärts waren die Arme ebenfalls in bronzene Rüstung in Flügelform eingehüllt, je einen für die Oberarme und einen für die Unterarme. Die Körperrüstung bestand aus zwei Teilen: einem Brustpanzer, der den Brustkorb schützte und dann abrupt in etwa pflaumengroße Schuppen überging. Die Schuppenrüstung lief vor dem Rumpf auf Höhe der Beine spitz zu, hinten bedeckte sie dagegen den ganzen Pferdekörper bis zum Bauch. Alle vier Beine waren von geschwungenen Beinschützern bedeckt.
„Temi?“
Kehvus Stimme riss sie aus ihrer Verblüffung. Sie hatte die beiden Wächter, ein Mann und eine Frau unverhohlen angestarrt, und die beiden starrten zurück. „Entschuldigung ... Entschuldigung!“ stammelte sie hastig und lief zu Kehvu, der bereits einige Schritte weiter im Gang stand.
Er setzte sich wieder in Bewegung, aber sie sah wohl, dass er immer wieder den Kopf zu ihr drehte. Irgendwann sprach er die Frage laut aus, die ihm auf der Zunge brannte: „Was fandest du denn gerade so spannend?“
„Die Rüstung“, platzte es aus ihr heraus. „Einfach nur wunderschön! Ich wünschte, ich hätte ein Foto machen können!“ Sie vergaß vor Aufregung, dass Kehvu kaum wissen konnte, was ein Foto war, aber ihn erstaunte etwas ganz anderes so sehr, dass er nicht danach fragte: „Du interessierst dich für Rüstungen?“
„Für antike Waffen und Rüstungen, ja. Und Fantasyrüstungen- äh ... Rüstungen und Waffen, die zum Beispiel für Filme ... nein, also die danach geschaffen wurden ... ugh!“ Sie stockte. Wie zum Teufel sollte sie Kehvu dieses Konzept erklären? Filme, Fantasyfilme, Schwerter, die extra für Filmproduktionen kreiert wurden ... Hier gab es Rüstungen nur zu einem Zweck: Zum Schutz im Kampf. Dasselbe galt für Waffen.
„Vergiss es. Ich meine alte Waffen und Rüstungen, die von unseren Vorfahren getragen wurden. Nicht mehr in meiner Zeit.“
„Ah!“ Kehvus Gesicht hellte sich auf. Vielleicht lag es auch an dem grellen Tageslicht, in das sie traten, sobald sie den düsteren Eingang zur Veste durchquert hatten. Sie mussten sich jetzt auf dem Weg befinden, auf dem Xanthyos und sie gestern hereingekommen waren. Wie ewig das schon her zu sein schien!
„So etwas haben wir auch“, sagte Kehvu. „Einige Waffen wurden zusammen mit ihren Besitzern begraben, andere nutzen wir noch heute. Und andere befinden sich sicher noch im Besitz der Familien hier, auch wenn sie niemand mehr benutzen würde, nur noch im Notfall. Ich habe ein Messer zu Hause, das von einem meiner Ur-Ur-Urahnen getragen wurde, mit einer wunderschönen Scheide aus Zedernholz. Es ist ein schönes Erinnerungsstück, wenn auch mit einer sonderbaren Form.“
„Genau das meine ich!“, sagte sie, erleichtert, dass sie um diese unmögliche Erklärung herumkam – auch wenn seine Interpretation nicht so ganz zutraf.
Er schüttelte den Kopf. „Aber ich hätte nicht gedacht, dass sich eine Menschenfrau für so etwas interessiert.“
Sie wollte gerade protestieren, als Kehvu stehenblieb und nach links zeigte. Dort lag am Ende der Nebenstraße ein kleines Gebäude. Sie vergaß ihren Protest und runzelte die Stirn. Diese Hütte konnte nicht größer sein als ein Raum, zumindest nicht für Kentauren. Das sollte der ganze Kerker sein? Es standen auch keine Wachen davor.
Doch der Eindruck täuschte: Das Häuschen war nur der Eingang zu einem Gang, der unter die Erde führte! Erst als sie den Gang betrat, merkte Temi, wie warm es draußen schon war: Hier unten war es spürbar kühler und das Licht der Fackeln nur spärlich.
Der Gang führte etwa zwei Meter unter die Erde und endete dann in einem Raum, der für Kentauren recht schmal war: Es konnten sich wohl gerade zwei Kentauren gegenüberstellen, ohne mit den Hinterläufen die Wand zu berühren. Er war allerdings recht lang und alle paar Meter gab es zur Linken eine Tür. Zwischen den Türen an der Wand gab es Halter für Fackeln, doch nur an der hintersten loderte das Feuer. Entsprechend dunkel war es, und erst auf den zweiten Blick aus den Augenwinkeln bemerkte Temi die beiden Kentauren, die reglos in den Ecken standen. Sie hatten beide dunkles Fell und dunkle Umhänge über den Schultern. Sie sagten nichts, als Kehvu mit ihr bis zu der beleuchteten Zellentür ging. Es entging Temi nicht, dass sie mit mehreren Speeren an der Wand und zwei Schwertern an der Seite ein ganzes Arsenal von Waffen zur Hand hatten – sollte es einem Gefangenen mal gelingen, die Kerkertür zu öffnen.
„Du solltest nicht zu nah an die Tür gehen“, riss Kehvu sie aus den Gedanken und wies mit dem Kopf auf die massive Holztür, die teilweise mit Eisen beschlagen war. Sie war eingelassen in eine Steinmauer und die Angeln sahen stabil genug aus, um der Kraft eines massigen Pferdekörpers zu widerstehen. Auf Augenhöhe für Kentauren befand sich ein kleines Fenster mit drei fast handgelenkbreiten Eisenstäben. Nichts, was eine noch so starke Hand verbiegen konnte. Es gab natürlich keinen Stuhl und keine Kiste hier und sie konnte Kehvu schlecht bitten, sie auf seinen Rücken zu lassen, deshalb stellte sich Temi einen guten Meter vor die Tür und rief Xanthyos‘ Namen. Einen Moment lang herrschte Stille, dann klapperten Hufe über den Steinboden und der schwarzhaarige Kentaur tauchte am Fenster auf.
„Hallo Menschenmädchen“, sagte er halb spöttisch, halb überrascht. Er hatte wohl nicht damit gerechnet, sie zu sehen. Nachdenklich blickte er sie an. „Was machst du hier?“, fragte er sie dann. „Hat mein Bruder dir aufgetragen, mich auszufragen?“
„Nein!“, antwortete Temi sofort. „Er hat mir die Entscheidung überlassen, ob du im Kerker bleiben sollst oder nicht.“ Es war ihr rausgerutscht, bevor sie darüber nachdenken konnte, ob es klug war oder nicht, es ihm zu erzählen. Wenn sie sich gegen seine Freilassung entschied, würde er sie hassen, wenn sie sich dafür entschied ... wer wusste schon, was er dann von ihr denken würde.
Xanthyos Augen wurden größer. Damit hatte er offensichtlich nicht gerechnet. „Dann glaubt mein Bruderherz also auch an die Prophezeiung.“
„Er glaubt, dass du daran glaubst.“
Xanthyos lächelte finster, aber dann wurde seine Miene wieder ernst. „Dann werden sie dich also in die Stadt der Menschen schicken ...“
„Ich glaube nicht, dass man mich irgendwohin schickt. Aber vielleicht ist das mein Weg nach Hause. Zu helfen, so gut ich kann. Und wenn es dazu nötig ist, dass ich in die Menschenstadt gehe, dann will ich das versuchen!“
Xanthyos rümpfte die Nase und schnaubte. „Wenn es zum Krieg kommt, haben die Menschen keine Chance. Dann solltest du nicht in der Stadt sein.“
Temi erschauderte. Das glaubte sie auch – aber noch herrschte kein Krieg. „Willst du wirklich Krieg? In dem auch hunderte Kentauren sterben können? Willst du Rache? Oder doch lieber Gerechtigkeit?“ Xanthyos biss sich auf die Lippen und scharrte nervös mit den Hufen.
„Der Fürst hat dir also vom Tod unseres Bruders erzählt?“, fragte er verärgert. Temi nickte. Er hatte ihr die Frage nicht beantwortet. Sie bemerkte, dass Kehvu auch unruhig mit den Hufen auf dem Steinboden scharrte. Nein, Xanthyos antwortete ihr nicht, aber das änderte nichts an diesem Gefühl, dieser Ahnung, wie auch immer man es nennen wollte, dass er nicht hier im Kerker verrotten durfte. Hoffentlich war es nicht nur das schlechte Gewissen, das sie zu dieser Entscheidung drängte. Sie konnte es einfach nicht mitansehen, wie der stolze Kentaur eingesperrt blieb. Und wenn sie ehrlich war, war ihre Entscheidung schon gestern gefallen. Entschlossen drehte sie sich zu Kehvu um. „Ich möchte, dass er freigelassen wird“, sagte sie leise. Kehvu ließ seine Schultern sinken und wandte sich ab. Er hatte ganz offensichtlich auf eine andere Entscheidung gehofft. Aber der Fürst hatte ihr die Entscheidung überlassen, also war es an ihr, nicht an Kehvu. Sie hoffte nur, dass sie das Richtige tat.
Kehvu nickte. Die Wächter zögerten und erst als Kehvu befahl: „Tut was sie sagt!“, traten sie aus dem Schatten und öffneten sie die Tür.
Xanthyos blieb einen Moment in der Zelle stehen und schritt dann ganz langsam aus seinem Verlies, ohne den Blick von ihr zu lassen – als wären die drei anderen Pferdemenschen Luft. „Ich muss zugeben, du überraschst mich“, sagte er fast sanft und blickte dann den Gang entlang, an dessen Ende man das Tageslicht nur erahnen konnte. „Das schaffen nicht viele. Erst recht nicht Menschen.“
Temi runzelte die Stirn und sah ihn sorgenvoll an: „Du bist frei. Kannst du deine Krieger noch eine Weile zurückhalten? Gib mir eine Chance.“
Welcher Teufel ritt sie? Sie konnte die Prophezeiung nicht erfüllen. Sie hatte auch keine Ideen. Dennoch. Konnte sie tatenlos zusehen, während sie ohnehin nicht nach Hause konnte? Sie atmete tief durch und gab sich selbst die Antwort darauf: NEIN!
Wenn sie sich irgendwo in vorantiker Zeit befanden, dann war eines sicher, was auch immer passierte: Die Menschen würden den Krieg überstehen. Die Kentauren nicht. Aber wenigstens wollte sie versuchen, zu verhindern, dass die Kentauren ausgerottet wurden.
„Ich werde zu den Menschen gehen. Wenn sie euch für barbarisch und unzivilisiert halten, werde ich ihnen die Wahrheit erzählen.“
Unwirsch schnaubte Xanthyos und trat einen Schritt auf sie zu „Menschen verstehen so etwas nicht!“
„Und was bin ich?“
„Keine von ihnen!“
Fest sah der Kentaur auf sie hinab. Sie hielt dem Blick nur mit Mühe stand.
„Ich habe keine Hoffnung, dass der Konflikt anders als durch einen Krieg gelöst werden kann. Dennoch danke ich dir für deine Entscheidung – ich habe nicht damit gerechnet.“ Ein Lächeln flackerte über sein Gesicht, doch es verschwand auch genauso rasch wieder, wie es gekommen war. Dann gab er sich einen Ruck und trabte los. Die Wächter wichen automatisch zurück. Niemand hielt ihn auf, nur einer der beiden Wächter folgte ihm, vielleicht um den König zu informieren oder um sicherzugehen, dass Xanthyos auf dem Weg aus der Stadt nicht aufgehalten wurde. Oder dass er keine Schwierigkeiten machte.
Schweigend blickte Temi ihm nach, bis er aus ihrem Blickfeld verschwunden und das Klappern seiner Hufen verklungen war. Sie hoffte nur, sie hatte nicht die falsche Wahl getroffen. Unsicher drehte sie sich zu Kehvu. Der lächelte sie wider Erwarten an. „Du hast ein großes Herz, Menschenmädchen. Aber es könnte dir schaden. Du bist in einen Krieg hineingeraten.“ Er sah besorgt auf sie hinab, legte eine Hand auf ihre Schulter. „Komm, ich werde dir die Stadt zeigen.“
Schnell nickte Temi und schüttelte ihre Bedenken für den Moment ab. Diese Chance wollte sie sich nicht entgehen lassen. Außerdem gewann sie ein bisschen Zeit, nachzudenken, bevor sie wieder mit Aireion sprach. Als sie aber die lange Rampe von den Kerkern hinaus ins Licht stieg, wartete dort eine Gestalt mit silbernem Haar. Der König trug ein dunkles Diadem auf der Stirn und flößte noch mehr Respekt ein als bei ihrer ersten Begegnung. Vielleicht war es aber auch nur ihr zum Teil schlechtes Gewissen, das sie innerlich zittern ließ.
Aireion sah nicht finster, sondern freundlich auf sie herab, als sie vor ihm anhielt und kurz den Kopf senkte. „Du hast meinen Bruder beeindruckt. Ich konnte die Verwunderung in seinen Augen lesen“, sagte er. „Was willst du nun tun?“, fragte er sie dann.
„Lasst Ihr mich zu den Menschen gehen und mit ihnen sprechen?“ Der Kentaur schüttelte sanft den Kopf. „Es wäre dein Tod. Hier bei uns bist du sicherer.“
Unsicher sah sie ihn an. Sie hatte gedacht, dass er sie nur zu gerne zu den Menschen schicken würde, um vielleicht zwei Probleme auf einen Schlag loszuwerden. Ein eigensinniges Menschenmädchen in seiner Stadt und, wenn sie Erfolg hatte, die Gefahr des Krieges mit den Menschen. „Aber wie soll es dann weitergehen?“, fragte sie nach. „Ich kann es doch wenigstens versuchen!“
Erneut schüttelte Aireion den Kopf. „Nur ein Mensch, der den Tod gezähmt hat, kann hier helfen. Deine Hilfsbereitschaft und Tapferkeit in allen Ehren. Aber wenn Blut vergossen wird, sollte es nicht deines sein.“ Es war sein letztes Wort. Er drehte sich um und schritt wieder zum Palast zurück. Temi blieb mit Kehvu zurück. Sie spürte schon wieder diesen Kloß in ihrem Hals. Ratlos sah sie Aireion hinterher.
„Soll ich dir die Stadt zeigen?“, fragte Kehvu, in einem Versuch, sie aufzumuntern. Hin- und hergerissen nickte sie. Sie wollte Aireion hinterherlaufen und ihn überzeugen, aber sie konnte die Prophezeiung nicht erfüllen, also war nicht sie gemeint. Und Kehvu schien sich wirklich zu freuen. Seine Augen funkelten.
Er wies ihr den Weg und langsam schlenderten sie durch die Straßen in Richtung Tor. Sie benutzten aber nicht die Hauptwege, sondern nur Seitengassen im Wohngebiet. Temi bemerkte, dass fast alle Türen offen standen. Die meisten Kentaurenfamilien hielten sich draußen auf: Kehvu erklärte ihr, dass die Stadtmauern im Süden einen Wald mit einschlossen. Viele Pferdemenschen nutzten dieses Stück Natur in ihrer Stadt, um dort zu essen oder sich einfach zu entspannen.
Neugierig warf Temi einen Blick in das nächste offenstehende Haus. Es stimmte, was Kehvu bereits gesagt hatte: Außen war es unscheinbar, innen eher karg möbliert und es gab offensichtlich kaum Wertgegenstände. Aber es war schmuckvoll bemalt. Was für Künstler waren hier am Werk gewesen!
Sie pfiff leise vor Bewunderung. Es wirkte perfekt. Nicht so wie bei ihr. Sie wollte immer alles perfekt machen, aber sie war in den wenigsten Fällen ganz zufrieden. Ein Anflug von Neid überkam sie, aber es gelang ihr, das Gefühl zu verscheuchen. Kehvu merkte nichts davon. Er blickte nach vorne. Dort kreuzte eine Gruppe von Kriegern ihren Weg, teils Männer, teils Frauen. Alle trugen die gleichen Rüstungen; ihre menschlichen Oberkörper waren mit Eisenpanzern gerüstet, ihre Pferdeleiber mit Kettengeflechten.
Kehvu und Temi ließen die Soldaten passieren, die mit wachsamem Blick und die Querstraße entlangtrabten. Ein Kentaur lief voran und es folgten drei mal drei Krieger. Das war offenbar die gängige Größe für Wacheinheiten, denn als sie weitergingen, begegneten sie an der nächsten Kreuzung einer anderen Einheit, ebenfalls 10 Krieger stark.
Bei dem rothaarigen Kommandanten dieser Gruppe war irgendetwas anders. Etwas unterschied ihn von Kehvu und Xanthyos und Aireion. Temi brauchte ein paar Sekunden, und die Wachen waren schon an ihr vorbei, als es ihr auffiel: Er hatte Pferdeohren! War er der Einzige? Bisher hatte sie keinen anderen mit solchen Ohren gesehen – oder es einfach nicht wahrgenommen. Sie musste jetzt darauf achten! Wirklich hüpften bald zwei braunhaarige Kentaurenkinder mit Pferdeohren über ihren Weg. Die Kinder hielten erschrocken inne, als sie Temi bemerkten und stoben auseinander, so schnell, dass sie fast über ihre eigenen staksigen Beine stolperten. Als Temi einen rot-braun-haarigen Kentauren in einer Wacheinheit sah, dessen Ohren deutlich größer waren und spitz zuliefen, wandte sie sich an Kehvu, sobald die Gruppe außer Hörweite war: „Wieso haben einige von euch Pferdeohren, andere menschliche?“, fragte sie den Kentauren an ihrer Seite. „Und gibt es einen Zusammenhang zwischen den Ohren und eurer Haar- und Fellfarbe?“ Kehvu drehte ihr seinen Kopf zu. „Du beobachtest gut“, stellte er fest. „Sicher hat König Aireion dir von unserer Vergangenheit erzählt. Sonst wüsstest du nichts von unserem Krie... Konflikt mit den Menschen.“ Temi nickte nur. Den Versprecher hatte sie wohl gehört. Kehvu versuchte, es herunterzuspielen ... aus Rücksicht auf sie, dessen war sie sich sicher.
„Nachdem sie lange in den Wäldern gelebt hatten, errichteten unsere Vorfahren vor vielen Jahrhunderten diese Stadt. Einige zogen dann in die steinernen Bauten ein. Die anderen entschieden sich für die Rückkehr in die Wälder, als der Bau abgeschlossen war, weil sie merkten, dass sie es an einem Ort mit so vielen anderen nicht lange aushielten. Am Anfang muss es in Stadt und Wald etwa gleich viele Pferde- und Menschenohrige gegeben haben und auch die Fellfarben variierten beliebig.“
Kehvu folgte mit seinem Blick einem Halbwüchsigen mit hellgrauem Fell und menschlichen Ohren, der ihn beinah angerempelt hätte, weil er ganz unverhohlen Temi angestarrt hatte.
„Im Lauf der Jahrhunderte dominierten dann im Wald die braunen Farbtöne. Diejenigen mit hellerem Fell fühlten sich in der Natur nicht mehr wohl, da sie schon von weitem sichtbar waren. Sie zogen in die Stadt. Hier haben sich alle Fellfarben weitervererbt, im Wald hauptsächlich die braunen und roten. Im Wald hatten die Kentauren mit den Pferdeohren eine bessere Chance ... sie hören besser als wir. Sie konnten besser jagen und bemerkten schneller die großen Raubtiere, die es damals noch in unseren Wäldern gab. Und über die Jahre hinweg wurde die Trennung dann einfach immer deutlicher.“ Kehvu stockte kurz und ein Schatten flog über sein Gesicht. „Bis zum Ersten Krieg gegen die Menschen. Da flohen die Stadtbewohner in die Wälder und sie und die Waldbewohner kamen einander wieder näher. Nach dem Krieg folgten viele Waldbewohner ihren Freunden und Partnern in die Stadt.“
Das klang sehr logisch. Jahrhundertelange Entwicklung ließ sich nicht in ein paar Generationen wieder rückgängig machen. Außerdem gab es offenbar „Mischlinge“, bei denen Fell- und Haarfarbe verschieden waren.
„Nimm Ardesh als Beispiel.“ Temi überlegte. Wer war Ardesh? Kehvu beantwortete ihre unausgesprochene Frage prompt: „Der rothaarige Kommandant, den wir eben gesehen haben. Er gehört zu den Beratern des Königs. Seine Vorfahren eroberten im Ersten Krieg gemeinsam mit den Stadtbewohnern unsere Stadt zurück und blieben hier. Dennoch sieht er aus wie ein typischer Waldbewohner.“
„Du sagst ‚der Erste Krieg’“, hakte Temi nach. „Aireion erzählte mir nur von einem.“
Kehvu seufzte leise. Er fing so zögernd an – als hätte er ein schlechtes Gewissen.
„Nun ... Nein, es gab keinen weiteren Krieg.“, antwortete er stockend. „Aber – ich zweifle nicht an deinem Herzen, an deinem Mut und guten Willen – aber ... selbst wenn Aireion dich zu den Menschen gehen lässt: Die Chance, dass du die Berater des Königs dort zur Vernunft bringen kannst und dass Xanthyos so lange seine Krieger zurückhält, ist meiner Meinung nach äußerst gering. Wir stehen so kurz vor einem Krieg. Ich fürchte, er lässt sich nicht verhindern. Nicht von dir und nicht vom Herrn des Todes selbst.“
Temi nickte. Sie verstand gut, dass Kehvu nicht daran glaubte, dass sie etwas ausrichten konnte. Sie glaubte es ja selbst nicht. Doch das erinnerte sie an den Spruch, den jemand an die Außenwände der Universitätsbibliothek gesprüht hatte: „Du hast keine Chance, also nutze sie.“ Genau das wollte sie tun.
Die beiden Kentaurenkinder mit dem braunen Fell trauten sich wieder in ihre Nähe und als sie merkten, dass der Mensch sie nicht plötzlich anfiel, vergaßen sie ihre Furcht sofort. Lachend liefen sie ein paar Meter vor ihnen her. Der Übergang zum menschlichen Körper war bei ihnen noch nicht so verwachsen wie bei den Erwachsenen. Bei den jungen Kentauren gingen Haut und Fell ziemlich abrupt ineinander über. Temi musste bei dem Anblick fast lachen.
Der Junge und das Mädchen maßen spielerisch ihre Kräfte, indem sie versuchten, sich gegenseitig wegzuschieben. Keiner von beiden wich von der Stelle, bis das Mädchen plötzlich zur Seite sprang. Der Junge verlor den Halt und stolperte, mit den Armen rudernd, nach vorne und taumelte genau gegen Kehvus Beine. Der schnaubte über diese ungewollte „Attacke“, während Temi sich ein Grinsen verkniff.
Plötzlich drückte etwas Flauschiges gegen Temis Schienbein. Sie sah nach unten und bemerkte zu ihrem Erstaunen den kleinen schwarzen Kater, der verschwunden war, als auf der Wiese Xanthyos‘ Kentauren nähergekommen waren. Es schien mittlerweile Tage her. Sie hob das maunzende Kätzchen auf und strich ihm über den kleinen Kopf. Der Kater schnurrte ununterbrochen.
„Was ist das?“, fragte Kehvu so perplex, dass Temi irritiert war. Kannte man diese Tiere hier etwa nicht? „Eine Katze“, erwiderte sie unsicher.
Der Kentaur schüttelte amüsiert den Kopf. „Das weiß ich!“, sagte er. „Es ist die einzige Katze hier in Thaelessa. Ein seltsames Tier“, fuhr er fort und zog seine Augenbrauen zusammen. „Ich habe noch nie gesehen, dass es sich von jemandem anfassen lässt.“ Er streckte seine Hand aus, aber da legte der kleine Kater seine Ohren nach hinten, rollte sich zu einer fluffigen Fellkugel zusammen und fauchte. Kehvu lachte und zog seinen Arm zurück.
Sofort entspannte sich der Kater wieder und schnurrte weiter. Temi schmunzelte und gab ihm einen Kuss auf den Kopf. „Tja, Thanatos hat halt einen guten Geschmack.“
„Was hast du gesagt?!“, entfuhr es Kehvu. Er starrte sie mit großen Augen an. Temi wich bei dieser unerwartet heftigen Reaktion einen Schritt zurück. „Ich ... ich wollte dich nicht beleidigen. Ich habe nur–“ Kehvu schüttelte energisch den Kopf. „Das meine ich nicht. Komm, wir müssen zurück zu Aireion.“
Temi verstand diesen plötzlichen Sinneswandel des bisher eher sanftmütigen Künstlers nicht. Aber Kehvu hatte es auf einmal sehr eilig. „Steig auf!“
Kaum saß sie auf seinem Rücken, rannte er los, als wäre eine Horde Menschen hinter ihm her. Thanatos krallte sich auf ihren Schultern fest. Temi hatte Mühe, ihr Gleichgewicht zu halten. „Dieser Kater hat sich noch nie von jemandem streicheln lassen“, rief Kehvu erneut über seine Schultern, während er durch die Stadt galoppierte.
„Aus dem Weg!“, warnte er zwei Kentauren, die in ein Gespräch vertieft auf der Straße standen. Temi befürchtete, dass sie jeden Augenblick mit jemandem zusammenstoßen würden, aber der Kentaur wich allen im letzten Moment aus. Erst vor dem Tor der Veste wurde er langsamer. Die Wachen hatten ihre Lanzen gekreuzt, aber als sie Kehvu erkannten, ließen sie ihn passieren. Im Trab lief Kehvu durch das Tor, in den Gang hinein, durch den Thronsaal und geradewegs zu einer versilberten Tür, vor der zwei weitere gut gepanzerte Wachen standen.
„Wir müssen mit König Aireion sprechen!“, drängte er die Krieger. Die beiden reagierten nicht, sondern blickten einfach an ihnen vorbei. Temi drehte sich um. Dort stand Aireion.
Auch Kehvu war dem Blick der Wachen gefolgt, wandte sich rasch um und verneigte sich. „Mein König, ich dachte, das solltet Ihr sehen!“ Doch der silberhaarige Fürst hatte die Katze bereits auf Temis Arm bemerkt. Er kniff seine Augen zusammen und sah zurück zu dem blonden Kentauren. „Mein lieber Kehvu, es ist zwar erstaunlich, dass sich das Tier von dem Menschenmädchen halten lässt, aber ob das die Aufregung wert ist ...“
„Fragt sie, wie er heißt.“
„Die Katze hat einen Namen?“, fragte Aireion zurück.
„In meiner Welt geben wir unseren Tieren oft Namen. Haustieren eigentlich immer. Ich bin dem Kater gestern schon begegnet und ich kann ihn schließlich nicht ‚Katze‘ nennen, wenn ich mit ihm spreche.“
„Du sprichst mit der Katze?“, fragte Aireion, nicht weniger verwirrt. Zu Temis Erstaunen scharrte Kehvu ungeduldig mit den Hufen. „Sie hat ihn Thanatos genannt“, platzte es aus ihm heraus.
Aireions Kopf ruckte nach oben und einen Moment lang starrte er Kehvu an. Dann den Kater an und dann wieder Temi. „Wie hast du ihn besänftigt?“, fragte er – und seine Stimme zitterte.
„Ich ... eh ...“, stotterte Temi verwirrt. „Ich habe ihn gar nicht ‚besänftigt‘, er ist einfach zu mir gekommen.“
„Thanatos“, flüsterte Aireion, in Gedanken versunken. „Der Herr des Todes ...“ Temi runzelte die Stirn. Jetzt verstand sie gar nichts mehr. Oder doch! Sie hatte den Kater nach dem griechischen Gott des Todes benannt, ein Name, der offenbar auch den Kentauren geläufig war. Und der die Prophezeiung plötzlich so greifbar machte. War es Zufall oder ein Zeichen? Konnte die Prophezeiung im übertragenen Sinne erfüllt werden? Sie hatte den Tod gezähmt!?
Das war doch zu einfach! Oder?
Temi überlegte. Als der Lyderkönig Kroisos das Orakel von Delphi befragt hatte, um sich den Ausgang seines geplanten Kriegszugs gegen die Perser weissagen zu lassen, hatte das Orakel geantwortet: „Wenn du den Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören.“ Kroisos hatte den Spruch ganz in seinem Sinne verstanden, das Persische Reich angegriffen – und letztlich sein eigenes Reich zerstört. Es war geradezu typisch für Prophezeiungen: Sie konnten, mussten oder durften nicht so ausgelegt werden, wie es im ersten Moment den Anschein hatte.
Doch was war mit den anderen Forderungen der Prophezeiung. Ein Mensch, der die Vergeltung nährte? Vielleicht bedeutete es nicht, dass sie den Wunsch nach Vergeltung förderte, sondern im wörtlichen Sinne nährte. Ernährte. Ihr Herz setzte einen Schlag aus. Nemesis. Ihre kleine süße rotfellige Katze, der sie den Namen der Göttin der ausgleichenden, strafenden Gerechtigkeit gegeben hatte. Der vergeltenden Gerechtigkeit.
Temi sah auf. Aireions Augen schienen fast zu leuchten. Diese Wendung beeindruckte ihn, aber noch kämpfte er gegen seine Aufregung an. Sie versuchte, ihre eigene zu verbergen. „Es gibt da noch etwas, was Ihr wissen solltet“, begann sie zögernd und erzählte ihm von ihrer Katze in Trier. Kehvu sah sie ungläubig an und aus Aireions Blick schwanden die Zweifel. „Erlaubt Ihr jetzt, dass ich es versuche, Majestät?“, fragte sie ihn, und fürchtete sich gleichermaßen vor der Antwort, wie sie sie erhoffte.
Doch Aireion zögerte noch immer. „Es ist eine gefährliche Aufgabe, Temi Rothe. Viele wollen den Krieg.“
Sie klang sicherer als sie sich fühlte, als sie ihre Frage wiederholte: „Lasst Ihr mich gehen?“