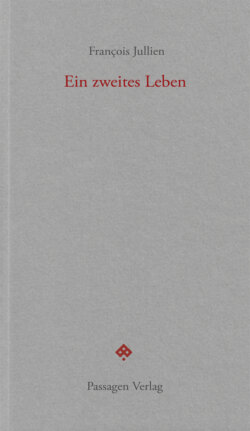Читать книгу Ein zweites Leben - Francois Jullien - Страница 10
II. Geklärte Wahrheiten
ОглавлениеIch habe die Verwandlung, die geräuschlos vor sich geht und von der man nicht spricht – Stille auf beiden Seiten –, die stille Verwandlung genannt. Da sie umfassend und kontinuierlich ist, hebt sie sich vom Lauf unseres Lebens nicht ausreichend ab, als dass man sie sogleich bemerken würde. Dann, nachdem sie sich unaufhörlich weiter verzweigt und verfestigt, beginnt diese Verwandlung, wie eine Schaumspur eines Tages sichtbar zu werden: Endlich kommt ein Ergebnis zum Durchbruch, das unsere Aufmerksamkeit einfordert. Und dieses Hervortreten ist sogar umso geräuschvoller, als wir seine Entwicklung zuvor nicht wahrgenommen haben. Nun geschieht das Hervortreten eines zweiten Lebens aus dem Leben selbst auf folgende Art: Ausgehend vom winzig Kleinen, das sich ansammelt, vollzieht sich eine Biegung, die uns allmählich von dem wegführt, was dann rückblickend, mit gegebenem Abstand, als ein „erstes“ Leben erscheint. Man muss also diesen zweiten Aufbruch im Leben als Gegenteil eines plötzlichen Einbruchs denken und als Gegenteil all dessen, was das Prozesshafte der Erfahrung stören würde: Durch unterirdische Verschiebungen, die sich ohne unser Wissen vollziehen, beginnt eine Neuorientierung, durch stumme Neigung, die der Aufmerksamkeit und folglich dem Willen entgeht. Dann (aber), wenn sie sich hinreichend bestätigt hat, kommen – ausgehend von all den kleinen Verschiebungen, die durch gegenseitige Verstärkung ins Bewusstsein dringen – Entschluss und Verantwortung des Subjekts ins Spiel. Eine „Reform“ des Lebens kann beginnen.
Es handelt sich streng genommen also weder um eine Häutung noch um eine Mutation: Häutung ist zu kontinuierlich organisch, während Mutation die Immanenz dieser Entfaltung durchbrechen würde. Reifung (der ihre Bekundung auf den Fersen folgt: das berühmte „er ist reifer geworden“) gibt ebenso wenig Rechenschaft von dem, was eben innerhalb dieses Prozesshaften zwar nicht gebrochen ist, doch Risse bekommen und damit ein neues Mögliches ausgelöst hat, das zu diesem Kippen führte. Das zweite Leben hält durch Implikation Einzug in das erste, während zugleich ein Freiraum erkennbar wird (entsiegelt wird), der sich davon ablöst. Tatsächlich wird ein Freiraum nur soweit verwirklicht, als man sich nach und nach aus den zugemuteten, zugleich gegebenen und erduldeten, Bedingungen heraushebt und sich „draußen hält“ – das ist es, was ich „ex-istieren“ nennen werde.
Denn einerseits offenbart im Lauf der Jahre die Kohärenz, nach der sich mein Leben voreilig zu entwickeln begann, auf die ich mich blind tastend, ohne ausreichend darüber entscheiden zu können, eingelassen habe, von selbst ihre Grenzen und verlangt folglich nach ihrer Überwindung. Eine „primäre“ Logik, die man vielleicht die Logik des Drangs und der Eroberung nennen kann, des Ehrgeizes und der Besitznahme, das heißt auch der zur Schau getragenen Leistung, die nach Anerkennung heischt: sich der Welt aufdrängen und einen Platz darin erringen. Andererseits ist doch ein zweites Leben, sich einem Neuanfang annähernd, nur möglich, wenn sich das Subjekt die Gesamtheit seiner Nicht-Übereinstimmungen mit diesem ersten Leben, in das es ohne ausreichenden Abstand und Orientierung, um von sich aus entscheiden zu können, „eingetreten“ ist, zunutze macht und die Fähigkeit erlangt – eine im eigentlichen Sinne ethische Fähigkeit –, sich davon abzukoppeln, und zwar durch kleine, sukzessive Verschiebungen, bis es das beiseitelegen kann, was es solcherart „stützte“. Bis es sich endlich davon „loslösen“ kann: Die Konsequenz daraus, dass es sich von den Anhaftungen des ersten Lebens freimacht, ist eine Initiative. Auf diese Weise geht eine zweite Wahl des Lebens – oder sagen wir: die Wahl eines zweiten Lebens – vonstatten, die sich, progressiv wie sie eben ist, zur ersten effektiven Wahl entwickelt. Die „Freiheit“ ist tatsächlich keine primäre Gegebenheit, wie es die Metaphysik gerne wollte, wobei sie die Welt entzweite und die Erfahrung zerbrach; sondern sie ist im Gegenteil ein durch Abwendung vom aufgezwungenen Primären vollzogener sekundärer Erwerb, ein Aufstieg des Subjekts, durch den eben es sich erst zum „Subjekt“ befördert.
Denn entweder verschließt man seine Augen vor dem, was sich an diesem ersten Leben erschöpft hat, das seine vom Schein verdeckte Nichtigkeit enthüllt und daher nach seiner Überwindung verlangt. Solange das Bannsiegel seiner ersten Ziele, das heißt der von der Welt vorbestimmten Ziele des hastigen Drangs, noch nicht gebrochen ist, kommt also die Wirkung (Bemühung) des Bewusstseins nicht zum Tragen, die es erlaubt, sich von ihnen zu lösen: Sie verfestigen sich im Gegenteil zur Anhaftung und zur Fixierung. Das Leben gräbt sich tiefer in seine Spurrille, ein festgefahrenes Leben. Oder aber man beginnt – da sich durch Reflexion des vergangenen Lebens (über dieses Leben: das aus dem Abstand geborene „über“) Bewusstsein angesammelt hat, wobei diese, wie man sagt, Bewusstseins-„ergreifung“ sich erst im Ablassen von den zuvor eingegangen Abhängigkeiten bestätigt –, diese Scheidung vom ersten Leben zu akzeptieren, das aus Bedürfnis und Befangenheit geboren und damit weitgehend aufgezwungen war: Man fängt an, wie es heißt, „Bilanz zu ziehen“, überprüft und korrigiert immer entschlossener seine früheren Verpflichtungen, revidiert seine Investitionen und „reformiert“ sein Leben. Eine Wiederaufnahme des Lebens, die kein Alter hat, eine Reform, mit der alles beginnen kann. Eben hiermit beginnt sich eine Initiative abzuzeichnen; wirklicher Manövrierraum – also Spielraum für eine Wahl – kann daraus resultieren; tatsächliche Freiheit kann entstehen: Indem es sich von der Beschränktheit des ersten Lebens abkoppelt, also auch die Solidarität mit seiner Welt hinter sich lässt, kann ein Subjekt, das sich aus der Geschlossenheit des Ich befreit, zum Vorschein kommen. Es behauptet sich also als ex-sistierendes Subjekt. Tatsächlich ist die erste Frage, die ich mir einem anderen gegenüber stelle, nicht im eigentlichen Sinn moralisch, sondern lautet vielmehr: Hat er ein zweites Leben begonnen? Ist er dabei (bereit), einen Zugang zu ihm zu finden? Und wie kann ich ihn andernfalls zu dieser Erfahrung hinleiten, da sie sich doch nicht direkt kommunizieren lässt?
Denn warum würde man länger leben wollen, wenn nicht, um Zugang zu diesem zweiten Leben zu finden? Außer vielleicht aus einem bloß negativen Grund (den Tod hinauszuschieben?) – doch das physische Leben beginnt so rasch zu welken! Es geht, besser gesagt, nicht nur darum, Zugang zu diesem zweiten Leben zu finden, indem man einen zweiten Anfang setzt, sondern auch darum, darin fortzuschreiten. Denn sobald man einmal begonnen hat, in der Feinzeichnung, indem man sie vom Raster oder Grundstoff des Lebens unterscheidet und entwirrt, wahrzunehmen, dass das Leben überhaupt nicht so ist, wie man es uns beigebracht hat; wenn, mit anderen Worten, das Leben selbst in seinem Verlauf einen anderen Entwurf offenbart als den öffentlich bekannt gemachten; wenn wir folglich begonnen haben, im Laufe der Zeit die Beschränktheit des Lebens, die sich hinter den Lehren der Moral und Erziehung verbarg (und vor allem das Bedürfnis nach Macht und Anerkennung und den ewigen Kampf innerhalb mehr oder weniger verschleierter Kräfteverhältnisse, sogar in der „Liebe“), zu durchschauen und zu erkennen – dann erscheint endlich eine Alternative, eine tatsächliche Wahl zeichnet sich ab. Meine ersten „Entscheidungen“ waren sichtlich zu sehr geführt, um Entscheidungen gewesen zu sein. Und wenn sich hier nun endlich eine Wahl abzeichnet (als Möglichkeit einer Initiative, Behauptung eines Subjekts), dann liegt das nicht an einem Selbstbestimmungsvermögen des Willens, der sich ad hoc entscheidet, man weiß nicht wie, plötzlich, das heißt metaphysisch, wie man es sich allgemein vorgestellt hat: auf eine, um die Wahrheit zu sagen, schrecklich abstrakte und theatralische Weise. Sondern vielmehr daran, dass ich mich allmählich losgemacht habe, begonnen habe, Abstand zu gewinnen, um abzuwägen und zu vergleichen, und sich daraus die Möglichkeit zur Wahl ergeben hat. Daher bleibt diese Wahl graduell, offenbart eine solche Alternative sich langsam und stellt sich niemals als Wegkreuzung dar – wie es, allzu bequem, die Moral gern gehabt hätte – oder sonst in einer Weise, die bereits resultativ ist.
Ist das dann nicht tatsächlich jene Alternative, die nicht aus der Moral, sondern aus dem Leben hervorgegangen ist; nicht verordnet wurde, sondern sich ergeben hat: die effektiv – das bedeutet auch schrittweise – eine Schwelle bilden würde, wobei sie die Existenzen absondert? Entweder ich beteilige mich an dem, was ich nach und nach vom Leben selbst entdecke und was keineswegs dem ähnelt, was man mir beigebracht hat (oder vorgab, mir beizubringen) – es ist „nicht gut“ zu lügen und zu schmeicheln, zu drängeln und zu intrigieren usw. –, das heißt, ich spiele mein Spiel mit (in) diesem gesellschaftlichen Schein (die kühle Lektion, die Vautrin Rastignac erteilte), um mir, indem ich mich diesem Gesetz der Notwendigkeit füge, meinen Weg zu bahnen und „durchzukommen“ – das hässliche Verb dieses Realismus. Aber gibt es dabei wirklich eine Wahl? Ich folge nur mehr oder weniger bewusst – geschickt – dem gewöhnlichen, primären Gesetz des Interesses. Oder ich beginne, auf meine früheren Entscheidungen zurückzukommen, die nicht wirklich Entscheidungen waren, löse mich nach und nach von meinen vorherigen Investitionen und sortiere erstmals aus. Denn eine tatsächliche Wahl kann nur in prozesshafter Weise selektiv sein, entgegen der allzu abgeflachten, ausgebreiteten Vorstellung einer „Wegkreuzung“, die ich erwähnte, das heißt, zu einem großen Teil bereits retrospektiv. Ich ziehe mich also nicht aus der Welt zurück (vom „Bösen“: Bequemlichkeit des Religiösen, die nur ein Asketismus der Umkehrung ist). Sondern ich beginne, mein Leben abhängig von diesen Wahrheiten, die nicht kodifiziert sind, sondern sich durch das Leben selbst geklärt haben und langsam aus ihm hervorgetreten sind, neu auszurichten: Wahrheiten, die niemals gelehrt wurden und auch kaum zu lehren sind, die vielmehr nur erhellt werden können, wozu die Literatur, im Unterschied zur Philosophie, dient – der Gewissensroman (von Stendhal bis Proust in Frankreich oder das, was man bei Tolstoi liest) –, und die ich nicht vorhersehen konnte.
Es geht hier also um das Wesen der Wahrheit selbst, um eine Herausforderung für die Philosophie oder wenigstens darum, was sie als ihre Grenze beunruhigen sollte: dass es Wahrheiten gibt, die erst durch die Zeit offenbart werden; nicht im Augenblick (der Argumentation), sondern durch Freisetzung. Man glaubt nämlich, die Wahrheit könne aus sich selbst heraus, index sui, überzeugen, sei auf der Stelle zugänglich, weil sie, prinzipiell auf die Vernunft sich berufend und in ihrem Aussagen begriffen, rechtmäßig jedem Geist einzugliedern ist, der sie zur Beurteilung überprüft, woher auch ihre Universalität rührt. Doch man entdeckt, dass es Wahrheiten gibt, die anderer Ordnung sind: die sich nicht beweisen lassen, sondern sich klären. Nicht dass es sich um hartnäckigere, widerständigere (abstoßendere) Wahrheiten handelt, die man, wie Nietzsche es ausdrückte, lange wiederkäuen, über die man nachgrübeln muss, um sich mit ihnen vertraut zu machen; oder theoretischere, vielleicht auch apophatischere, die mehr Elaboration oder Verstandes- und Begriffsarbeit erfordern, um zu ihnen Zugang zu erlangen. Es geht vielmehr darum, dass es neben den dargelegten, argumentierten Wahrheiten auch noch sekretierte Wahrheiten gibt, die erst mit Verzögerung an die Oberfläche treten. Wahrheiten, die man nicht durch einen Streich des Verstandes erlangt, sondern die von einem langsamen Bewusstwerdungsprozess herrühren. Wahrheiten, die nicht herzuleiten sind, zu denen man vielmehr durch den Lauf des Lebens selbst hingetragen wird, die in seinem Grundstoff selbst ausfindig gemacht und erkannt werden: Wahrheiten, die nicht verordnet werden, sondern „ausgeschwitzt“. Diese Wahrheiten sind resultativ, insoweit sie aus einer Ablagerung und Anhäufung von „Erfahrung“ hervorgehen – der Begriff selbst ist zu überdenken. Sie sind von anderer Intelligibilität: nicht der des Verstandes, sondern der der Einsicht, hervorgegangen aus einer Prägnanz und ihrer Emanation. Die Erlangung dieser Wahrheiten lässt sich nicht vorwegnehmen. Man verstand sie schon vorher, nur haben sie da noch nicht zu uns gesprochen. Daraus, dass man sie sich verzweigen lässt und reflektiert, sie aufsammelt und sich zunutze macht, geht nun die Möglichkeit eines zweiten Lebens hervor.
Es gibt jedoch eine Möglichkeit, solche Wahrheiten, die sich nicht hetzen lassen, zu präzipitieren – im zeitlichen Sinne (beschleunigen) wie im chemischen (zum Niederschlag bringen). Und zwar indem man den Tod nicht mehr bloß als „vage Erfahrung“ in ihrer Unbestimmtheit zur Kenntnis nimmt, als experientia vaga, wie Spinoza es nannte, sondern dem eigenen Tod fest ins Auge sieht, als der einzigen Zukunft, derer man sich sicher sein kann: als der einzigen Sache, von der ich absolut gewiss sein kann, dass sie mir zustoßen wird, und nach der ich mich richten kann. Ich wusste es schon vorher, aber ich „realisierte“ es nicht; das heißt, vorher wusste ich es mit einem Wissen, von dem ich nichts wissen wollte, das ich deshalb auch nicht verinnerlicht habe, so sehr setzt alles in mir, als Lebendem, diesem Wissen von meinen Tod Widerstand entgegen und lässt mich davon abschweifen. Nun, wenn man sich endlich seinen Tod vor Augen führt, wenn man beginnt, ihn mit immer größerer „Festigkeit“ zu betrachten (entgegen dem berühmten „Nicht der Sonne und nicht dem Tode …“1), das heißt, wenn dieser Terminus a quo effektiv gesetzt ist, was jedoch nichts mit einem Zustand der Depression zu tun hat (sondern im Gegenteil offensiv ist), hat eben dadurch schon ein zweites Leben begonnen. Nicht etwa, dass ich mich dazu entschließe: Das zweite Leben hat vielmehr de facto bereits begonnen. Auch dass Philosophieren „sterben zu lernen“ bedeute, ist also kein Gemeinplatz der Moral, kein Lehrstück der Entsagung oder der Resignation, sondern besagt im strengen Sinne dies (wobei das im Übrigen der entgegengesetzten Formel keineswegs widerspricht: dass Philosophieren heißt, „leben zu lernen“): Sobald man sich seinen Tod vor Augen führt, sozusagen einen Totenschädel sich auf den Tisch legt, ist man ipso facto in ein zweites Leben getreten. Es gibt nicht einmal mehr eine „Wahl“ (darin „einzutreten“ oder nicht). Das erste Leben ist jenes, in dem man dem Angesicht seines Todes ausweicht. Das zweite Leben hingegen ist jenes, das sich eröffnet, weil ich begonnen habe, meinen Tod als Verfallsdatum zu setzen. Denn damit wird eine zweite Phase im Leben definiert.
Unserer Gegenwart fehlt, wie es so oft gesagt wurde, in der Tat an sich jede Beständigkeit: Im kontinuierlichen Übergang zwischen Zukunft und Vergangenheit hat sie keine Grenzen, durch die sie sich bestimmen ließe. Als Punkt des Übergangs vom einen zum anderen kommt ihr nicht mehr Ausdehnung zu als einem Punkt und folglich auch keine Existenz. Nun, da sie uns doch unaufhaltsam entflieht, leben wir denn dann „wirklich“ (und nicht etwa nur „im Traume“, onar, ὄναρ, wie die Metaphysik sagt?) – wo wir doch ausschließlich in der Gegenwart leben können? Um aus dieser Sackgasse zu entkommen und wieder eine Gegenwart zum Leben („in der“ man lebt) zu finden, haben die Stoiker beschlossen, ihre Ausdehnung handlungsbezogen zu denken: Der Spaziergang existiert für mich, solange ich spazieren gehe, wobei er so seine Gegenwart isoliert und einfasst (Chrysippos). Doch über die Grenzen dieses von der sinnlichen Wahrnehmung erfassten Aktes geht man im Denken auf beiden Seiten, in seiner Erwartung und der Erinnerung an ihn, hinaus, und die wesentliche Kontinuität im Lauf eines solchen in „Akte“ unterteilten Lebens, welche allein eine Gegenwart zeitlich herstellen, geht uns verloren. Setze ich jedoch heute meine Bewusstwerdung „meines“ Todes als den ersten Terminus, wobei dieser kommende Tod in endgültiger Weise den zweiten bildet, wird damit wirklich ein „Präsens“/„Präsent“ – Aktualität und Gabe zugleich – abgegrenzt, das sich damit vom endlosen Fluss der Dauer (vom unendlichen aion) als jene Zeit abhebt, in der ich noch existiere. Meine Gegenwart ist das, was sich mir zwischen dem heutigen Tag, da ich mir meinen Tod tatsächlich vor Augen führe, und eben dem Tag meines Todes in einem Stück präsentiert – sich mir darbietet: sowohl mit einer einzigen „Kunft“ (da es sich nicht länger zwischen Zukunft und Vergangenheit heraustrennen lässt) wie auch mit einer einzigen Ausdehnung (von dem Augenblick, da ich meinen Tod denke, bis zu seinem Eintritt). Nun, bevor ich in die Lage gekommen war, meinem Tod wirklich ins Auge zu sehen (ihn mit „festem“ Blick zu betrachten), was an sich schon die Schwelle zu einem zweiten Lebens bezeichnet, war diese Gegenwart, diese konsistente Gegenwart, für mich nicht sichtbar. Jetzt jedoch tritt sie ohne jedes Zwingen heraus, extrahiert sich aus dem hämorrhagischen Lauf der Dauer, hält sich draußen – „ex-istiert“ – allein durch das Bewusstsein, das ich so von meinem Tod erlange und das ich entschlossen ausschöpfen kann.
Damit ist die „Gegenwart“ nicht länger jene heikle Frage, die sie für die Philosophie darstellt, insofern sie als Augenblick in sich unendlich teilbar ist (Aristoteles); oder insofern sie subjektiv an meiner so fragilen Aufmerksamkeit hängt, gefangen zwischen meiner Erwartung an die Zukunft und meiner Erinnerung an die Vergangenheit (Augustinus). Sie ist vielmehr die aktive Gegenwart eines zweiten Lebens, welches damit beginnt, dass ich ohne weiteren Aufschub, aber auch ohne Selbstmitleid, dem nicht zu datierenden, doch auch nicht zu bezweifelnden Endpunkt meines Lebens ins Auge sehe. Es geht also nicht darum, verzweifelt nach Langlebigkeit zu streben (der chinesische Hang, „sein Leben zu hegen“); auch nicht darum, von einem anderen Leben zu träumen, indem man Versprechen oder Beweisen der Unsterblichkeit Glauben schenkt; nicht einmal darum, ein „gutes“ Leben zu wollen, agathos bios, als könnte man prospektiv zwischen gleichermaßen möglichen Leben wählen, die wie Lose (kleroi) vor einem ausgebreitet werden, so wie es sich die Griechen (Platon) abstrakt (theatralisch) vorstellten. Sondern es geht darum, diese zweite Phase, die beginnt – damit beginnt, dass ihr Endpunkt für mich sichtbar wird –, nach bestem Wissen zu nutzen. Nach bestem Wissen: Die Kategorie ist weder moralisch noch psychologisch; sie ist vielmehr strategisch: Weil ich endlich weiß, dass mein Leben sich mir entzieht, nehme ich mich zurück, überprüfe meine Verpflichtungen, überdenke meine Investitionen, um weiter vorwärts gehen zu können. Dass ich endlich wage, mein Ende in Betracht zu ziehen – dass ich daran denke, daran zu denken –, bildet gerade die Schwelle zu diesem Anfang. Daher ist das Paradoxon, in dessen Aufbauschen die Moralisten sich so gefallen haben, plötzlich nicht mehr relevant: dass es, sobald man zu leben lernt, „schon zu spät“ sei. Oder wie es Montaigne entgegen dem Sprichwort sagt: „Fast besser niemals als so spät“. Denn wozu „sich gut aufs Leben verstehen, wenn einem kein Leben mehr bleibt“ (Essais, III, 10)? Das wäre bloß „Senf nach dem Essen“ … Doch siehe da, ein zweites Leben beginnt in der Tat augenblicklich, ohne dass dazu gute Absichten erforderlich wären, ohne Projektion des Begehrens, ohne Autosuggestion oder Fabulierkunst, allein dadurch, dass ich an sein Ende denke – daran denke, daran zu denken. Vorher nämlich dachte ich nicht daran – konnte es gar nicht. Nun aber, weil ich endlich daran denke, kann effektiv ein zweites Leben beginnen.