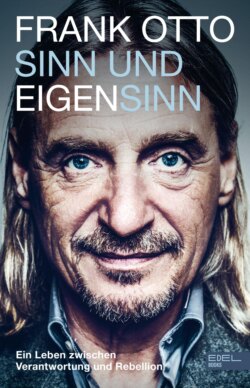Читать книгу Sinn und Eigensinn - Frank Bauer Otto - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
RENITENZ ALS REAKTION
ОглавлениеWie man es schafft, auf den Gefühlen von Lehrern Geige zu spielen, hochkant von drei Internaten geworfen zu werden und trotzdem seinen Weg zu finden. Frei nach dem Dichter Robert Frost: „Im Wald zwei Wege boten sich mir dar, ich ging den, der weniger betreten war. Dies veränderte mein Leben.“
Als zehnjähriger Junge schien ich nicht anders als all die anderen Kinder in meinem Alter zu sein. Mit 50 Pfennig Taschengeld pro Woche unterschieden sich meine finanziellen Möglichkeiten nicht von denen meiner Freunde. Und auch sonst empfand ich keine Unterschiede. Allerdings war da etwas in mir, dass das Nervenkostüm meiner Umwelt extrem strapazierte. Meine Grundhaltung lässt sich als uneinsichtig, trotzig, renitent beschreiben. Der Umgang mit mir war alles andere als leicht. Natürlich habe ich mich oft gefragt, woher dieser eigensinnige Charakter stammte. Ich denke, jedes Kind, das ältere Geschwister hat, das nicht erstgeboren ist, muss irgendeinen Weg finden, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. In meinem Fall war es die Renitenz. Die Reaktion, die ich damit erzeugte, war dann sozusagen der Moment, in dem ich mich gesehen fühlte. Vielleicht lockte meinen Vater die vermutet qualitativ hochwertige Ausbildung auf einem Internat, vielleicht sollte auch nur mein ausgeprägter Charakter ein wenig gebändigt werden. Auf jeden Fall gehörte eine Internatsausbildung zum „guten Ton“, sodass ich mit zehn Jahren auf mein erstes Internat in Carlsburg kam. Kaum dort angekommen, bemerkte ich, dass in meinem Fall doch irgendetwas anders sein musste als bei den anderen Jungen in meiner Klasse. Hatte ich beispielsweise in Mathe ein Problem und konnte die Aufgaben nicht lösen, hörte ich von meinem Lehrer: „Das bist du deinem Vater schuldig.“ Als Kind fragte ich mich, wieso ich meinem Vater etwas schuldig sei. Und für den Jungen, der neben mir saß, galt das nicht? Wenn du der Einzige bist, zu dem in der Klasse solch ein Satz gesagt wird, dann weißt du, dass es irgendeinen Unterschied zu den anderen wohl geben muss. Anfänglich konnte ich das gar nicht einordnen, aber nach und nach sah ich meinen Vater mit anderen Augen. Für mich war er zunächst einfach nur mein Vater, so wie andere Kinder auch einen Vater haben. Aber irgendwann begann ich, ihn durch die Brille dieser Leute zu sehen – und in ihrer Wahrnehmung spiegelte sich ein überaus großer Respekt wider. Die Prominenz meines Vaters überhöhte ihn in den Augen anderer. Er hatte ohne Zweifel etwas geleistet. Aus seinem nach Kriegsende gegründeten Versandhandel für Schuhe machte er eines der größten Versandhäuser der Welt. Die Geschichte eines wahren Selfmademannes, die unter anderem in dem Mitte der 1990er-Jahre erschienenen Buch Kapitäne des Kapitals eindrucksvoll dokumentiert wurde, in dem zwanzig große Unternehmerpersönlichkeiten vorgestellt wurden. Keine Frage: Mein Vater war ein Macher. Er brachte es durch Tatkraft zum Erfolg und nicht aufgrund einer besonders guten Ausbildung oder anderen womöglich privilegierten Voraussetzungen. Er war einfach eine Persönlichkeit. Natürlich gab es auf dem Internat viele Kinder aus gut situierten Familien, aber mein Vater war mehr als gut situiert. Und er hatte diese gewisse Aura. Aber dass das alles zwangsläufig auf mich kleinen Jungen abfärben sollte, dass ich zweifellos ein Mathegenie sein musste, das überforderte mich und ließ mich innerlich dichtmachen. Im Vergleich zu heute war es damals mit der pädagogischen Kompetenz der Lehrkräfte nicht immer weit her. War jemand gut in Mathematik, unterrichtete er es. Die Frage, ob er das auch vermitteln konnte, wurde eher nicht gestellt. Und das bekam ich zu spüren. Ich wehrte mich gegen die unterschiedliche Behandlung, aber die räumliche Distanz zu meiner Familie und der durch andere Menschen gefilterte Blick auf meinen Vater führten dazu, dass ich für mich irgendwann eine gewisse Sonderstellung akzeptierte. Und noch eines erkannte ich während meiner Internatszeit: Auch andere Mitschüler wurden von der Lebensleistung ihrer Väter geradezu erdrückt. Sie sagten sich sehr häufig, dass sie niemals erreichen würden, was ihr Vater im Leben erreicht hatte. Diese Erkenntnis machte sie klein und kraftlos. Wer so fühlt, hat schon verloren. Viele Kinder von großen Persönlichkeiten stecken in diesem Dilemma. Für mich stand fest, dass ich niemals nur Erbe sein wollte. Mit meiner Familie hatte ich mein Päckchen zu tragen, aber das führte bei mir dazu, dass ich einen eigenen Weg für mich suchte, wodurch die Verbindung zu meinem Vater nicht direkt hergestellt werden konnte und das zwangsläufige Messen an ihm unterblieb. Ein Weg, der zeigte, ich bin Frank – und nicht nur der Sohn von Werner. Zuerst war das eine ganz unbewusste Entscheidung, aber später wurden mir ihre Hintergründe immer klarer. So kam ich zum Malen, das niemand mit meinem Vater verband. Zwar war er interessiert an Kunst und fasziniert von den deutschen Expressionisten, aber er griff ja nicht selbst zum Pinsel. Da wurde keine Verbindung zwischen mir und ihm hergestellt, was mich sehr bestärkte, in diese Richtung weiterzugehen.
Als ich auf mein erstes Internat kam, neigten sich die 1960er-Jahre langsam ihrem Ende zu und Deutschland war erheblich in Aufruhr. Das Ende des Zweiten Weltkriegs hatte zu einer Hinterfragung der Autoritäten geführt; die junge Generation traute niemandem über dreißig, der sich nicht aktiv gegen faschistisches Gedankengut gewandt hatte. Neue Lebensentwürfe und andere politische Haltungen rüttelten am bürgerlichen Establishment. Flower-Power und freie Liebe waren in aller Munde. Frauen bekamen durch den Minirock die Möglichkeit zum Provozieren, die Männer durch ihre langen Haare. Generationen prallten aufeinander, die Studentenbewegung formierte sich, Krawalle waren an der Tagesordnung. Auch in der Musik lag etwas Aufrührerisches, im Internat war Musikhören strikt verboten. Die Disziplin sollte unter allen Umständen aufrechterhalten bleiben. Natürlich hörten wir trotzdem heimlich Musik und waren voll im Bilde. Ich mochte psychedelische Musik, vor allem Pink Floyd, aber auch härtere Rockmusik. Wie heute auch besaß Musik einen sehr hohen Stellenwert. Es war die Zeit, in der man einem neuen Album seiner Lieblingsband monatelang entgegenfieberte. Sicher förderte das Verbot auf dem Internat zusätzlich den Reiz. Schon in meiner Grundschulzeit hörte ich gern Musik. Was ich damals mit den Beatles für Reaktionen bei den Erwachsenen hervorrufen konnte – wunderbar! Mein Vater allerdings ließ sich durch Musik nicht provozieren, er hatte nichts gegen moderne Musik, diesbezüglich unterschied er sich von den meisten Erwachsenen. Dementsprechend hatte er auch nichts dagegen, als ich Gitarre lernen wollte. Er schenkte mir sogar eine – tatsächlich bestellte er sie aus dem Otto-Katalog, so wie er nahezu alles aus seinem Unternehmen bezog. Allerdings war diese Gitarre ein Kinderspielzeug. Richtige Musikinstrumente waren damals bei Otto natürlich nicht zu bekommen. Als ich diese Spielzeuggitarre zum Musikunterricht mitbrachte, meinte der Gitarrenlehrer trocken, darauf könne er mich nicht unterrichten. Ich nutzte die Gitarre schließlich als Bongo, und so begann – ungewollt und ausgelöst durch meinen Vater – meine Karriere als Schlagzeuger.
Mit Übergang in die siebte Klasse musste ich eine neue Fremdsprache lernen. Schon im Vorfeld hatte ich meinem Vater zu verstehen gegeben, dass ich unbedingt eine lebendige Sprache lernen wollte, nämlich Französisch. Doch er hatte diesen Wunsch nicht verstanden und mich einfach auf dieses Internat geschickt. Hier hatte ich keine Wahl, hier war Latein die zweite Fremdsprache – basta. Und so kam es zu meiner wirklich sehr unglücklichen Einführung in das Fach Latein. Unser Lehrbuch fing mit den Worten „rusticus laborat“ an, der Bauer arbeitet. Auf Seite zwei hieß der Bauer plötzlich „agricola“. Ich meldete mich und fragte den Lehrer, warum der Bauer zunächst männlich und dann weiblich sei, obwohl augenscheinlich nicht die Bäuerin gemeint war. Beinahe hätte ich mir eine eingefangen! Mein Lateinlehrer empfand diese Frage als eine Unverschämtheit und pure Provokation, dabei wollte ich nur die Logik dieser Sprache – us-Deklination gleich männlich, a-Deklination gleich weiblich – hinterfragen. Alle behaupteten immer, Latein sei eine vollkommen logische Sprache, doch gleich zu Beginn gab es da diesen Fall, den ich einfach nicht nachvollziehen konnte. Ab diesem Zeitpunkt stand für mich fest, dass Latein keine logische Sprache sein konnte, wenn sich schon eine so einfache Frage nicht beantworten ließ. Jegliches Auf-mich-Einreden war fortan sinnlos. Für Latein hatte ich bis zum Ende meiner ganzen Schulzeit nichts übrig. Und es kostete mich Mühe, mich jedes Jahr auf eine Fünf zu retten, um überhaupt versetzt zu werden. Dieser Krampf und meine Null-Bock-Haltung gegenüber dem kasernierten und durchstrukturierten Leben führten zu meinem ersten Internatswechsel, der in der Tat noch ein Wechsel und kein Rauswurf war. Ich kam auf ein neues Internat, weil ich darum gebeten hatte, eine andere Schule besuchen zu dürfen, damit ich andere Fächer belegen konnte. Weil mein Vater erkannte, wie unwohl ich mich in Carlsburg fühlte, und weil er dachte, für mich wäre ein anderes Curriculum passender, gab er meinem Wunsch endlich nach. Im Grunde kam der Wechsel ein Jahr zu spät, denn nun fiel er genau in meine beginnende Pubertät, in der mein Selbstbewusstsein allmählich erwachte. Zuvor war ich vermutlich noch zu jung, als dass man mir meine kleinen Abenteuer hätte ankreiden wollen. Da war meine Kindheit der starke Fürsprecher, der mich erklärte. Beispielsweise hatte ich während meiner Internatszeit eine Erdhöhle gebaut. Zwar hatte ich einen Kamin eingeplant, der glücklicherweise auch zog, aber das hätte natürlich ziemlich schiefgehen können. Als die Erzieher von der Erdhöhle erfuhren, bekamen sie einen riesigen Schreck. Ihre Reaktion war weniger von Wut als vielmehr von der Angst geprägt, dass ich dort lebendig begraben hätte werden können. Sie wollten mich schützen. Ärger bekam ich trotzdem!
Mit dem Beginn meiner Zeit in Sankt Peter-Ording wurde ich mit anderen Augen gesehen. Inzwischen war ich ein Teenager und musste für alles, was ich tat, geradestehen. Auf dieses Internat ging ich dann auch nur ein Jahr, bevor ich das erste Mal von einer Schule flog. Ich war miserabel in der Schule, schlich ständig nachts aus dem Haus und traf mich mit irgendwelchen Freunden. In Sankt Peter-Ording gestaltete sich das Internatsleben ein wenig anders als in Carlsburg. Hier gingen auch externe Schüler zur Schule, weshalb das Internat weniger eine geschlossene Gesellschaft darstellte. Auch das soziale Milieu sah anders aus. Viele Kinder waren staatlicherseits untergebracht worden, was bedeutete, dass sie aus prekären familiären Verhältnissen stammten und die Fürsorge veranlasst hatte, dass sie dort auf die Schule gingen. Das Internat hatte also etwas von einem Heim. In den 1990er-Jahren war ich noch einmal mit einem Kamerateam dort. Ich fand ganz vieles noch so, wie ich es in Erinnerung hatte. Die Mitglieder des Kamerateams sahen sich aufmerksam um und meinten später, auf sie habe das Haus wie ein Gefängnis gewirkt. Ihnen waren die abmontierten Fenstergriffe aufgefallen. Als Kind hatte ich das gar nicht wahrgenommen. Aber vielleicht hatte es sich unbewusst wie Eingesperrtsein angefühlt. Im Nachhinein finde ich die Beobachtung bemerkenswert.
Damals gab es auf der einen Seite noch etliche Lehrer vom alten Schlag, die mit ihren schweren Schlüsselbunden nach Schülern warfen, auf der anderen Seite aber auch schon die Referendare von den Universitäten, für die körperliche Züchtigung tabu war. Für die einen war ich der schwer erziehbare, für die anderen ein durchaus interessierter Schüler mit wachem Geist. Nur leider waren erstere während meiner Schulzeit noch in der Überzahl. Prügelstrafe war damals noch gang und gäbe. Ich erinnere mich an Lehrer, die zunächst alle Lineale einsammelten und auf ihr Pult legten. Daneben kam der Schlüsselbund. Erst wurden die Lineale verfeuert, und wenn die alle weg waren, kam schließlich der Schlüsselbund geflogen. In Sankt Peter-Ording geschah folgende denkwürdige Geschichte. Ich erinnere gar nicht mehr, worum es genau ging, auf jeden Fall wurde ich vom Heimleiter gerufen. Dieser war deutscher Amateurmeister im Boxen, was allseits bekannt war. Ich hielt mich in meinem Zimmer im ersten Stock auf, das das letzte auf dem Gang war. So bekam ich erst sehr spät mit, dass ich gerufen wurde. Fast alle Schüler hatten sich schon im Treppenhaus versammelt, neugierig, weshalb ich herbeizitiert wurde. Der Heimleiter stand unten am Treppenabsatz. Ich stieg die Treppe hinunter und blieb intuitiv auf der vorletzten Stufe stehen. Der Leiter holte ohne ein Wort aus und versuchte, mich zu schlagen – ob mit einem Faustschlag oder einer Ohrfeige, erinnere ich gar nicht mehr. Allerdings traf er mich nicht richtig; vielleicht weil ich ein wenig erhöht stand. Ich ging also nicht zu Boden, sondern stand vor ihm und fragte nur: „Und nun?“ Da machte er auf dem Absatz kehrt, ging schnurstracks in sein Büro und schloss sich dort ein. Ab diesem Zeitpunkt war ich der Held für die ganze Schülerschaft! Und plötzlich spürte ich, dass ich ihm gegenüber so etwas wie Macht besaß. Er wusste natürlich, wenn ich das jetzt meinem Vater erzählen würde, müsste er Konsequenzen fürchten. Inzwischen war die Prügelstrafe zumindest offiziell abgeschafft, doch in den Köpfen so mancher Lehrer war das noch nicht angekommen. Warum ich von ihm überhaupt gerufen worden war, habe ich übrigens nie herausbekommen. Keine Ahnung, was ich da ausgefressen haben sollte oder was es mir vorzuwerfen gab. Kein Wunder, dass sich unser Verhältnis danach auch nicht mehr verbesserte. Dieser Vorfall hatte die Verhältnisse umgekehrt; das wusste ich, und er wusste es auch. Wenig später flog ich dann von diesem Internat – eigentlich auch nur aufgrund einer Uneinsichtigkeit von mir.
Ich hatte einen nächtlichen Ausflug gemacht. Das war weder der erste noch der letzte gewesen. Eigentlich waren wir mit ganz vielen Jungs verabredet, allerdings schafften es nur der Sohn eines Einzelhändlers aus der Gegend und ich zum vereinbarten Treffpunkt. Wir hatten zuvor ein kleines Lager in den Dünen angelegt und dort Alkohol gebunkert. Wir genehmigten uns was davon und gingen später noch in die im Ort gelegene Disco, tranken dort auch noch ein Bierchen, bis der Besitzer uns entdeckte und rausschmiss, weil wir erkennbar minderjährig waren. Wir hatten gerade erst ein paar Schlucke von unserem Bier getrunken, weshalb wir den Rausschmiss als äußerst ungerecht empfanden. Erst unser Geld nehmen und uns dann rausschmeißen! Um uns dafür zu rächen, pinkelten wir ihm vor die Tür, was ihn wiederum veranlasste, die Polizei zu verständigen. Wir zogen marodierend durch den Ort bis zu einer Baustelle, die wir zu einer kleinen Straßensperre umbauten. Der Bäcker, der zu der Zeit bereits in seiner Backstube stand und uns beobachtete, konnte uns später leider detailliert beschreiben. Unser Weg führte weiter zu einem der Mädchenhäuser, bei dem ein Fenster offenstand. Als wir durch das Fenster einstiegen, um in den Gang der Mädchen zu gelangen, merkten wir, dass es das Zimmer der Heimleiterin war, die natürlich aufwachte. Wir schlugen uns so schnell wir konnten in die Büsche. Am nächsten Morgen war bald klar, wen die Polizei suchte: einen Jungen mit langen blonden Haaren. Und der war nicht allzu schwer zu finden. Ich erhielt Stubenarrest. Mein Vater war gerade auf Geschäftsreise in Lateinamerika und unerreichbar. Es gab damals ja noch keine Handys. Der Leiter meines Hauses, Herr Schop, war ratlos und zögerte, welches Strafmaß angemessen sei. Meine Reaktion war trotzig: „Wenn Sie mir nicht sagen können, wie lang meine Strafe genau sein soll, dann trete ich sie nicht an!“ Ich hielt mich also nicht an den verhängten Hausarrest. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Jetzt war klar, dass ich meine Sachen packen musste.
Es gab noch eine letzte bemerkenswerte Szene mit Herrn Schop, der den Auftrag hatte, mich zum Zug zu bringen. Auf dem Bahnsteig wollte er mir zum Abschied die Hand reichen, aber ich drückte ihm stattdessen meinen Koffer in die Hand, stieg in den Waggon und ließ mir den Koffer reichen. Ich suchte mir einen Fensterplatz, wo er mich gut sehen konnte. Damals gab es noch Raucherabteile in der Bahn, wobei ich als Vierzehnjähriger eigentlich nicht rauchen durfte, aber generell war Rauchen dort gestattet. In aller Ruhe drehte ich mir eine Zigarette und zündete sie genüsslich an. Als sich der Zug in Bewegung setzte, saß ich rauchend und winkend in meinem Sitz, fühlte mich stark und wunderbar. Seit der Zeit in Sankt Peter-Ording rauche ich. Im Prinzip durchgängig. Natürlich versuchte ich auch mal, damit aufzuhören, aber es klappte nicht – und mittlerweile weiß ich auch warum: Ich bin positiv konditioniert aufs Rauchen. Wenn in der Schule mal wieder ein Langstreckenlauf angesagt war, war ich – neben vielleicht zwei dicken Klassenkameraden, die noch langsamer waren – der Langsamste meiner Klasse. Anfangs war es kaum zu merken, aber als ich begann zu rauchen, wurden plötzlich meine Laufzeiten besser. Bei den Bundesjugendspielen lief ich plötzlich auf der Langstrecke ungewöhnlich gute Zeiten. Mein Sportlehrer kam damals zu mir und sagte mir auf den Kopf zu: „Du rauchst!“ Rauchen war auf dem Internat natürlich streng verboten, weshalb ich das bestritt. Und dann sagte er, es gebe keine andere Erklärung dafür, wie ich sonst das richtige Atmen gelernt hätte. Und in der Tat war ich immer kurzatmig gewesen. Das war der Grund, warum ich auf der Langstrecke so schnell schlappmachte. Ich hechelte. Durchs Rauchen atmete ich plötzlich tiefer ein und wurde deshalb auf der Langstecke immer besser. Später war ich sogar der drittschnellste Läufer der Schule. Für mich war das Rauchen damit definitiv positiv besetzt. Zur Erinnerung: „Für eine Camel lauf ich meilenweit“ … Man muss dabei bedenken, dass das Rauchen damals bei Weitem noch nicht so kritisch gesehen wurde wie heute.
Ich wurde von der Internatsleitung zu meiner Mutter geschickt, bei der gerade eine Operation anstand. Daher war ich nur zwei Tage bei ihr, bevor ich anschließend zu meinem großen Bruder Michael ging, was ich sehr cool fand! Dort überbrückte ich die Zeit, bis mein Vater von seiner Geschäftsreise zurückkam. Das Beste daran war die Musik. Ich hörte die ganze Zeit Musik, denn Michael hatte eine unglaubliche Plattensammlung. Ich hörte alles durch, was er in seinem Schrank stehen hatte. Ich hatte einen regelrechten Hunger nach Musik! Schnell kristallisierten sich meine Favoriten heraus, die ich dann ständig auflegte. Später bekam ich von Michael regelmäßig Platten zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt, zum Beispiel das gleichnamige Album von Blood, Sweat & Tears, einer amerikanischen Jazzrockband, die 1970 einen Grammy für das „Album des Jahres“ erhielt. Das zeigte mir: „Michael sieht mich, er nimmt mich wahr!“ Diese kurze gemeinsame Zeit verbindet uns bis heute.
Rückblickend fühle ich mich aufgrund meiner Zeiten in den Internaten der Familie weniger verbunden. Ich habe es immer so gesehen, dass ich zwar ein Teil der Familie, aber außerhalb von ihr aufgewachsen bin. Natürlich erlebte ich als Kind auch Momente, in denen mir die Trennung von den Eltern, von der Familie schwerfiel. Als es konkret darum ging, mit Latein zu starten, konnte ich darüber mit niemandem sprechen. Stattdessen schrieb ich Briefe, auf die nicht immer zeitnah und nicht immer passend zu meinen Fragen geantwortet wurde. Vor allen Dingen habe ich meine Mutter vermisst – so wie sie mich. Eine Mutter, die man nie richtig gehabt hat, bleibt immer eine Sehnsucht, irgendwo, irgendwie. Als Kind meinte ich so manches Mal, ihre Stimme in bestimmten Popsongs, in irgendwelchen Backgroundchören heraushören zu können, obwohl sie ja gar keine Sängerin war. Solche Dinge bildete ich mir ein. Auf der anderen Seite musste ich auf den Internaten zwangsläufig früh selbstständig werden, was ich als Heranwachsender sehr reizvoll fand. Ich kann bis heute nicht sagen, welches Modell ich favorisieren würde, hätte ich die Wahl gehabt. Da ich nicht weiß, wie es ist, ganz normal im Elternhaus aufzuwachsen, habe ich ja auch keinen echten Vergleich. Meine beiden jüngeren Geschwister, Katharina und Alexander, gingen später auch auf Internate, allerdings waren sie nicht ganz so jung wie ich, als sie dorthin kamen. Und zudem war das auch schon wieder eine ganz andere Zeit. Die Oetker-Entführung Mitte der 1970er-Jahre hatte nicht nur für großes Aufsehen gesorgt, sondern führte auch dazu, dass es vielen Wirtschaftskapitänen ratsam erschien, ihre Kinder im Ausland zur Schule gehen zu lassen. Fakt bleibt die Distanz zu meiner Familie. Weil es keinen gemeinsamen Küchentisch gab und nicht die normalerweise dort stattfindenden Gespräche, ist der Zusammenhalt in unserer Familie vermutlich auch nicht vergleichbar mit anderen. Im Grunde macht jeder von uns Geschwistern sein eigenes Ding. Viele Jahre lang sahen wir uns nur zu Weihnachten und zu besonderen Anlässen, wie dem Geburtstag meines Vaters. Da sind wir dann immer alle zusammengekommen. Für meine ältere Schwester Ingvild hatte ich immer ein besonderes Faible, weil sie als Galeristin in der Kunstszene unterwegs war und mit vielen interessanten Leuten zu tun hatte. Es war für mich als Kind natürlich ungemein faszinierend und inspirierend, das Treiben der Künstlerszene mitzuerleben! Ich empfand das alles als extrem frei, extrem spannend, extrem neu – es lag einfach ein Gefühl der Veränderung in der Luft. Die Welt wurde plötzlich bunt statt grau. Und dieser Spirit hinterließ einen enormen Eindruck bei mir.
Der Umgang mit meinem Vater blieb distanziert, aber respektvoll, wobei er sich sehr wohl auch für mich einsetzte. Als ich vom Internat flog, machte er mir keine Vorwürfe. Er selbst hatte während seiner Schulzeit Ärger mit den Paukern und konnte sich in meine Lage hineinversetzen. Er hatte eine klare Meinung zu dem Thema: „Wozu zahle ich so viel Geld an die Pädagogen, wenn die mit meinem Sohn nicht klarkommen?“ Mein Vater war ein Mensch, der es gewohnt war, zu entscheiden und zu bestimmen. Und er hatte hohe Erwartungen – insbesondere ans Personal. Seine Bediensteten hatten zu funktionieren, und taten sie das nicht, war das für ihn eindeutig ein Zeichen von Schwäche. Er betrachtete auch die Lehrer an den Internaten als sein Personal, und was er von ihnen hielt, ließ er sie deutlich spüren. Im Vergleich dazu ließ er mir gegenüber eindeutig Milde walten.
Mein nächtlicher Ausflug in Sankt Peter-Ording hatte noch ein juristisches Nachspiel. Da ich minderjährig war, wurde ich zum Laubharken verurteilt, das ich auf dem nächsten Internat ableisten durfte. Das dritte Internat war wieder das erste, denn ich kam zurück nach Carlsburg. Die Lehrer dort hatten es nicht leichter mit mir als die in Sankt Peter-Ording. Einer von ihnen, der Musiklehrer, der mir als Mentor zugeteilt war, machte damals paramilitärische Spiele mit uns. Er besaß einen Borgward-Geländewagen aus alten Militärbeständen, an dem wir regelmäßig schrauben durften. Wir fuhren auch gemeinsam in den Wald, bauten dort eine Kote und ernährten uns von dem, was die Natur hergab. Das fand ich alles unheimlich aufregend. Und dann kam ich eines Tages mit einem T-Shirt zur Schule, das meine Mutter mir geschenkt hatte und auf dem „Faites l’amour – pas la guerre“ stand, also „Macht Liebe – keinen Krieg“. Plötzlich durfte ich nicht mehr auf seinen Sitzgelegenheiten Platz nehmen, sondern musste mich in die Mitte setzen, die anderen Schüler um mich herum. Er sagte, dass die Sitzgelegenheiten alles Waffenkisten seien, auf denen kein Hippie zu sitzen habe. So tickte er.
Mir gefiel die Definition von Hippie – love, peace and happiness! Im Rahmen einer Sprachreise war ich in den Sommerferien in England gewesen und hatte dort Einblicke in die unterschiedlichen Gruppierungen der Jugendkultur erhalten: Mods, Rocker, Skins – und eben Hippies. Ich fühlte mich Letzteren zugehörig und zeigte das auch demonstrativ auf dem Internat. Meine Mutter mit ihrer Ibizaerfahrung betrachtete sich auch als eine Art Hippie. Dieser Love-and-Peace-Spirit wurde immer mehr zu meiner Weltanschauung. Ich zweifelte an vielen scheinbar unabänderlichen Gegebenheiten und fragte: Wäre es nicht schön, wenn alle Menschen nett zueinander wären? Und wieso ist das so schwierig? Mit dieser neuen Sicht auf die Dinge sagte ich mich gleichzeitig vom christlichen Glauben los. Obwohl ich religiös erzogen wurde, spürte ich zu jener Zeit nicht das, was religiöse Menschen spüren. Mich überzeugte der christliche Glaube nicht mehr. Stattdessen faszinierte mich die Vorstellung, dass alle Menschen irgendwie miteinander kommunizieren könnten, dass alle eins wären. Anstatt an Gott glaubte ich daran, mit allen Menschen verbunden zu sein. So sah ich jetzt auf die Welt, wie ein Hippie eben.
Und ganz dem Slogan „make love, not war“ folgend hatte ich inzwischen auch ein verstärktes Interesse am anderen Geschlecht entwickelt. Der Umgang mit Mädchen war mir durch meine Zeit in Sankt Peter-Ording bereits vertraut, schließlich war dies schon ein koedukatives Internat. Und auch in Carlsburg gab es inzwischen die ersten Mädchen, da sich das Prinzip der gemeinsamen Erziehung von Mädchen und Jungen mehr und mehr durchsetzte. Um es kurz zu machen: Mein zweites Gastspiel in Carlsburg war nur von kurzer Dauer. Nach nur wenigen Monaten war schon wieder alles vorbei und auch dieses Mal war es meine Schuld. Mein Mentor hatte bemerkt, dass ich nicht in meinem Bett lag, und mir aufgelauert. Ich dachte, ich hätte einen raffinierten Weg gefunden, um aus dem Internat ausbüxen zu können, aber ganz so raffiniert war er wohl nicht. Als ich durch das Toilettenfenster wieder einstieg und die WC-Tür aufstieß, machte es bang und das Licht ging an! Eben jener Lehrer hatte auf den Schalter gedrückt und somit meinem nächtlichen Abenteuer ein jähes Ende bereitet. Erstmals in der Geschichte dieses Internats wurde einem Mädchen der Schulpullover entzogen. Für mich bedeutete das Auffliegen unseres gemeinsamen Ausflugs das Ende an dieser Schule, weil ich als Junge nach dem Urteil der Erzieherkonferenz derjenige gewesen war, der das Mädchen dazu verführt hatte, sich nachts im Park zu treffen. Die Konferenz hatte in den Ferien getagt und beschlossen, dass ich nicht wiederzukommen bräuchte. Zwei Erzieher hatten mir noch eine Chance geben wollen, der Rest nicht. Die hatten zweifellos alle Panik. Ein Junge und ein Mädchen allein nachts im Park! Das bedeutete nicht zuletzt auch jede Menge Ärger und Stress für die Lehrkräfte. Dabei waren doch all diese kleinen Abenteuer, diese pubertären Geschichten vollkommen normal. Wer wollte einem Teenager wirklich verdenken, dass er sich nachts allein mit einem Mädchen im Park treffen wollte?
Meine Vorstellung vom kindlichen Zusammenleben war geprägt von Enid Blytons Fünf Freunde-Büchern; so stellte ich mir auch das Internatsleben vor. Es zeigte sich aber schnell, dass diese Vorstellung mit der Realität wenig gemein hatte. Und trotzdem versuchte ich immer das Beste aus der Zeit an den Internaten zu machen. Mein drittes und letztes in Stein an der Traun war eine alte Ritterburg, in der es noch einige unterirdische Gänge gab und die meiner verklärten Vorstellung von einem Internat sicher am nächsten kam. Trotzdem wurde ich auch hier nicht glücklich. Dass ich den Erziehern gegenüber sehr kritisch eingestellt war, bereitete mir – oh Wunder – auch in diesem Internat Probleme. Natürlich gab es auch Lehrer, die ich mochte, aber viele fand ich einfach hinterfotzig. Und die habe ich dann auch bis aufs Blut provoziert. Und so hatte ich natürlich ständig Ärger mit denen. Im Rückblick würde ich sagen, diese Lehrer waren paranoid. Sie hatten pure Angst – Angst vor Rebellion, vor Drogen, vor dem eigenen Versagen. Viele von ihnen kannten nichts anderes als diese autoritären Strukturen mit ihren schon damals umstrittenen Durchsetzungsmethoden. Als ihnen die Prügelstrafe genommen wurde, wurden einige geradezu hilflos und hatten Angst, ihre Autorität zu verlieren, womit sie nicht zurechtkamen. Und auf genau diesen Gefühlen spielte ich virtuos Geige. Ich wusste, wie ich diese Lehrer zur Weißglut bringen konnte, ohne dass sie mir etwas anhaben konnten. Das war für mich schon so etwas wie ein Hobby. Für die war ich ein echt harter Brocken, so renitent wie ich war. Es muss allerdings auch gesagt werden, dass es nicht viel brauchte, um sie zu provozieren. Mein damals bester Freund flog von diesem Internat, weil er bei der Morgenandacht gegrinst hatte …
Bevor man von der Schule flog, wurde man gefragt, ob man nicht vielleicht mit der Schule kooperieren und so den Rauswurf abwenden wolle. Das war ein äußerst perfides System, das natürlich nur diejenigen durchschauten, denen der Rauswurf drohte. So wie mir eines Tages. Damals war ich Klassensprecher und wurde während der Unterrichtszeit aus der Klasse gerufen. Das war erst einmal nichts Ungewöhnliches, allerdings sollte ich nicht zum Schulleiter kommen, sondern zum Heimleiter. Das hingegen war schon sehr ungewöhnlich. Er erhob eine unglaubliche Anschuldigung gegen mich. Angeblich hatte ich mich mit einem ehemals externen Schüler getroffen, um von ihm Drogen zu kaufen. Getroffen hatte ich diesen Jungen tatsächlich, aber nur, weil ich mit ihm befreundet war. Der war auch kein Dealer – jedenfalls hat er nie versucht, mir irgendetwas zu verkaufen. Doch meine Version der Geschichte interessierte den Heimleiter herzlich wenig. Die Panik vor Drogen an seiner Schule war so groß, dass er sich von mir wichtige Informationen erhoffte. Irgendwie sollte ich mit dieser Drogengeschichte weichgekocht werden, denn anschließend offerierte mir der Heimleiter ein Spitzelangebot. Natürlich ging ich nicht darauf ein und flog zum dritten Mal von der Schule. Im Nachhinein wurde mir auch klar, warum ich wirklich rausgeworfen wurde. Wie schon auf dem Internat in Sankt Peter-Ording hatte ich mich nachts mit einem der Mädchen getroffen, wobei ich mich hier heimlich in den Mädchentrakt geschlichen hatte. Zwar wurde ich dieses Mal nicht von einem Lehrer entdeckt, aber in dem Zimmer, in dem ich das Mädchen besuchte, wohnte ein zweites, dem ebenfalls schon mal der Rausschmiss gedroht hatte. Ganz offensichtlich hatte sie sich auf den Spitzeldeal eingelassen und mich verpetzt. Meine Mitschüler wurden wenig später darüber unterrichtet, dass mein nächtlicher Ausflug der Beschaffung von Drogen gedient habe und dass das der Grund meines Rausschmisses gewesen sei. Ich sollte als warnendes und abschreckendes Beispiel herhalten.
Aus der Clique, der ich damals angehörte, war ich der Vorletzte, der von der Schule flog. Wie gesagt, es reichte das Grinsen in der Morgenandacht, das der Heimleiter in seiner Drogenparanoia als glückseliges Kifferlächeln interpretiert hatte …
Meinen Schulabschluss machte ich letztendlich in Hamburg. Mit siebzehneinhalb ging ich nach meinem letzten Internatsrauswurf auf eine Art Crashkursschule, die Institut Dr. Ahrens hieß. An dieser Privatschule machte ich in einem halben Jahr meine Mittlere Reife. Nach kurzer Überlegung, das Abitur vielleicht doch noch dranzuhängen, entschied ich mich aber, zur Kunsthochschule zu gehen. Diese Entscheidung hatte sich schon auf dem letzten Internat abgezeichnet. In meinem ersten Zeugnis an der neuen Schule sollte ich eine Drei in Kunst bekommen, obwohl ich gar keinen Kunstunterricht gehabt hatte. Das war für mich nicht einzusehen. Für mich war die Sache klar: „Also entweder ist an dieser Stelle in meinem Zeugnis ein Strich oder aber eine Eins! Sie können es sich aussuchen.“ Weil ich nicht lockerließ und mit der Angelegenheit allen auf die Nerven ging, wurde mir gestattet, eine Kunstmappe anzufertigen und vorzulegen, die zu einer Korrektur der Note führen könne. Die Schule kämpfte damals um ihre staatliche Anerkennung, und der Kunstlehrer nahm gerade an einem Weiterbildungskurs teil, um seine Zulassung als staatlich anerkannter Kunstlehrer zu erlangen. Es gab also einen ganz konkreten Grund, warum kurzzeitig kein Kunstunterricht stattfand. Daher nahm man mich und meinen Protest auch nicht auf die leichte Schulter.
Dem Vorschlag, eine Mappe vorzulegen, stimmte ich gerne zu, allerdings war ich in einem Vierbettzimmer untergebracht. „Wie soll ich denn da malen?“, fragte ich vorwurfsvoll. Daraufhin wurde mir ein kleiner Materialraum zur Verfügung gestellt, der an eines der Klassenzimmer angrenzte. Nun konnte ich jeden Tag an meinen Bildern arbeiten. Ich malte sehr viele surrealistische Bilder, zum Beispiel meinen Lateinlehrer als Schlange. Das konnte nicht beanstandet werden, es war ja ein surrealistisches Bild … Dann erstellte ich eine Porträtserie von meiner Freundin im Stil von Andy Warhol, immer das gleiche Porträt, in Blau, Grün, Rot. All die großen Popstars der Malerei, die damals Eindruck auf mich machten, ahmte ich nach. Viele Inspirationen kamen von Plattencovern. Ich malte auch sexualisierte Bilder, weil mich das als Heranwachsender gerade beschäftigte. Irgendwann legte ich also meine Mappe vor – und bekam eine Eins!
Dieses Privileg, einen Materialraum allein für mich nutzen zu dürfen, blieb mir über die Zeugnisvergabe hinaus erhalten. Damit hatte ich auf jeden Fall eine Sonderstellung in der Schule, was mir sehr gefiel. Missgunst oder Neid meiner Mitschüler spürte ich nicht, denn die Malerei betraf ja nur mich. Eigentlich war es eher andersherum. Die Kunst eröffnete mir die Freiheit, frech sein zu dürfen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, eine Freiheit, für die ich von meinen Mitschülern Applaus bekam: „Der Frank traut sich was und kann nicht dafür belangt werden.“
So verbrachte ich immer mehr Zeit damit, mich im Malen zu üben. Da entwickelte sich ein echtes Interesse bei mir, und langsam entstand der Wunsch, nach der Schule Kunst zu studieren. Die Lehrer erkannten, dass es sinnvoll war, mich zu fördern. Vielleicht dachten sie auch nur, solange der Junge malt, hängt er nicht irgendwo herum und baut Scheiße. In den Augen der Lehrer jedenfalls machte ich etwas Anständiges. Außerdem sahen sie sicherlich auch Fortschritte in meiner Entwicklung, weshalb sie mich unterstützten.
Heute habe ich das Gefühl, als hätte ich in meinem Leben immer nur reagiert. Alles, was ich tat, war im Grunde stets eine Reaktion auf etwas. Nie war es so, dass ich selbst gewusst hätte, welchen Weg ich nehmen soll, sondern es wurde mein Weg, weil ich auf irgendeinen Umstand reagierte. Im Rückblick sehe ich das so, aber als junger Mensch macht man sich so etwas nicht bewusst. Mein Interesse an Musik entstand durch das Verbot auf dem Internat, womit ich ihr eine besondere Bedeutung beimaß. Für mich lag die Schlussfolgerung nahe: Wenn das Hören von Musik verboten ist, dann muss Musik etwas ganz Mächtiges sein, etwas Weltbewegendes! Ähnlich war es mit der Kunst. Weil ich keine Drei im Zeugnis akzeptieren wollte, beschäftigte ich mich immer mehr mit der Malerei. Viele meiner Reaktionen zeugten von Trotz und meinem mangelnden Respekt gegenüber Autoritätspersonen. Am Ende aber entsprachen sie doch sehr meinem Selbst. In Ermangelung von Modellen malte ich wenig später sehr viele Selbstporträts für meine Bewerbungsmappe für die Kunsthochschule. Und in diesen Selbstporträts drückte sich stets eine Art Einverstandensein mit mir selbst aus. Das beruhigende Gefühl, dass bis hierhin alles gar nicht so schlecht verlaufen war.