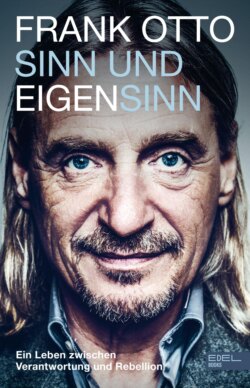Читать книгу Sinn und Eigensinn - Frank Bauer Otto - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SEX, DRUGS UND STIPPVISITE IM FAMILIENUNTERNEHMEN
Оглавление„Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren“, wusste schon Wilhelm Busch. Ein guter Grund, althergebrachte gesellschaftliche Konventionen über Bord zu werfen, oder aber auch, sich vom väterlichen Erwartungsdruck zu befreien.
Über meinen weiteren Weg nach der Mittleren Reife war ich mir völlig im Klaren: Ich würde an der Kunsthochschule aufgenommen und dort zu einem respektablen Maler ausgebildet werden. Leider lief es dann doch etwas anders. Auf meine Bewerbung an der Kunsthochschule hin wurde ich erst einmal nicht dort aufgenommen. Weshalb mein Vater mich dann in sein Versandhaus holte. Er war der Meinung, ich müsste mir das Unternehmen mal von innen ansehen – und er duldete in dieser Angelegenheit absolut keinen Widerspruch. Sein einziges Zugeständnis an mich war die Abteilung, in die ich reinschnuppern sollte: Wo ich mich doch so für Kunst interessierte, würde die Marketingabteilung doch prima passen! Als ich dort meine Arbeit antrat, stand ich dem Ganzen nicht einmal besonders skeptisch gegenüber. Dementsprechend gut liefen die ersten drei Tage. Es gab einen kleinen Innenhof, in dem sich vor allem die Raucher regelmäßig trafen, zu denen ich gehörte, und ich genoss meine kleinen Pausen dort. Am vierten Tag stieß ich zu der gleichen Gruppe von Leuten, mit denen ich schon die vergangenen Tage geraucht und geplaudert hatte – und plötzlich verstummten alle Gespräche. An diesem Tag hatte es nun auch der Letzte mitbekommen, dass ich der Sohn vom Chef war. Schlagartig begriff ich, dass es mit mir im Unternehmen meines Vaters nichts werden konnte. Außerdem war Michael damals bereits Chef des Einkaufs, und es bestand kein Zweifel daran, dass er eine Karriere im Familienunternehmen anstreben und in den Vorstand gehen würde. Was sollte ich da also noch? Damals war die Fernsehserie Dallas gerade sehr erfolgreich. Ein Bobby Ewing wollte ich nicht werden …
Glücklicherweise gibt es bei Otto die Gleitzeit. In den vier Wochen, die ich dort arbeitete, führte ich sehr viele Bewerbungsgespräche und hatte am Ende des Monats eine Ausbildungsstelle am Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe sicher. Hier wurde ich zum Restaurator für Papier und Grafik ausgebildet, mit allem, was das auch finanziell für einen Auszubildenden bedeutete. Mit 360 Mark Ausbildungsvergütung und etwas Taschengeld von meiner Mutter finanzierte ich mein Leben in einer WG im Hamburger Schanzenviertel. Wenn das Geld nicht reichte, gab es ab Monatsmitte eben nur noch Haferflocken zu essen. Am Ende meiner Ausbildung wurde ich zum Direktor gerufen, der mir tatsächlich anbot: „Frank, wir sind sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Möchtest du nicht die Werkstatt übernehmen?“ Dieses Angebot war für mein Selbstwertgefühl ungeheuer wichtig. Es tat gut zu wissen, dass ich mit meiner Hände Arbeit Geld verdienen konnte und nicht auf die Unterstützung meines Vaters angewiesen war. Ich konnte mich zu Recht unabhängig fühlen. Dennoch wollte ich unbedingt Kunst studieren. Und endlich bekam ich auch den erhofften Studienplatz an der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel. Ich kam in die Meisterklasse von Harald Duwe, einem der bedeutendsten realistischen Maler seiner Zeit. Er sagte immer: „Hier lernt ihr das Malen, Kunst machen könnt ihr später!“ Der Zwist zwischen der abstrakten und der gegenständlichen Kunst bestand bereits seit Anfang des Jahrhunderts und war gerade noch mal richtig aufgeflammt. Das war ein regelrechter Glaubenskrieg, der auch von Duwe geführt wurde. Er verwies zum Beispiel mal einen der Studenten der Klasse wegen Malens und Zurschaustellung eines surrealistischen Bildes, woraufhin ich mir kurzerhand meine Staffelei schnappte und mit ihr – wie es meine Art war – ebenfalls auf den Flur zog. Ich mochte solche Spielchen nicht und hatte gleichzeitig keine Angst vor dieser Reibung. Als Duwe dann aber die gesamte Klasse bat, eine Ausstellung von Arnulf Rainer zu besuchen, ausschließlich, um über dessen Kunst zu lästern, platzte mir der Kragen. Ohne mich dort zu immatrikulieren, wechselte ich an die Hamburger Hochschule für bildende Künste und belegte dort Kurse. Erst kürzlich erfuhr ich, dass mich die HfbK sogar als Alumni führt, obwohl ich dort nie eingeschrieben war … Hier steppte der Bär jedenfalls andersherum. Gegenständliche Malerei wurde als Fotojournalismus verspottet, und es gab Veranstaltungen, bei denen Dozenten und Studenten herumtobten und sich gegenseitig anschrien. Gegenständlich hieß hier politisch, sozialistisch und nicht frei. Dem einen dogmatischen Spießer grad entronnen, konnte ich nicht einfach ins andere engstirnige Lager wechseln. Zeitgleich entwickelte sich aber auch ein erzählfreudiger, unbekümmerter Neoexpressionismus voll freizügiger Selbstbekenntnisse, dem ich viel abgewinnen konnte: die Neuen Wilden. Deren Demontage des traditionellen Kunstverständnisses konnte ich problemlos folgen.
Harald Duwe verunglückte am 15. Juni 1984 tödlich bei einem Verkehrsunfall. Nach der Trauerfeier unterhielt ich mich mit meinen ehemaligen Kommilitonen und erfuhr, dass mein Weggehen aus Kiel Duwe einigermaßen getroffen habe, sei ich doch im Grunde sein Protegé gewesen. Solch einer Verbindung zu ihm war ich mir nie bewusst gewesen, aber aus später Einsicht und als Wiedergutmachung verfasste ich inzwischen einen Wikipedia-Eintrag über ihn.
Seit meinen Internatszeiten begleitet mich das weibliche Geschlecht. Im Grunde war ich bislang in meinem Leben noch nie Single. Eine Beziehung folgte der nächsten und manchmal lief sogar etwas parallel. Und mehr noch: Seit damals lebe ich – ohne Ausnahme – in den unterschiedlichsten Wohngemeinschaften. Schon immer bin ich gern in Gesellschaft gewesen und schätze es, mit Menschen zusammen zu sein. Selbst heute wohnen noch Freunde von mir mit unter meinem Dach. Mir war Privatsphäre nie besonders wichtig, weil ich es einfach nicht anders kannte. In den Mehrbettzimmern der Internate gab es keine Privatsphäre. Jeder bekam alles mit und man musste sich dafür nicht schämen. Das hat mich sehr geprägt. Mir ist egal, was die Nachbarn hören oder sehen. Jeder ist, wie er ist. Wer soll darüber urteilen? Und warum? Später musste ich das Verständnis für das Bedürfnis nach Privatsphäre regelrecht erlernen, weil das etwas war, das für meine Partnerinnen durchaus wichtig war. Keine Frage: Das hat natürlich damit zu tun, wie man aufwächst.
Die junge Frau, die ich als meine Jugendliebe betrachte, lernte ich auf meinem letzten Internat kennen. Julia kam aus Berlin, und selbst nachdem sie von der Schule abgegangen war, hielt unsere Beziehung noch ziemlich lang. Wir führten ein ähnliches Leben, hatten die gleichen politischen Ansichten und Interessen und engagierten uns für die gleichen Dinge. Jedes Mal wenn wir uns wiedersahen, hatten wir uns viel zu erzählen und stellten immer wieder fest, wie parallel unsere Leben doch verliefen. Was uns immer wieder aufs Neue erstaunte.
Nach Julia kam Eva. Eigentlich hatte ich mir nicht vorstellen können, mit einer Frau zusammen zu sein, die ein Kind hat. Aber genau das passierte. Damals war alles noch ein bisschen einfacher, zumindest denke ich das im Nachhinein. Sie war ein Hippie, ich war ein Hippie, alle waren Hippies auf die eine oder andere Art und Weise – der eine mehr politisch, der andere weniger politisch. Wir lebten in unserer jugendlichen Welt, zu der zwangsläufig gehörte, dass die Erwachsenen einen nicht verstehen. Und wir waren cool! An unserer Tür klebte ein Aufkleber: „Hier wohnen die Leute, vor denen unsere Eltern uns immer gewarnt haben!“ Wir scherten uns nicht um Konventionen und experimentierten mit der freien Liebe. Eva und ich hatten parallel immer noch andere kleine Techtelmechtel laufen. Aber sobald irgendjemand anderes von einem von uns zu viel wollte, haben wir das sofort beendet. Wir genossen immer den höchsten Respekt von allen unseren Freunden, weil das bei uns wirklich funktionierte. Dafür wurden wir regelrecht bewundert. Inzwischen wohnten wir in einer WG in Barmbek, einem traditionellen Hamburger Arbeiterviertel. Wir trugen lange Haare und besaßen einen bunt bemalten VW-Bus. Im ganzen Haus gab es nur einen einzigen Fernseher, vor dem wir ein Matratzenlager aufgebaut hatten. Irgendwer, der mal bei uns zu Besuch gewesen war, erzählte herum, wir würden dort alle in einem Bett liegen. Die Leute malten sich in den schillerndsten Farben aus, wie das bei uns zu Hause wohl zugehen würde. Viele wollten auch nicht, dass ihre Kinder mit Evas Tochter, die ich auch als meine Tochter betrachtete, spielten, weil das kein Umgang für sie war – so ein verwahrlostes Kind. Daher spielte unsere Tochter die meiste Zeit mit den muslimischen Kindern aus der Nachbarschaft. Menschen aus einem anderen Kulturkreis hatten offensichtlich einen anderen Blick auf unser Leben.
Drogen gehörten irgendwie dazu, spielten aber eigentlich keine so große Rolle. Schon während meiner Schulzeit hatte ich meinen ersten Joint probiert. Freunde von mir hatten eine Ausstellung der Polizei besucht, in der man unter anderem gepresstes Haschisch in Augenschein nehmen konnte. Einer meiner Jungs hatte heimlich eine Ecke davon abgebrochen und mitgebracht. Die haben wir dann zusammen geraucht. Vielleicht war das nur eine Attrappe oder einfach zu wenig, jedenfalls merkte ich damals überhaupt nichts. In meiner Barmbeker Zeit brachte immer mal wieder jemand etwas Hasch mit. Wenn es was zu rauchen gab, war das schön, und wir haben es getan. Aber es war nichts, wofür man sich ein Bein ausgerissen hätte. Generell haben wir Gras oder Haschisch nie als gefährlich betrachtet. Das war unsere Einstellung – und ist meine bis heute. Mir ist bewusst, dass man davon durchaus abhängig werden kann; ich kenne auch Leute, denen das passiert ist. Allerdings bin ich überzeugt, dass nur abhängig wird, wer psychisch labil ist. Die Ursache ist nicht nur das Gras oder Haschisch, sondern dazu kommt der psychische Knacks, der diese Abhängigkeit befördert. Weltflucht kann man heute auf so viele Arten begehen. Man kann alkoholabhängig oder spielsüchtig werden, man kann mit irgendwelchen virtuellen Games sehr tief in digitale Fantasiewelten abtauchen und sein eigentliches Leben dabei aus dem Blick verlieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Menschen, die psychische Probleme haben, versuchen, diese zu kompensieren. Haschisch ist nur eine davon. Warum ausgerechnet diese eine verbieten? Auch die Sorge, dass Haschisch als Einstiegsdroge dienen und für harte Sachen die Tür öffnen könnte, kann ich nicht gelten lassen. Im Zuge einer Legalisierung müsste man nicht mehr zum gemeinen Straßendealer, der meist das volle Sortiment anbietet, sondern könnte sich das Gras meinetwegen in der Apotheke besorgen. Da kommt man nicht plötzlich auf die Idee, auch mal Koks zu probieren … Mir ist auch nicht bekannt, dass die Holländer alle koksen oder härtere Drogen nehmen, weil sie durch die Erlaubnis zu kiffen dazu verleitet worden wären. Das hätten wir bemerkt!
Irgendwann zog Eva mit einer befreundeten Band durch die Lande und strandete in Köln. Sie hatte ihre Tochter bereits als Sechzehnjährige zur Welt gebracht und nun das Gefühl, ihre Jugend versäumt zu haben. Die Kleine blieb bei mir und wurde fester Bestandteil meines Lebens. Geschichte wiederholte sich, denn im Grunde war es genau das, was meine Mutter mit mir gemacht hatte. Für mich war das eine gute Möglichkeit, mein Aufwachsen ohne Mutter noch einmal zu reflektieren. Ich wusste genau, wie sich das anfühlte. Und aus diesem Grund konnte ich sie auch nicht alleinlassen. Sie ging noch in den Kindergarten und hatte einen Narren an mir gefressen. Auch wenn meine Freunde mich damals alle für verrückt erklärten, sah ich nur das Positive. Wenn ich mit meiner Tochter im Supermarkt einkaufen ging, dann waren – außer vielleicht dem Verkäufer hinter der Fleischtheke – nur Frauen im Supermarkt. Und die machten alle Platz für uns, wenn wir mit dem Einkaufswagen in Richtung Kasse gingen, weil das damals so exotisch war, dass ein Mann mit einem Kind einkaufen ging. Heute kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, weil es so selbstverständlich geworden ist. Ich war zu der Zeit Anfang zwanzig, hatte noch keine eigenen Kinder und nahm dieses Mädchen wie mein eigenes an. Diese Entscheidung habe ich nie bereut! Das Mädchen gab meinem Leben Stabilität und erdete mich. Dadurch, dass ich sie angenommen hatte, konnte ich nicht mehr jeden Mist mitmachen. Plötzlich saß ich auf Elternabenden, konnte mitbestimmen, wie Dinge zu laufen haben. Das war auch eine tolle Aufarbeitung meiner eigenen Vergangenheit, mich mit anderen pädagogischen Konzepten auseinanderzusetzen, zu überlegen, was das Richtige für ein Kind ist. Klar verpasste ich einige Kneipenabende, aber die Dinge, die mir wichtig waren und die ich durchziehen wollte, wie zum Beispiel mein Studium, diese Dinge machte ich trotzdem. Mein Leben bekam durch sie einen Rahmen und Struktur. Es war plötzlich sehr durchorganisiert und es gab keinen Leerlauf und wenig Raum für spontanen Quatsch. Vielleicht war das mein Glück. Natürlich kann ich nicht sagen, ob ich ohne meine Ziehtochter Gefahr gelaufen wäre, in irgendeiner Form abzugleiten, aber ich kann sicher sagen, dass einige meiner Freunde auf der Strecke geblieben sind. Und natürlich können einen Menschen auch mit runterziehen, wenn man nicht stark genug ist. Mein bester Freund von damals – der mit dem Grinsen in der Morgenandacht – lebt heute nicht mehr, und er ist nicht der einzige. Er wurde Alkoholiker und krepierte jämmerlich. Seine Probleme lagen in der Trennung seiner Eltern begründet; das Verhältnis zu seinem Vater war extrem belastet. Zeitlebens hatte er das Gefühl, seine Mutter vor dem Vater beschützen zu müssen. Als ich ihn kennenlernte, war er ein fröhlicher junger Kerl – und dann zerbrach er immer mehr an der Welt. Er wurde Totalverweigerer, lehnte also nicht nur die Wehrpflicht, sondern auch jeglichen Ersatzdienst ab, sodass die Feldjäger ihn holten. Es folgte eine Knastkarriere, weil er notorisch aneckte – dabei ging es nie um etwas wirklich Schwerwiegendes. Natürlich gab es auch tolle Momente. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der er mit einer Punkerin zusammenlebte, die wie ein Messie nichts wegschmeißen konnte. Stattdessen dekorierte sie mit all dem Müll ausgesprochen kreativ die gemeinsame Wohnung. Joghurtbecher hingen von der Decke und die Wände waren mit Plastiktüten tapeziert. Ihre Wohnung wurde sogar mal für den Stern fotografiert, weil sie so kreischend bunt war. Mit der Frau hatte er eine gute Zeit. Das war genau sein Ding, mit so jemand Ausgeflipptem zusammen zu sein, weil er selbst so war. Es gab also auch in seinem Leben nicht nur Tiefen. In den letzten Jahren vor seinem Tod habe ich ihn dann nicht mehr gesehen.
Obwohl Eva nach Köln ging, trennten wir uns nicht. Nicht nur ihre Tochter blieb in Hamburg, sondern auch ein Teil ihrer Klamotten. Ich schlief weiterhin in unserem gemeinsamen Bett, und irgendwie wirkte alles so, als könnte sie irgendwann zurückkehren. Meine Mitbewohner halfen mir, so gut es ging, in meinem neuen Leben als alleinerziehender Vater. Evas Tochter gehörte nun zu mir, zu meiner Familie, und selbstverständlich war sie fortan auch bei Familienfeiern dabei, ohne dass das groß thematisiert worden wäre. Ich kann daher gar nicht genau sagen, wie mein Vater die Sache sah, kann mir aber vorstellen, dass er das nicht ganz unproblematisch fand. Da denken Patriarchen doch eher in Erbfolgen und eigen Fleisch und Blut …