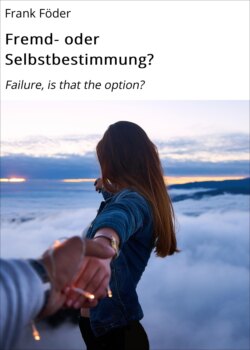Читать книгу Fremd- oder Selbstbestimmung? - Frank Föder - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zerstörung und Krieg, was beschwört sie herauf?
ОглавлениеGemeinhin wird unterstellt, daß neben der Leichtfertigkeit, unter der die Mäßigung leidet, der unselige Drang zur Gewaltanwendung im einzelnen Menschen angelegt sei. Er, der Mitmensch, der Nachbar, sei unbesonnen und streitsüchtig veranlagt. Er lasse sich zu leicht zu Ausfällen hinreißen. Folgerichtig müsse es darauf ankommen, die Erzihung und Bildung zu verbessern. Dem Menschen müsse beigebracht werden, an sich zu halten. Ihm müsse die Neigung ausgetrieben werden, auf unliebsame Begebenheiten bösartig, mit Ingrimm zu reagieren.
Mit hohem Pathos werden Friedenspreise verliehen. Sie werden Damen und Herren zuteil, die in ihrem Umkreis Zeitgenossen dazu veranlaßt haben, davon abzulassen, aufeinander einzuschlagen, oder die in ihren Publikationen eine Lanze für die Friedfertigkeit brechen.
Ohne Zweifel ist verdienstvoll, den Angehörigen der weltbewegenden Spezies anschaulich zu machen, daß Krieg verwerflich ist, unerfreulich und für den einzelnen selten bis nie von Nutzen. Unbestreitbar ist ehrenwert, dem Nachwuchs dieser Gattung zu verdeutlichen, wie schlimm die Auswirkungen von Wut und Waffen sind.
Der erhobene Zeigefinger hat seine Berechtigung. Doch weist er in die richtige Richtung? Sind es die Mitmenschen, die von sich aus auf Hieb und Stich aus sind? Etwa, weil sie mangelhaft unterrichtet oder schlecht erzogen sind? Oder steckt jemand oder etwas anderes dahinter?
Gefeiert werden Friedensaktivisten wie der Politologe Andreas Buro. Er fordert den „Aufbau ziviler Konfliktlösungsmuster“ und „kooperative Verhaltensweisen“ (In seinem Buch „Gewaltlos gegen Krieg. Lebenserinnerungen eines streitbaren Pazifisten“, Brandes & Apsel, Frankfurt a. M., 2011). Sein Appell richtet sich zwar in erster Linie an die Politikerin und den Politiker, läßt aber auch den Mann und die Frau auf der Straße nicht aus. Am Ende dringt auch er darauf, daß seine Mitbürger sich verträglich verhalten.
Es geht um die Natur des Menschen. Nehmen die Friedensfreunde die Veranlagung und das Wünschen und Wollen ihrer Mitbürger zutreffend wahr? Unbenommen ist beim Mitmenschen hin und wieder Angriffswut zu vermerken. Was aber ruft sie hervor? Schlechte Erziehung, mangelhafte Bildung? Oder ist dafür vielleicht eher das Umfeld verantwortlich? Kommt die Gewaltbereitschaft nicht von innen, sondern von außen?
Das Bestreben, den Menschen zu durchgehender Besonnenheit zu veranlassen, ist Gegenstand einer weltweiten Bewegung, die schon im Altertum ihren Ursprung hat, des Pazifismus. Sie erhielt besonders nach den Gräueln des zweiten Weltkriegs neuen Auftrieb. Den Ostermarschierern geht es erklärtermaßen darum, den Haß der Völker gegeneinander aus der Welt zu schaffen.
Nun ist allerdings sehr die Frage, ob diese Untugend oft oder überhaupt je die wahre Ursache der Kriege war. Haßten die Deutschen die Polen und Franzosen? Selbst wenn dies der Fall gewesen sein sollte, bliebe zu klären, ob diese Aversion in Erfahrungen des einzelnen ihren Ursprung hatte oder geschürt worden ist, von hoher Hand.
Weihnachten 1915 kam es in Flandern zwischen den Gräben zu einer Verbrüderung von britischen und deutschen Soldaten. Die Truppenteile mußten anschließend aus der Front genommen werden. Selbst in Stalingrad ereignete sich Weihnachten 1943 zuweilen ein friedlicher Kontakt zwischen russischen und deutschen Kämpfern. Die Ausführenden der Kriegshandlungen werden augenfällig selten von Abneigung gegeneinander beherrscht. Sie sind mehr Opfer als Täter. Nicht die Soldaten treiben zum Kampf. Krieg wird nicht von ihnen, sondern von ihrer Obrigkeit heraufbeschworen.
Heute haben die Europäer sich vereint. Was immer zwischen ihnen vorlag und geschehen ist, es ist nicht vergessen, aber weitgehend doch vergeben. Überall an niedergerissenen Schlagbäumen liegen sich Freunde in den Armen. War es mit der Feindschaft der Völker vorher vielleicht gar nicht so weit her?
Nebenbei sei angemerkt, die Tatsache, daß es während des Ost-West-Konflikts trotz einiger gefährlicher Eskalationen nicht zum Krieg gekommen ist, ist kaum das Resultat einer Friedenserziehung oder einer Friedenspolitik, sondern schlicht der Erfolg des Konzepts der Abschreckung.
Kriege finden statt. Zur Zeit – gottlob – nur begrenzt und überwiegend nur innerhalb der Staaten. Doch ist es so, daß die, die sich hier gegenseitig umbringen, ihrer Veranlagung folgen? Entspricht es ihrer Natur oder schlechter Erziehung oder vorhandener Abneigung, daß sich Mitmenschen gegenseitig nach dem Leben trachten?
Wo Menschen tatsächlich aus eigener Veranlassung zur Waffe greifen und töten, hat das einen Hintergrund, der gern außer Acht bleibt. Das Bemühen nämlich, den Mitmenschen dazu zu bringen, daß er sich verträglich verhält, stößt auf Begebenheiten, die diesem Anliegen eklatant entgegenwirken, Die Rede ist von Ungerechtigkeiten und Mangelerscheinungen.
Es geht unfair zu in der Welt. Zum einen werden Mitmenschen durch von den Regierenden geschaffene Verhältnisse drastisch benachteiligt oder psychisch verletzt. Zum anderen sind die Mittel und Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, für die Menschen sehr ungleich verteilt. Noch nie war die Kluft zwischen den Armen und den Reichen in der Welt so groß wie heute.
Weltweit haben inzwischen fast zwei Milliarden Menschen nicht ausreichend Zugang zu Trinkwasser. Und die Vereinten Nationen rechnen damit, dass sich diese Zahl in wenigen Jahren verdoppeln wird.
Je nachdem, wer die Zählung vornimmt, hungern derzeit etwas mehr oder etwas weniger als eine Milliarde Menschen, mithin etwa jeder siebente Mensch auf der Erde. Jedes Jahr sterben annähernd neun Millionen Menschen, hauptsächlich Kinder, an Hunger, was einem Todesfall alle drei Sekunden entspricht (Wikipedia).
Ob, wer des Trinkwassers oder der Nahrung enträt, sich dauerhaft dareinfinden wird, das Verdursten oder Verhungern widerstandslos hinzunehmen, darf hinterfragt werden. Zumal die neuen Medien jedermann wissen und sehen lassen, daß dort gepraßt, während hier gedarbt wird.
Gegenüber einer Zurücksetzung, die keine Berechtigung, aber arge Auswirkungen hat, sowie gegenüber einer nicht selbst verschuldeten Bedrängnis, deren Verursacher dingfest zu machen sind, dürfte mit Friedenserziehung wenig auszurichten sein. Hier wird die Aufforderung an den einzelnen, sich zu fügen, zur Absurdität. Gegen offensichtliche Benachteiligung als Ursache zu erleidender Not ist kein Erziehungskraut gewachsen. Gegen den Ingrimm der Zurückgesetzten mit der Friedenspalme zu wedeln, macht nur für diejenigen Sinn, die aufgerufen sind, aber es nicht fertigbringen, die Ungereimtheiten zu beseitigen.
Gegen Ungerechtigkeit, Benachteiligung und Erniedrigung, gegen Not und berechtigte Angst ist mit Belehrung und Druck schwerlich etwas auszurichten. Wenn es nicht gelingt, die Anlässe für die Beklemmungen zu beseitigen, wird der Ruf nach Aggressionsabbau und Abrüstung weiterhin ungehört in der Wüste verhallen.
Wer demnach Frieden haben will, wird mehr tun müssen, als an Um- und Nachsicht zu appellieren. Wo eine Drangsal vorliegt, ist mit Beschwichtigung und Belehrung kaum etwas zu bestellen. Erneut gerät das Umfeld in den Blick.
Die hier vorliegende Frage ist, wer oder was verursacht die stattfindende Verwüstung und Zerstörung. Wer oder was bringt die Menschen gegeneinander auf? Wer oder was läßt sie Mitmenschen töten und Kulturgüter vernichten?
Reine Angriffslust ist beim Menschen äußerst selten anzutreffen. Haß und Wut gehören ebenfalls nicht zu seinen hervorstechenden Neigungen. Wo er von sich aus zur Waffe greift, will er in der Regel eine Not beenden oder eine Erniedrigung. Diese Widrigkeiten aber setzt nicht der Mensch als einzelner in Funktion. Wer oder was ihn damit belastet, ist der wahre Schuldige.
Der akut anstehende Sachverhalt läßt sich wie folgt beschreiben:
Der Mensch, an den sich die Anforderung richtet, Frieden zu halten, weiß, daß er selbst dazu nicht angehalten werden muß. Vom Krieg zu lassen, ist für ihn kein Problem. Nichts ist ihm mehr wert als eine Lage, die keinen Beweggrund gibt für Wut und Widerwehr.
Wo Gewaltneigung auftritt, liegt eindeutig eine Veranlassung vor. Der abzuhelfen aber hat der einzelne kaum eine effektive Möglichkeit.
Wohl gibt es Hilfsorganisationen, denen der einzelne sich anschließen kann. Ihnen haben die Menschen, wo die Not am größten ist, unbestreitbar viel zu danken. Die privaten Initiativen aber können gegen die Ursache der Drangsal nichts ausrichten. Auf die Entscheidungen, die zur Behebung der Not nötig wären, haben sie keinen und ihre Unternehmungen wenig Einfluß.
Sodann gibt es einige Aktionsgruppen, die gegen eine der bedrückenden Erscheinungen etwas auszurichten versuchen. Dazu gehören viele Nichtregierungsorganisationen (NGO). Von diesen haben einige auch Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen erlangt. Ihre Einwirkungsmöglichkeiten jedoch sind auf Warnungen und Moralappelle beschränkt.
Wenn demnach die Unzuträglichkeiten und Bedrohungen nicht beseitigt werden, dann ist dies berechtigt nicht dem einzelnen Mitmenschen anzulasten. Seine Stimme, sein Begehr, sein Wollen geht unter, nicht etwa in der Masse anders Fühlender oder anders Denkender. Davon kann keine Rede sein. Der Wunsch nach Frieden, nach Linderung der Not dürfte von der überwältigenden Mehrheit seiner Zeitgenossen geteilt werden. Sein Verlangen verliert sich bei den Umständen, die ihn umgeben.
Unverkennbar verantwortet nicht der Mensch als einzelner, was seine Gattung in Bedrängnis bringt. Er kann weder allein, noch gemeinschaftlich mit anderen die Not und die Beklemmungen aus dem Weg räumen. Er ist darauf angewiesen, daß diejenigen, die die Möglichkeit haben, das große Geschehen zu beeinflussen, das Nötige tun. Augenfällig hängt das Geschick seiner Gattung platt und banal ab vom guten Willen derer, die in der Welt das Sagen haben.
Nun könnte man meinen, daß Einsicht und Wille bei der Mehrheit der Mächtigen durchaus vorhanden seien. Möglicherweise ist dies sogar der Fall. Gleichwohl bleibt aus, was nötig ist. Die erforderlichen Übereinkünfte und Maßnahmen werden nicht getroffen. Was steht da neuerlich im Weg? Was legt nun wieder die Entscheider lahm? Was veranlaßt sie gar, das dem Nötigen Entgegengesetzte zu vollziehen?
Es muß etwas geben, das die Bemühungen derer, denen das System alle Macht verleiht, durchkreuzt. Die Regierenden erwirken Mäßigung und Frieden nicht, selbst dann nicht, wenn sie besten Willens sind. Ihnen sind offensichtlich die Hände gebunden. Diese Fessel kann ihnen nur die Einrichtung anlegen, der zu dienen sie sich verpflichtet haben. Was sich ihnen in den Weg stellt, muß aus dem Wesen jener Agentur kommen, deren Besonderheiten alles Handeln der Hoheiten bestimmt.
Sollte nicht der Mensch, sondern die gegebene Ordnung Schuld tragen an den verhängnisvollen Entwicklungen? Sollte Ronald Reagan recht gehabt haben, als er hellsichtig konstatierte: „Die Staaten sind nicht die Lösung der Probleme. Die Staaten sind das Problem“? Könnte es sein, daß nicht die Regierenden haften für das, was da schief läuft? Könnte sie das System zwingen, sich in der gezeigten Weise zu verhalten? Könnte für die fatale Entwicklung in der Welt in Wahrheit die Form verantwortlich sein, in der sich die Menschheit organisiert hat?
Wir durchschreiten jetzt ein Tor, durch das niemand ohne Zögern geht. Wir betreten geheiligtes Gelände. Hochverrat, das schlimmste aller Verbrechen, liegt in der Luft.
Der Staat, das sind wir, hat man uns beigebracht. Nur gemeinsam sind wir stark. Der Staat gibt uns Halt und Kraft. Ohne ihn fielen wir ins Nichts.
John Locke verlieh dieser Anschauung die akademische Weihe. Ihm zufolge hätten wir ein Übereinkommen geschlossen mit dieser Einrichtung, den vielgerühmten „Gesellschaftsvertrag“. Für die Gewalt über uns verlangten wir vom Staat, daß er die Dinge, die uns alle gemeinsam angehen, für uns erledigt. Denn jeder für sich allein, das versteht sich von selbst, ist nicht in der Lage, dem gewünschten Gemeinwohl zur Wirksamkeit zu verhelfen.
Doch das Gemeinwohl, darum geht es. Gegenwärtig steht nichts Geringeres auf dem Spiel als die Fortexistenz der Menschheit.
In Anbetracht dessen, sollte man meinen, nähmen die Staatsregierungen sich dieser Sache ernsthaft an. Vielleicht darf man bei einigen von ihnen tatsächlich entsprechende Bemühungen wahrnehmen. Wie beklagt aber, bleiben die nötigen Schritte und Maßnahmen aus. Reagans Verdacht, daß die Krux möglicherweise nicht bei ihnen, den ins Amt gesetzten Damen und Herren, liegt, sondern im System, drängt sich förmlich auf.
So ungebührlich es ist, die Frage kann nicht ausbleiben: Liegt das Gemeinwohl beim Staat wirklich in guten Händen? Erfüllt er seinen Teil des Vertrags?
Wo ist anzusetzen, um das höhere Leben auf der Erde zu retten, beim ohne Zweifel schuldigen Menschen oder vielleicht vorweg bei dem Ordnungsmuster, das dessen Verhalten bestimmt?
Der Staat trat wohl mit der Seßhaftigkeit unserer Vorfahren in die Welt. Auch der allmählich erkannte Vorzug der Arbeitsteilung begünstigte seine Errichtung. Häufig jedenfalls, wo diese Errungenschaften eine gewisse Beständigkeit erreicht hatten, erschien er auf der Bildfläche.
Viele meinen, Ackerbau und Arbeitsteilung hätten eine übergeordnete Obrigkeit bedingt. Das indessen ist schwerlich tatsächlich der Fall. Denn beides funktionierte damals und bis zum heutigen Tag auch ohne Regelung von oben. Es ist daher wohl eher so, daß jene Gegebenheiten die Errichtung der Staaten erst ermöglichten.
Genau genommen ist eine Notwendigkeit für die Etablierung dieser Gebilde nicht erkennbar. Viele Völker kommen bis heute ohne eine reglementierende Hochinstanz aus. Die Eidgenossen beugen sich der ihrigen nur, weil das Umfeld sie dazu zwingt. Die Gründung der Staaten ist wahrscheinlich jeweils lediglich dem Willen eines Einzelnen oder einer kleinen Gruppe entsprungen. Denn zu herrschen, das hat Charme.
Von epochaler Bedeutung aber ist, daß diese Institution umgehend etwas in die Welt setzte, das die Menschheit vorher nicht gekannt hatte.
„Nach meinen Daten“, sagt der Ethnologe Jürg Helbling von der Universität Luzern, „lag die kriegsbedingte Mortalität über weite Strecken der Menschheitsgeschichte praktisch bei null. Die frühen hochmobilen Jäger- und Sammlergruppen bekriegten sich kaum oder gar nicht.“ (Gemäß Süddeutscher Zeitung vom 21./22. April 2012 auf Seite 24).
Diese Begebenheit bestätigt eine Studie des amerikanischen Anthropologen Douglas Fry und des schwedischen Entwicklungspsychologen Patrik Söderberg. Ihnen zufolge kommt es seit je her innerhalb von Gruppen zu Tötungsdelikten. Daß aber ganze Gruppen gegeneinander ins Feld ziehen, sei äußerst selten festzustellen. Es gebe noch heute Stämme in Afrika und in Asien, die sich noch nie mit Krieg, dem systematischen Kampf zwischen Gruppen, beschäftigt haben (Die genannten unter dem Titel „Krieg liegt uns nicht im Blut“ in Science, Bd. 341, Seite 270, 2013).
Eine weitere Erhärtung dieses Sachverhalts geben die Anthropologen Joachim Burger und Ruth Bollongino von der Universität Mainz (in Science online im September 2011). Ihnen zufolge lebten die Jäger und Sammler mit den vor 7500 Jahren in Mitteleuropa eingewanderten Ackerbauern in friedlicher Nachbarschaft, wahrscheinlich über drei Jahrtausende hinweg. Beide Gesellschaften hätten sich eindeutig gekannt: Wildbeuterfrauen hätten Bauern geheiratet. Sie hätten ihre Toten am gleichen Ort begraben. Schwerwiegende Konflikte zwischen den Gruppen aber hätten offenbar nicht stattgefunden. Wahrscheinlich weil sie unterschiedliche Lebensräume beansprucht hätten.
Auch hat es in den Äonen vor der Zeitrechnung durchaus Zusammenführungen von Menschen zur Erfüllung eines gemeinsamen Wunsches oder Ziels gegeben, wie unter anderem die Errichtung von Stonehenge beweist. Hier haben Mitglieder einer egalitären Gesellschaft eine beachtliche Gemeinschaftsleistung vollbracht. Die von der Welt noch wenig wissenden Jäger und Sammler im Süden Englands vermochten über Jahrtausende hinweg schwerwiegende Konflikte untereinander zu vermeiden. Statt ihre Pfeile und Speere gegen einander zu richten, legten sie gemeinsam mit primitiven Mitteln Kilometer lange Prozessionsstraßen an, daneben über Jahrhunderte gemeinsam genutzte Begräbnisstätten und ein gewaltiges Heiligtum. Sie kannten offensichtlich Priester und Baumeister, aber keine Könige.
Daß ein Herr A einem Herrn B den Schädel eindellt, das hat es gegeben – wie bezeugt -, seit der Mensch einen Knüppel schwingen kann. Und das wird sich, wie man annehmen muß, weiterhin zutragen, solange es Menschen gibt, in jeder denkbaren Daseins- und Gesellschaftsform.
Mit der Unterwerfung unter eine Herrschaft aber, mit dem Staat kommt Krieg in die Welt.
Zum grundlegenden Selbstverständnis des neuen Gebildes gehörte von Anfang an, quasi unabdingbar, nicht nur herzuzeigen, was ihm eigen ist, sondern auch, es zu gebrauchen. Macht verführt, geradezu unwiderstehlich, sie zu demonstrieren – und sie anzuwenden, wenn ein Vorteil lockt.
Staat muß sich als wehrhaft darstellen. Zugleich aber weckt er die Sucht seiner Vorstände nach Vergrößerung des Machtbereichs. Dafür wiederum braucht er Leute, die das dazu geeignete Handwerk beherrschen. Damit hatte die Stunde des Militärs geschlagen. Seither tritt eine auf Menschentötung bewaffnete und trainierte Streitmacht auf den Plan und in Aktion. Staat und Streitkräfte verschmolzen umgehend zu einer unzertrennlichen Einheit.
Seither gibt es „Geschichte“. Seither fallen organisierte Massen von Menschen über einander her, richten Tod und Zerstörung an. Erst mit der Fremdbestimmung, mit dem Staat stellt sich Gefahr ein für Leib und Leben in großem Umfang durch Mitmenschen. Vor allem aber, erst mit seiner Existenz töten Menschen nicht aus Wut oder Haß, sondern wider Willen, auf Befehl.
Aus der Sicht der neuen Untertanen freilich hatten Herrscher und Heer eine eindeutig eingeschränkte Aufgabe. Indem sie der Staatsgründung zustimmten, das liegt wohl auf der Hand, ging es ihnen darum, andere Gewalthaber von dem Beutegang gegen sie abzuhalten und, sollte die Abschreckung versagt haben, ihnen den Erfolg zu verwehren.
Dieser Selbstbeschränkung indes hat sich kein Staatsoberhaupt je über einen längeren Zeitraum unterworfen. Kaum eine Generation von Staatsbürgern ist ohne das Erlebnis eines von der eigenen Obrigkeit heraufbeschworenen Gewaltakts geblieben. Als „groß“ apostrophierte Herrscher zeichneten sich sämtlich durch Kriegszüge aus.
Doch von Anbeginn an verstanden es die Befürworter der neuen Einrichtung, die Überzeugung wachzurufen, als sei allein dieses Gebilde imstande, das Verlangen nach Frieden, nach Sicherheit vor Krieg zu befriedigen. Die Methode, einen Verdruß zu erzeugen und zugleich auf dessen Beseitigung das Monopol zu erwirken, ist offensichtlich schon früh erfunden worden.
Dennoch konnte diese Einrichtung Jahrhunderte überdauern. Die Unstimmigkeit wurde ihr nicht und wird ihr noch heute nicht verargt, wo Schild und Schwert zu Killerdrohnen sich gemausert haben. Das erinnert unwillkürlich an Platons Höhlengleichnis. Der Mensch weigert sich, Realitäten wahrzunehmen, die dem widersprechen, an das er – absichtsvoll – gewöhnt worden ist.
Nach Heraklit ist Krieg aller Dinge Vater, aller Dinge König.
Unverkennbar schaffen Waffengänge Veränderungen. Nachdem sich der Pulverdampf verzogen hat, sieht die Welt anders aus. Unter den Umgestaltungen, das läßt sich nicht bestreiten, waren ehemals auch solche, die für den Sieger und dessen Untertanen einen Vorteil erbrachten - wenn man denn sozialen oder ökonomischen Nutzen gegen Tod und Verderben aufwiegen kann. Und er regt den Geist an: Hat der Krieg das Rad erfunden? Vom Heldentum ganz zu schweigen. Heraklit: „Die einen macht er zu Sklaven, die anderen zu Freien“.
Die Gegenwart aber läßt davon nichts mehr übrig. Was seinen Nutzen anbelangt, kann kein moderner Krieg ihn gegen den Schaden aufwiegen, den er verursacht. Überdies hat die Sache eine Wendung ins Irrwitzige genommen. Militärischer Erfolg nämlich hängt neuerdings nicht mehr von der Genialität der Generäle ab oder der Tapferkeit der Truppe, sondern von technischen Gegebenheiten. Das Kriegsgeschehen ist völlig aus den Fugen geraten. Es begann mit der Kernspaltung und explodiert jetzt mit der Digitalisierung. Das Menschliche ist aus dem Krieg völlig entschwunden.
Die Hochrüstung der großen Staaten ist so weit gediehen, daß Krieg unter ihnen seine Denkbarkeit verloren hat. Zum einen ist die Explosionskraft der Sprengköpfe so gewaltig geworden, daß, sollte der Inhalt der Arsenale in Gebrauch kommen, auf der Erde kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Zum anderen sind die Einsatzmittel neuerdings von einer Art, die sie der menschlichen Einflußnahme weitgehend entzieht. Nachdem der Krieg eröffnet worden ist, können die Generäle Golf spielen gehen. Was auf dem Feld geschieht, bestimmt allein das Instrumentarium. Da gehen nur noch Automaten auf einander los, bis auch ihnen der Input ausgeht. Der Krieg hinterläßt nicht mehr nur noch Verlierer. Es bleibt überhaupt niemand und nichts mehr übrig.
Krieg deshalb darf nicht mehr stattfinden. Das macht die Frage relevant, ob erwartet werden darf, daß die Staatsoberhäupter das, was sie bisher nie haben einhalten wollen oder haben einhalten können, fürderhin gewährleisten werden. Sind die Regierungen in Anbetracht der neuen Lage dahin zu bringen, daß sie bei Vorliegen einer Veranlassung entgegen ihrer bisherigen Gewohnheit darauf verzichten werden, eine militärische Lösung zu suchen? Werden sie sich zur Selbstgenügsamkeit verpflichten? Werden sie neuerdings dauerhaft der Verlockung widerstehen, den Vorteil ihres Staates gewaltsam im Außenbereich zu decken?
Friede ist nötig. Krieg war ohnehin selten jemals die bessere Lösung. Jetzt scheidet er als solche vollends aus. Friede ist unabdingbar geworden, weil Krieg, wenn er die Großen erfaßt, das höhere Leben auf der Erde beendet.
Das versetzt die Menschheit in eine conditio sine qua non, in eine Lage, aus der es nur einen Ausweg gibt: Die Menschheit muß die Anlässe beseitigen, die die Anwendung von Gewalt heraufbeschwören. Gefordert ist, die Zerwürfnisse, die zwischen ihren Gemeinschaften anstehen, dauerhaft aus dem Weg zu räumen. Denn solange Kriegsgründe auftreten, auftreten können, ist an Entwaffnung nicht zu denken, bleibt der Orlog die latent lastende Existenzbedrohung der Menschheit.
Es gibt sicher selten einen Sachverhalt, der eindeutiger nur eine Konsequenz zuläßt. Indes, so utopisch die Anforderung anmutet, bleibt sie unerfüllt, wird es still werden auf diesem Globus.
Die Politiker freilich verdrängen diese Unabdingbarkeit. Das machen NATO-Entscheidungen deutlich. Selbst strategische Überlegungen der Deutschen Bundesregierung laufen ihr zuwider (Siehe dazu das Positionspapier Rußland der CDU/CSU- Fraktion im Deutschen Bundestag vom 29.11.2016). Und die USA rüsten gewaltig auf und lassen ihre Dickschiffe vor allen Küsten kreuzen.
Nun ist ja der Gedanke, den Krieg zu verhindern, nicht neu. Er kam schon zu Zeiten des dunklen Deuters aus Ephesos auf. Dem seinigen Urteil entgegen, meinten schon damals mehrere seiner Zeitgenossen, daß es eigentlich nicht im Interesse des Bauern, Handwerkers und Händlers liegen könne, fortgesetzt seine Felder, Werkstatt oder Laden verlassen zu sollen, um anderwärts irgendwelchen Mitmenschen den Schädel einzuschlagen. Zumal das Kampfgeschehen schon damals – Heraklit widersprechend – sich auch für die siegreich Überlebenden nur selten als nutzbringend erwies.
Seine damaligen Auchdenker Solon, Kleistenes, Perikles schlossen daraus, daß, wenn man das gegenseitige Abschlachten unterbinden wolle, man dem Bürger das Sagen geben müsse. Ihnen war klar, daß nicht der Mensch als einzelner maßgebend ist für das Gewaltgeschehen, sondern daß dies in der Natur der Ordnungsform liegt, die er sich gegeben hat.
Der Staat ermöglicht es, Massen zu manipulieren und sie gegen andere ins Feld zu führen, und er verleitet dazu - es sei denn, so der neue Gedanke, nicht ein Herrscher schwingt das Zepter, sondern das Volk hat das Sagen.
Die Erfindung der Demokratie war dem Frieden gewidmet. Was hier Gestalt gewann, war die Überzeugung, dem Bürger wohne eine natürliche Abneigung gegen gewaltsame Auseinandersetzungen inne. Wo er bestimme, was geschehen soll, käme Friedfertigkeit zum Zug. Krieg stehe im Widerspruch zum Wünschen und Wollen des Souveräns dieser Staatsform.
Diese Vorstellung trat mit den Begründern der Vereinigten Staaten von Amerika in die Neuzeit. Die Verfassung der USA ist die erste, die sie widerspiegelt. Folgerichtig verpflichtete einer ihrer ersten Präsidenten, James Monroe, das junge Gebilde, sich aus allen Konflikten herauszuhalten, die in der Welt (außerhalb der neuen!) stattfänden.
Doch die USA wurden ein Staat, ein großer, ein mächtiger Staat. Und große Staaten, das liegt offenbar in ihrer Natur, kommen nicht umhin, in der Kakophonie der Konflikte den ihnen entsprechenden Part zu spielen.
Nach den beiden Weltkriegen traf die neue Supermacht auf den Kommunismus. Der hatte es darauf angelegt, an die Stelle der wohlmeinenden Demokratie die Diktatur des Proletariats zu setzen. Nicht ohne Blessuren gelang es der neuen Weltmacht, die hiffen Heilsbringer in die Schranken zu weisen.
Inzwischen treten „Schurkenstaaten“ auf den Plan (wenn man der Diktion des Altpräsidenten George W. Bush folgen will). Dabei handelt es sich um Länder, deren Lenker bewußt die Mehrheitsmeinung ignorieren (die auch nicht immer von Lauterkeit geprägt ist), und sich erlauben, Recht oder Vorteil auf eigene Weise zu suchen. Dabei berühren sie naturgemäß die Belange ihrer Nachbarn, zumeist nicht nur dieser.
Überwiegend ist es so, daß diejenigen Staaten, auf die jene Aussage zutrifft, keine Demokratien sind, oder, wenn doch, noch recht unfertige. Das festigt die Überzeugung, es gelte, überall die Demokratie durchzusetzen. Wenn alle Staaten zu Demokratien gewandelt seien, wenn überall der Bürger das Sagen habe, so die einleuchtende Erwartung, gerate der Friede nicht mehr in Gefahr.
Die Außenpolitik aller Rechtmeinenden ist diesem Ziel gewidmet.
Entsprechend stellt sich das Modell Zukunft wie folgt dar: Die Staatsgebilde, die die neuere Geschichte hat entstehen lassen, der „status quo“, ist von allen Staaten anzuerkennen. Jeder von ihnen hat sich mit den politischen Grenzen, die ihm gegenwärtig zugebilligt werden, zufriedenzugeben.
Als Staatsform hat die repräsentative Demokratie zu gelten. Verfassung und Regierung haben die Menschenrechte zu achten, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen festgelegt sind.
Zur Durchsetzung dieser Weltordnung geziemt es den regierenden Demokraten, friedliche Mittel anzuwenden. Einleuchtenderweise läßt sich das kaum anders bewerkstelligen als durch Unterstützen von Bewegungen, die sich in ihrem Staat für die Umwandlung zur Demokratie einsetzen.
Nun bieten sich aber in den Autokratien neben lauteren auch recht zweifelhafte Gruppierungen mit dem geforderten Vorsatz an. Die rechtdenkenden Regierungen auf der anderen Seite haben vermeintlich nicht die Möglichkeit, allzu wählerisch zu sein. Geld und Waffen daher fließen auch an Bruderschaften, die recht eigenwillige Ziele haben.
In den zu wandelnden Staaten andererseits widersetzen sich die Inhaber der Macht dem Ansinnen, von ihr zu lassen, gemeinhin, zumal die Zumutung unverkennbar aus der Fremde geschürt wird. Es kommt zu Gewalt und Gegengewalt. Damit steht die angezeigte Strategie vor der Beantwortung der Frage, ob zur Durchsetzung der Demokratie die Anwendung militärischer Gewalt gerechtfertigt sei.
Moral und Politik, ein wiederkehrendes Dilemma. Die wohlgesinnte Absicht trifft auf harte widerstreitende Fakten. Im allgemeinen muß das Feingefühl da zurücktreten.
Die Regierungen der wohlmeinenden (westlichen) Staaten geben vor, ihre Streitkräfte vorwiegend nur mehr dazu verwenden zu wollen, Demokratie und Menschenrechte durchzusetzen.
Diese außenpolitische Doktrin indessen erfordert, sich über das Prinzip der Staatssouveränität und das der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates hinwegzusetzen.
Die Realpolitik überdies verlangt, sich bei diesem Vorhaben auf diejenigen Staaten zu beschränken, denen man gefahrlos beikommen kann. Was die Großmächte mit ihren Minderheiten und Systemgegnern anstellen, darf den Feinsinn der dieserart erleuchteten Friedensfreunde nicht berühren. Den Kleinen aber ist Mores zu lehren.
Darüber hinaus dürfen die rührigen Regierungen bei alledem ihre wirtschaftlichen Interessen nicht aus dem Auge verlieren. Gerade in den Demokratien müssen die Mächtigen acht geben, daß die Unternehmen ihres Landes keinen Schaden erleiden.
Am Rande spielt auch eine Rolle, was in der eigenen Innenpolitik Geltung gewonnen hat. Unter anderem gehört dazu, die Gleichheit der Geschlechter herbeizuführen. Das moderne Menschenrecht verlangt, die Frauen wegzubringen von Haus und Herd. Sie gehören unverschleiert und unbenachteiligt an die Schreibtische und Werkbänke. Selbst an die Gewehre wollen und sollen Frauen. Sie sollen auch in den Krieg ziehen dürfen und Feinde niedermähen.
Was als Folge der vielschichtigen staatsimmanenten Bestrebungen zur Wirkung kommt, ist in den Regionen der Welt zu besichtigen. Kulturgüter werden zerstört, Tausende Menschen werden getötet oder zu Obdachlosen gemacht, Flüchtlinge ergießen sich über den Norden Europas und Amerikas.
Der ehemalige Finanzminister der USA, Paul Craig Roberts, deckt eindrucksvoll auf, was die amerikanischen Regierungen der letzten Jahre in Wahrheit in der Welt veranstalteten (Siehe http://www.paulcraigroberts.org). Der Ex-CIA- Agent, Kevin Shipp, schildert in einem Vortrag (gehalten am 7. Januar 2018. Nachzulesen unter www.kla.tv/11729.), in welchem Ausmaß seine Behörde das politische Geschehen destruktiv beeinflußt. J. Michael Springmann, ebenfalls Ex-CIA Agent, behauptet, die USA kreierten ihre eigenen Feinde (in seinem Buch „Die CIA und der Terror“, Kopp Verlag , 2018). Viele Terroristen seien von der CIA ausgebildet oder mit Waffen und Sprengstoff versorgt oder gegen ihren Willen benutzt worden.
Der britische Diplomat Carne Ross kündigte 2004 seinen Dienst, trotz für ihn bester Karriereaussichten. Er konnte, wie er im Internet ausführt, die verhängnisvolle Verlogenheit seiner Regierung nicht länger ertragen. Um die gleiche Zeit beging David Kelly, ebenfalls britischer Diplomat, Selbstmord. Er war, nach Darstellung einer Wahrheit, von der britischen Regierung grob verunglimpft worden.
Der führende deutsche (SPD-)Politiker Egon Bahr erklärte Ende 2013 vor Heidelberger Schülern: „In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie und Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das! Egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.“
Das Modell Zukunft schlägt die ethnischen, religiösen und sozialen Ansprüche der Bürger in den Wind. Schon das ist nicht ganz unbedenklich. Darüber hinaus aber erhebt sich die Frage, ob die etatistische Demokratie überhaupt hält, was sich alle Welt von ihr verspricht. Ist es wirklich so, daß im modernen Rechts- und Sozialstaat die Völker- und Menschenrechte einen verläßlichen Gewährleister haben? Gibt die herausgebildete Form der Demokratie Brief und Siegel, daß sie Krieg, den äußeren, wie den inneren, zuverlässig dauerhaft eliminiert?
Ist die Demokratie der Neuzeit fürwahr der Schlüssel, der die Zukunft öffnet?
Nehmen wir einmal an, das Ziel, auf das die politischen Anstrengungen aller Wohlmeinenden gerichtet sind, sei erreicht: alle Staaten seien Demokratien. Wäre damit die Zukunft der humanen Zivilisation gewährleistet?
Außenpolitisch wäre jetzt Abrüstung angesagt. Die Staaten müßten sich dessen begeben, was sie seit ihrer Entstehung ausmacht. Sie waren gehalten, sich in ihrem Umfeld zu behaupten, etwas Machtvolles darzustellen. Das war ihr Sinn. Von dem wäre fürderhin zu lassen.
Kann dem entsprechend eine Regierung unbeschadet auf den Nachdruck verzichten, den ihr bei erforderlichen Verhandlungen eine schlagkräftige Truppe vermittelt?
Der totalen Entwaffnung im übrigen steht eine Erfahrung entgegen, die die Staaten seit ihrer Frühzeit mit sich herumschleppen, diejenige, daß unter ihnen stets der stärkere recht hat.
Diese Weisheit schwingt unverkennbar latent bei der Begründung dafür mit, daß die Musterdemokratie dieser Welt die gewaltigste Militärmaschine unterhält. Denn von ihren Nachbarn hat sie nichts zu fürchten.
Die US-Regierungen geben vor, ihrem Staat sei die Aufgabe der Ordnungsmacht zugefallen. Diese Obliegenheit bedinge das präsentierte Potential.
Ohne Zweifel hat diese Auffassung eine gewisse Berechtigung. Doch wie stünde es damit auf einem vollständig von Autokratien befreiten Globus? Benötigte die Welt der vereinten Demokratien nach wie vor einen militärisch potenten Ordnungshüter?
Möglich ist, daß die Staaten, selbst von Militär entblößt, die von den USA ausgeübte Polizeigewalt in der demokratischen Welt zunächst als nötig und zuträglich erachteten. Mit der Zeit aber wird die einseitig vergebene Allmacht von vielen wahrscheinlich doch als Bedrohung empfunden werden. Ist dann zu erwarten, daß die USA sich ihrer schimmernden Wehr entledigten?
Der allgemeinen Abrüstung steht ein weiterer Gesichtspunkt entgegen:
Den Staaten haftet eine Eigenschaft an, die ihnen nicht zu nehmen ist, sie sind enorm selbstsüchtig. Ihre Obwalter, die demokratischen noch mehr als die autokratischen, müssen das Wohl ihrer Mitbürger im Auge haben. Die Regierungen können sich nur halten, wenn sie ihren Anhängern fortlaufend bessere Lebenschancen vermitteln. Außerdem sind die Staatsregierungen den Gegenwärtigen ihrer Anvertrauten verpflichtet, nicht etwa der kommenden Generation und schon gar nicht der Menschheit als ganzer. Sie haben den Nutzen ihrer aktuellen Mitbürger zu mehren. Demokratische Politik deshalb ist gekennzeichnet durch Unbedenklichkeit sowohl gegenüber der Erhaltung der Natur und der Ausbeutung der Ressourcen, als auch gegenüber den Ansprüchen und Bedürfnissen der Menschen nach und neben ihr. Uneigennützigkeit widerspricht dem Wesen der Demokratie.
Die Demokratie als Staatsform nötigt diejenigen, denen sie Macht verleiht, zur bedenkenlosen Vorteilssuche für diejenigen, die sie tragen. Das macht sie zuvorderst zur Gebietsfetischistin.
Benachbarter Raum weckte schon immer die Begehrlichkeit der Staatenlenker. Er gewinnt mit der Verknappung des nutzbaren Bodens und der Schrumpfung der Rohstoffe vermehrt an Bedeutung. China kauft Land, wo es dies kriegen kann.
Auch demokratisch gewählte Regierungen bleiben auf Erweiterung des Gebiets ihres Staates erpicht. Die USA rissen sich Alaska und Puerto Rico unter den Nagel. Pakistan und Indien kämpfen um Kaschmir. Japan erhebt Anspruch auf die südlichen Kurilen. Dänemark und Kanada streiten um die eisige Insel Hans.
Gegenwärtig reklamieren China, Vietnam, die Philippinen, Malaysia und Taiwan den Besitz winziger unbewohnter Eilande im Ozean, die nur die wenigsten Atlanten kennen, wie die Paracel, die Spratley, die Senkaku Inseln, das Scarborough-Riff. Denn mit der Inhabe dieser Schären ist rechtlich eine Menge Meer verbunden. Und auf dessem Grund sind Bodenschätze aufgeklärt. Hier schmort die Lunte an einem Pulverfaß.
Auch an den arktischen und antarktischen Gebieten melden Demokratien Besitz- oder Ausbeutungsrechte an, darunter die USA und Rußland. Der Streit um die Regionen auf Mond und Mars ist abzusehen.
Im Juni 2016 beschlossen Senat und Kongress der USA, ihrem Land das alleinige Schürfrecht im Weltraum zuzubilligen – im Gegensatz zum UN-Weltraumvertrag von 1967, der dies ausdrücklich verbietet.
Allgemein geht es bei der Landnahme ungerecht zu. Denn die Großmächte haben, allein von ihrer materiellen Substanz her, die besseren Möglichkeiten, sich an den Polen, im Weltmeer, im Weltraum zu bedienen. Den Kleinstaaten bleibt der Schmelz der Genügsamkeit.
Kein Staat kann den Anspruch auf nutzbares Areal aufgeben. Das kann sich keiner seinen Bürgern gegenüber leisten. Vollends unbillig, wenn nicht widersinnig ist es, von einem Staat zu verlangen, daß er sich eines Stücks seines Gebiets entäußere.
Die Ukraine kann die Gebietsverluste, die ihr abverlangt werden, ohne Gegenwehr nicht hinnehmen. Spanien fordert die Angliederung von Gibraltar, denkt aber nicht im entferntesten daran, seine nordafrikanischen Besitzungen, Ceuta und Melilla, an Marokko zurückzugeben.
So, wie die Dinge liegen, muß es den Staaten darum gehen, ihren Gebietsumfang zu erhalten. Deshalb haben sie das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das sie sich nach dem zweiten Weltkrieg mühsam abrangen, durch Beschluß der UN-Vollversammlung von 1970, der sogenannten Prinzipienerklärung, wieder außer Kraft gesetzt.
Denn beibehalten hätte dieses Recht bedeutet, daß Separationsbestrebungen hätte nachgegeben werden müssen. Es hätte verlangt, Tibetern und Tschetschenen, Korsen und Kurden die Selbständigkeit nicht zu verweigern.
Gerade der demokratische Staat kommt nicht ohne Bevormundung und Beglückung aus. Die Erweiterung seiner Zuständigkeit auf alles Vorkommende entzieht mehr Freiheit als jede andere Modalität dieser Agentur. Fremdbestimmung aber sowie die Dominanz eines anderen Volkes, das wird von vielen Angehörigen weniger bevorzugter Gruppen als drückend empfunden. Häufiger als in den alten Monarchien, die ihren Landesteilen oft weitgehend Eigenständigkeit zugestanden, kommt es in der modernen Demokratie zum Bürgerkrieg.
Es gibt kaum eine Demokratie der Neuzeit, die es nicht mit einem Volksteil zu tun hätte, in dem der Gedanke der Unabhängigkeit schmort. Und den Diktatoren gleich ist jede demokratische Regierung gehalten, ihre aufsässigen Minderheiten mit Gewalt wieder unter ihre Botmäßigkeit zu bringen.
Dabei ist für Demokratie die Widerwehr gegen Selbständigkeitsbestrebungen besonders fragwürdig. Ist doch dieser Beschaffenheit vorgeschrieben zu respektieren, was ihre Bürger wollen. Demgemäß müßte sie über Volksabstimmungen in den betroffenen Landesteilen klären, ob die dortige Mehrheit im Staatsverbund bleiben will oder nicht. Darüber indessen befragen die Regierungen, wenn überhaupt, nur die Gesamtheit ihrer Bürger. Hier bewahrheitet sich, was Benjamin Franklin vermutete: Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf über die nächste Mahlzeit abstimmen.
Ein Gebietsverlust ist keinem Staat zuzumuten. In einer Welt, in der selbst die unwirtlichste Gegend und der Meeresboden voller wertvoller Güter stecken, ist der Verzicht auf einen Flecken Erde, den er besitzt oder dessen er habhaft werden kann, für keinen Staat akzeptabel.
Auf die Bewohner kann Staat keine Rücksicht nehmen. Deren Wunsch und Wollen, allemal wenn es um Eigenständigkeit geht, rührt an seine fundamentalen Belange. Staat kann naturgemäß nicht anders, als den Vorteil der Mehrheit seines Volks zu suchen. Wer folglich auf dem jeweiligen Stück Land zuhause ist, diese lästige Beigabe, hat keinen Ärger zu machen. Der Besitz von viel Gebiet ist ein Trumpf, der jede andere Begehr sticht. In einer Zukunft, die den Staaten gehört, gilt dieses Politikgesetz ohne jeden Abstrich.
Ende August 2018 erklärten der serbische und der kosovarische Präsident sich bereit für eine „Grenzkorrektur“. Serbien würde seine kosovarisch bewohnten Gebiete an den Kosovo, dieser seine serbisch bewohnten Gebiete an Serbien abtreten. Diese Absicht fand im politischen Bereich keine Unterstützung, teilweise wurde sie als „extrem unverantwortlich“ qualifiziert. Schließlich könnte das Schule machen.
Für die Zukunft ist bedeutsam, ob jedes der eingegliederten Völker bereit sein wird, seine Identität und das Verlangen nach Selbstbestimmung aufzugeben.
Zur Zeit muß eine Minderheit, die hartnäckig ihre Selbständigkeit einfordert, in Kauf nehmen, ausgerottet zu werden. Mehreren Völkern ist dies schon widerfahren. Die Bedingungen der Zukunft werden den Staatsgewaltigen noch weniger eine andere Wahl lassen.
Staatliche Kleinflächigkeit wohlgemerkt erweist sich zunehmend als bedeutsamer Nachteil. Die Bewohner der kleinen Staaten haben gegenüber denen der großen fernerhin unvermeidlich geringere Aussichten auf gutes Auskommen.
Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Bedarfsdeckung, die der divergierende Gebietsbesitz zur Folge hat, werden die Staaten unvermeidlich gegeneinander aufbringen. Dauerhaftes Zufriedengeben mit geringeren Chancen, gar mit drückender Not wird kein Staat, kein Volk durchstehen. Das gibt dem äußeren Frieden keine Chance.
Eine Zukunft daher, die die Staaten bestehen lassen wollte, müßte sie zunächst einmal alle gleich groß machen mit gleich viel Küsten- und Meeresanteil.
Die Staaten sind darüber hinaus Wirtschaftsenthusiasten.
Nur, wenn Handel und Wandel florieren, kann Staat seinen Säckel füllen. Das ist wesentlicher Grund dafür, daß dessen Amtsträger der Wirtschaft ihr besonderes Augenmerk widmen.
Diese überdies sind abhängig von Wahl und Wiederwahl. Sie können sich nur am Ruder halten, wenn sie die Bedingungen im Land fortgesetzt verbessern. Merkmal der zeitgenössischen Demokratien daher ist der ihren Regierungen auferlegte Zwang, die eigenen Unternehmen stützen zu müssen, vor allem die großen unter ihnen.
Dazu gehört vorrangig, sie vor der Konkurrenz auf dem Weltmarkt zu schützen. Das hinwiederum läßt sich wirksam nur vollziehen, indem man Wälle und Zäune baut, wie Trump dies exklusiv vorführt.
Bleiben die Grenzen offen, muß ein Handelsüberschuß erzielt werden. Den eigenen Betrieben muß es gelingen, mehr Waren ins Ausland zu verkaufen als sie gezwungen sind, von außerhalb einzuführen.
Wird dieser Vorzug verfehlt, bietet sich an, den Import zu begrenzen. Die dazu errichteten Zollschranken jedoch erweisen sich oft auch für die eigene Wirtschaft als nachteilig. Und die Einfuhrbestimmungen der anderen Staaten blockieren den eigenen Export. Gelingt es im Hin und Her, im Für und Wider, die Ein- und Ausfuhrbeschränkungen zwischen zwei oder mehreren Staaten zu beseitigen, wird die entstandene Freihandelszone frenetisch gefeiert.
Ein freier Welthandel wäre wahrscheinlich für alle Volkswirtschaften von Nutzen. Die Staaten aber können von der Subventionierung der ihrigen nicht lassen. Deshalb bleiben alle Versuche, den Handel zu liberalisieren, in den Anfängen stecken. Die Doha-Runde, die sich darum bemühte, scheiterte kläglich.
Viele Regierungen nötigen ihre Notenbank, ihre Währung künstlich herabzusetzen. Das verbilligt die Ausfuhr der eigenen Industrie und verhilft ihr zu einem sonst nicht möglichem Gewinn. Die japanische vollzog dies mehrfach, zuletzt Anfang 2013. Die chinesische betreibt dies permanent.
China, das eigene Äcker vergiftet und seine Wüsten vergrößert, erwirbt Land in anderen Erdteilen, um dort anzubauen, was die Ernährung der eigenen Bevölkerung aufstockt.
Besonders um das Wasser gibt es Streit. Wer den Oberlauf der Ströme innehat, sieht sich zunehmend veranlaßt, diesen Vorteil für die eigene Landwirtschaft zu nutzen. Die Türkei gräbt den Irakern das Wasser ab, Äthiopien den Sudanesen und Ägyptern. Und an der Quelle des Mekong sitzt China.
Der Euro, eine Kunstwährung, die angeblich dazu führen sollte, die europäischen Völker zu verbinden, bewirkt jetzt eher Zwietracht. Dieses Zahlungsmittel erbringt damit das Gegenteil dessen, was von ihm erwartet wurde. Man mag das einreihen, sofern man wohlwollend ist, unter das, was in den Medien unter Verschlimmbesserung firmiert. Beste Absicht verkehrt sich in ihr Gegenteil. „Wir haben es vermasselt“, meint Marc Beise in einem wehleidigen Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 4./5. August 2012, Beilage V2/1.
Doch hier liegt keine Tragik vor. Hier ist wider besseren Wissens, gegen jeden Sachverstand, der reichlich geäußert wurde, gehandelt worden - mit fragwürdigen Begründungen. Als hätte Frieden geschaffen werden müssen, wo es Feindschaft in Wahrheit nie gegeben hat. Um Friedfertigkeit mußte bei den Angehörigen der Völker in Europa wahrlich nicht gebettelt werden.
Doch diesmal wollten die deutschen Politiker eins drauf setzen. Außerdem schuldeten sie ihren Kollegen Dank für deren Zustimmung zur deutschen Wiedervereinigung (wohlgemerkt nicht den Völkern war zu danken, sondern den um ihre Macht oder ihre Reputation besorgten Staatenlenkern. Reines Staatsinterieur). Die Morgengabe der deutschen Politiker aber überfordert das Gemeinwesen, dem sie Rechenschaft schulden. Die fadenscheinige Verheißung der Einheitswährung beschert jetzt ihrem Volk nicht nur einen Vermögensverlust, sondern darüber hinaus Abscheu und Haß ihrer Nachbarn, jene Erscheinungen, die nach den Gräueln des letzten großen Krieges weitgehend überwunden worden waren.
Es gibt eine Menge Anlässe und Gelegenheiten für Handelsstreit. Gerade die Demokratien, eben weil deren Regierungen davon abhängig sind, daß es ihnen gelingt, das Los ihrer Mitbürger zu verbessern, sind dafür besonders anfällig.
Die Politik der USA ist seit dem zweiten Weltkrieg in herausragender Weise auf die Unterstützung der eigenen Wirtschaft angelegt. Das hat Kriege ausgelöst und ist verantwortlich für die meisten chaotischen Verhältnisse, die die Gegenwart beuteln.
Aktuell provoziert die amerikanische die russische Regierung durch wirtschaftliche Sanktionen und Kriegsspiele vor ihrer Haustür. Allein der Langmut des russischen Präsidenten ist es zu danken, daß die Raketen noch nicht fliegen.
Die Staaten sind überdies Umweltignoranten.
Soll die Erde als Lebensraum für die Menschheit erhalten bleiben, müßte jeder Staat auf seinem Gebiet das Nötige dafür tun. Doch derjenige, der dies tatsächlich dezidiert vollzöge, behinderte die eigene Wirtschaft, verursachte Teuerung und vermehrte die heimische Arbeitslosigkeit.
Der Bedachtsame begünstigte obendrein die Wirtschaft der anderen Staaten, ohne daß die eigene Bevölkerung den Vorteil erwirkte, auf den es ihr ankommen dürfte. Denn der Smog kennt keine Grenzen, die Giftfracht der Flüsse und Grundwässer ebenso wenig. Und die Erderwärmung ist nur einzudämmen, wenn alle Staaten ihre Emissionen einschränkten.
Zur Frage somit steht, ob es dauerhaft gelingen wird, jeden Staat, der sich auf Kosten der Umwelt einen Vorteil verschafft, ohne Gewaltanwendung davon abzubringen.
Am Pranger stehen seit langem die USA. Aber wer wollte sie zur Ordnung rufen? Die anderen großen Staaten sitzen selbst im Glashaus.
Zukunft unter Beibehaltung der Staaten nach alledem hätte nicht nur zur Vorbedingung, sie alle gleich groß zu machen, sondern darüber hinaus wirtschaftlich gleich leistungsfähig.
Will die Menschheit überleben, so hatte sich ergeben, muß sie die Anlässe und sodann die Fähigkeit zum Kriegführen beseitigen.
So, wie die Dinge liegen, sind Streitgründe nicht aus der Welt zu schaffen. Die Chancen der Staaten, selbst wenn sie alle Demokratien wären, bleiben ungleich verteilt. Dem einen verschafft der Grad der Entwicklung Vorteile, einem anderen Gebietsgröße und Bevölkerungszahl, wieder einem anderen der Besitz von nutzbarem Boden oder eine Rohstofflagerstätte.
Viele Staaten entbehren sowohl das eine als auch das andere. Noch sind bei vielen Völkern, die am Hungertuch nagen, Sanftmut und Duldsamkeit in erstaunlichem Ausmaß anzutreffen. Ihre Angehörigen nutzen vorerst die Flucht. Mehr und mehr aber wächst auch bei ihnen die Gewaltbereitschaft. Behelfsweise begnügen sich besonders Aufgebrachte vorerst mit Terroraktionen.
Die Regierungen der entwickelten Staaten haben die Wirtschaft und Finanzen ihrer Länder in unterschiedlichem Ausmaß in Unordnung gebracht. Dadurch sind einige Völker in echte Not geraten, während andere noch verhältnismäßig gut dastehen. Von diesen wird Hilfeleistung erwartet. Das jedoch stößt an Grenzen. Denn bei den Bessergestellten macht sich zunehmend Sorge um den eigenen Besitzstand breit. Es ist nicht Neid, eher Ausweglosigkeit auf der einen Seite und Angst vor dem Verlust des eigenen Fundus auf der anderen, was die Völker neuerdings gegeneinander aufbringt. Zu fürchten sind Verzweiflungshandlungen der Notleidenden.
Die Demokratie der Neuzeit, in die Zukunft transferiert, bringt Streitgründe nicht aus der Welt. Ernsthaft daher ist nicht zu erwarten, daß eintritt, worauf sich heute alle Anstrengung richtet, der demokratische Friede.
Die Angst vor Krieg verleitet heute viele Menschen zu dem Bemühen, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen. Sie treten politisch für globale Abrüstung ein.
Das Ansinnen der Friedensaktivisten ist der wehrlose Staat, der Adler ohne Krallen. Als ließe sich der Demokratie die Taube ins Wappen setzen.
Vielen anderen Pazifisten geht es lediglich darum, die Staaten dazu zu veranlassen, auf die schlimmsten ihrer Waffen zu verzichten. Die Atombomben sähen sie gern verschrottet. Vermeintlich schreibt die Vernunft vor, sich mit der Teilentwaffnung zu begnügen. Das Ganze, die vollständige Abrüstung, wird als Utopie erachtet – wohl nicht zu unrecht.
Einige Staaten gehen darauf sogar ein. Sie geben vor, ihren Bestand an Nuklearsprengköpfen zu verringern. Kein Staat jedoch, solange es noch andere gibt, kann auf die potenten Projektile vollständig verzichten, ohne Gefahr zu laufen, seine Abschreckungskraft einzubüßen. Der sich bescheidende Staat braucht einen verläßlichen Bündnispartner, der die hochwirksamen Raketen weiterhin parat hält. Andernfalls verlöre er nicht nur an politischem Gewicht, sondern riskierte auch seinen Bestand.
Die Friedensforschungsinstitute vermelden, daß noch nie so viel Geld für Rüstungsgüter ausgegeben worden ist, wie im Jahr 2011. In den Jahren darauf sind zwar etwas weniger Waffen gekauft worden, aber immer noch mehr als in den Jahren zuvor – und zwar hauptsächlich von Demokratien. Die USA haben 2016 eine Billion Dollar allein für die Modernisierung ihrer Nuklearwaffen ausgegeben.
Ohnehin stellt sich die Frage, macht Reduzierung Sinn? Sollte man den Staaten ein paar Kämpfer und Kanonen lassen? Sollte man der Entsagung frönen: Ein bißchen Krieg darf sein, ein wenig Friede muß genügen?
Möglicherweise könnte die Nachwelt kleine Scharmützel aushalten. Die entscheidende Frage aber ist, ob die großen Demokratien angesichts der bleibenden Differenzen sich dauerhaft mit dem Unterhalten von ein paar Paraderegimentern bescheiden werden.
Und ob, wenn es hart auf hart kommt, die so leicht zu habenden und ebenso leicht zu versteckenden biologischen und chemischen Waffen in den Gängen und Garagen bleiben, ist eine der bängsten aller Fragen.
Ausgangspunkt dieser Erörterung war, ob der Eigensinn des einzelnen Krieg und Zerstörung heraufbeschwört.
Ohne Zweifel gibt es Menschen, die dazu neigen, ihre Interessen mit Gewalt durchzudrücken. Wahrscheinlich sind in jedweder Gesellschaftsform Zeitgenossen zu vermuten, die ungehemmt ihrem Eigensinn frönen. Der Einzelne aber kann keinen Schaden anrichten, der das Ausmaß einer Weltkatastrophe hat (sofern er nicht gerade Chef einer Weltmacht ist). Er kann nicht die gesamte Menschheit in den Abgrund reißen.
Die Gefahr, der diese Zivilisation jetzt ausgesetzt ist, geht eindeutig nicht vom Wesen des normalen Menschen aus. Verschaffte die Demokratie dem von ihr nicht indoktrinierten Bürger wirklich das Sagen, wäre der Friede sicher nicht bedroht.
Jeder Staat, so auch jede Demokratie, muß auf einem Globus, dessen Vorräte schwinden, in außerordentlicher Weise um das Wohl seiner Bürger besorgt sein. Maßhalten und Zurückhaltung kann sich kein Staat leisten. Die moderne Demokratie steigert die Empfindsamkeit und Ansprucherhebung sogar gegenüber den Prätentionen vorangegangener Staatsformen erheblich. Gerade sie schafft aus ihrer Eigenart heraus Sachverhalte, die sich nur gewaltsam lösen lassen.
Die Erdbevölkerung, zu umfangreich für ihren ausgelaugten Planeten, muß dafür sorgen, daß Streit unterbleibt. Friede ist nötig, damit die Tötungsmaschinerie, über die sie verfügt, verschrottet werden kann. Mit den Staaten ist dies nicht zu machen. Dabei ist die Demokratie selbstsüchtiger als alle Herrschaftsordnungen vor ihr.
Der Krieg ist ein Phänomen, das den Staaten unabwendbar innewohnt. Er tritt mit ihnen in die Geschichte, und er wird sie, so viel ist sicher, nur mit ihnen verlassen.