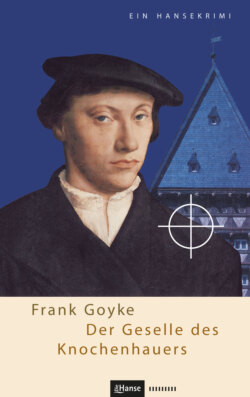Читать книгу Der Geselle des Knochenhauers - Frank Goyke - Страница 10
ZWEITES KAPITEL
Die Freiheit eines Christenmenschen
ОглавлениеAls sich Bruder Eusebius in seiner Zelle im Paulikloster auf die Lagerstatt legte, begann die Welt um ihn zu kreisen. Die Wände und die Decke des engen Raums verwandelten sich zu lebendigen Wesen, in denen Blut floss; anders war doch gar nicht zu erklären, dass sie hin und her, hoch und nieder wogten. Eusebius richtete sich sofort wieder auf. Bruder Balthazar hatte ihn mit zu viel Wein traktiert.
Eusebius stöhnte. Er hatte den guten Rheinwein quasi auf nüchternen Magen genossen, und das bekam nicht einmal dem stärksten Ritter. Obwohl das Rittertum ja quasi – quasi, dachte Eusebius – vernichtet worden war. Jedenfalls quasi ausgeschaltet: Vor zwanzig Jahren, als ein gewisser Franz von Sickingen durch das Heer der Kurfürsten von Trier und der Pfalz und vom hessischen Landgrafen besiegt worden war und tödlich verwundet auf dem Landstuhl starb. Das Rittertum hatte sich einfach überlebt. Niemand brauchte Ritter, wenn man mit Landsknechten auskam. Die wollten nur Geld und keine Lehen. Obwohl, Ritter neigten – wenn sie keine Raubritter waren – eher zur Treue. Quasi. Landsknechte wechselten die Fronten, wenn sie unzufrieden waren. Die kämpften für den, der besser bezahlte. Quasi!
Geld, dachte Eusebius. Geld, Geld, Geld! Er krümmte und streckte seine Zehen. Quasi, quasi, Geld, Geld! Der Augsburger Geldsack Anton Fugger hatte so viel von diesem sündigen Stoff, dass er es sich leisten konnte, den Kaiser zu finanzieren. Ein Augsburger Handelsherr kaufte Kaiser, als wären sie Bergwerke; das musste man sich doch einmal vorstellen! Vermutlich war er der Antichrist.
Ich hätte nicht so viel Wein trinken dürfen. Und das hier ist doch gar nicht meine Zelle!
Es könnte aber seine Zelle werden. Der Prior, der ihn so freundlich als Gast aufgenommen hatte, hätte sicher nichts dagegen, wenn der weit gereiste Eusebius von Braunschweig seinem Konvent beitreten würde.
Immerhin kannte er seine Schrift Des Doctor Luthers Irrtümer von der Gnade Gottes nebst einer Apologie der sieben Sakramente, so notwendig sind für die Erlangung ewiger Seeligkeit. Gedruckt wurde sie ja nicht, während man diesen Luther vertausendfacht hat. Quasi vertausendfacht.
Mein armer, armer Kopf, dachte Eusebius und tippte an denselben. Der weiche Kern unter der harten Schale verfertigte seine Gedanken. Im Moment jedoch war sein Hirn ein Weinfass.
»Was wollte Bruder Balthazar eigentlich von mir?«, fragte Eusebius die Wand, die er anstarrte. Dann erbrach er sich.
»Wer bist du?« Tile Brandis beugte sich vor. Der Wandergeselle stand mit verschränkten Armen vor ihm. Christoph von Hagen hatte ihn nicht ohne Grund in das Verlies gesperrt, das unmittelbar neben dem Einbecker Keller gelegen war. Manche Gefangenen zermürbte es, wenn sie das fröhliche Zechen von nebenan hörten.
Doch der Wandergeselle sah nicht aus, als könne ihn irgendetwas rasch zermürben.
»Ein Geschöpf des Herrn«, sagte er. Das traf zweifellos zu, aber der arrogante Ton forderte Brandis heraus.
»Bist du Protestant?«
»Was ist das?«
»Mir scheint, dass du dir deiner Lage nicht bewusst bist«, sagte Brandis sanft. Ihm war es durch seine Beredsamkeit – und auch weil er einer der reichsten Familien angehörte – gelungen, die anderen Ratsherren und sogar den Proconsul davon zu überzeugen, dass sie sich um die Bettler und den betrunkenen Tagelöhner kümmern sollten, die Christoph von Hagen neben dem Wandergesellen ins Loch eingeliefert hatte. Für sie interessierte sich Tile Brandis nicht. Sie waren verdächtig, weil sie zu den Armen gehörten, aber was bedeutete das schon? Jede Stadt, die er kannte, litt darunter, dass die Schicht der Armen immer größer wurde. Das war eine enorme Gefahr. Und aus diesem Grund befasste er sich mit dem Protestantismus und wollte alles über die lutherische Konfession in Erfahrung bringen. In allen befreundeten Städten hatte sie sich, nach anfänglichen Ausbrüchen von Zorn, als probates Mittel erwiesen, die Gärung der Massen in anständiges Bier zu verwandeln. In ein Bier, das seine außerordentliche Würze obendrein dadurch erhielt, dass man Kirchengüter für die Stadtkasse einzog. Um Glaubensdinge, wie dieser komische Augustiner in Wittenberg wohl noch immer hoffte, ging es längst nicht mehr. Luther träumte, und das fand Tile Brandis durchaus sympathisch. Doch seine Anhänger machten Politik.
Und Politik machte auch Brandis, denn er war Ratsherr.
»Ich erkläre es dir. Auf dem Reichstag zu Speyer Anno tausendfünfhundertneunundzwanzig setzte Ferdinand, unser König und der Bruder sowie Statthalter des Kaisers, das Wormser Edikt wieder in Kraft. Dieses Edikt verhängte immerhin die Reichsacht über Martinus Luther! Außerdem hob Ferdinand jene Passagen eines Reichsabschieds von 1526 … Weißt du, was ein Reichsabschied ist?«
Der Wandergeselle schüttelte den Kopf. Sein Blick drückte nicht das geringste Interesse aus; eher schon schien es, als würde er durch den Ratsherrn hindurchsehen.
»Ein Reichstagsbeschluss«, erklärte Brandis. »Beim ersten Reichstag zu Speyer rechneten alle noch mit einem Konzil, also beschloss man, dass sich jeder Stand gegenüber seinen Untertanen so verhalten möge, wie ein jeder solches gegen Gott und die kaiserliche Majestät hofft und vertraut zu verantworten. Im Grunde bedeutet es, dass jeder Reichsstand – also die Kurund Reichsfürsten, die Reichsgrafen und die Reichsstädte – die Konfession seiner Untertanen selbst entscheiden darf. Eine Art Religionsfrieden, könnte man sagen.«
»Kommt zur Sache, Herr!«, verlangte der Geselle. Tile Brandis fuhr zurück. Das war ja eine unerhörte Frechheit: Ein Mensch ohne Bürgerrecht bot ihm die Stirn und forderte ihn auf, ihm langatmige Erklärungen zu ersparen. Aber Brandis beherrschte sich.
»Wie gesagt, auf dem zweiten Speyrer Reichstag wollte König Ferdinand diese Beschlüsse aufheben, weil ein Konzil nicht zustande gekommen war. Die evangelischen Reichsstände legten aber eine protestatio gegen Ferdinand und seine katholischen Verbündeten ein, und seither nennt man die Martinianer auch Protestanten.«
»Aha.«
»Mehr hast du dazu nicht zu sagen?«
»Ich bin ein einfacher Mann, Herr.«
»Und führst im Bunten Ochsen laute Reden gegen Papst und Reich«, fügte Tile Brandis hinzu.
»Nicht gegen das Reich, Herr, sondern gegen den Kaiser«, sagte der Wandergeselle. Diese Antwort machte Tile Brandis stutzig: Der Mann verstellte sich und war klüger, als es den Anschein hatte. Dass er zwischen Kaiser und Reich unterschied, bewies, dass er über Rechtskenntnisse verfügen musste. Die verfassungsrechtliche Formel Kaiser und Reich setzte die beiden Seiten nicht etwa in eins, sie schied sie voneinander: Kaiserliche und Reichsinteressen waren beileibe nicht mehr identisch. Frankreich und Karl V. führten Krieg gegeneinander, weil sich der französische König aus der Umklammerung durch die Habsburger befreien wollte; alle Landgrenzen Frankreich stießen an habsburgisches Territorium. Der Krieg gegen Franz I. lag aber allein im Interesse des Kaisers, Reichsinteressen wurden von ihm eigentlich nicht berührt. Aber konnte ein Wandergeselle so etwas wissen? Es fiel ja sogar Brandis nicht leicht, es zu durchschauen. War der Wandergeselle am Ende gar keiner, sondern ein lutherischer Prädikant? Die Neugierde des Consuls war endgültig herausgefordert.
»Aus welcher Stadt stammst du?«
»Aus Nordhorn.«
»Und was ist dein Beruf?«
»Zimmermann, Herr.«
»Wie Joseph?«
»Ja, aber ich habe keinen Sohn.« Der angebliche Geselle lächelte. Brandis’ Zweifel wuchsen nur noch. Sogar etwas wie Witz schien der Mann aus Nordhorn zu haben, wenn er denn wirklich aus dieser Stadt kam.
»Was willst du in Hildesheim?«
»Ich suche Arbeit, Consul.«
»Im Bunten Ochsen?«
»Ihr kennt meine Wege nicht, Herr. Kreuz und quer bin ich durch die Lande gezogen, aber niemand brauchte mich. Auch in Hildesheim habe ich bei drei Zimmerleuten vorgesprochen. Und ich beherrsche mein Handwerk. Aber nein, leider kein Bedarf. Ich erhielt ja nicht einmal die Gelegenheit zu zeigen, was ich kann, also musste ich meinen Ärger mit ein paar Bier wegspülen.«
»Um dann gegen den Heiligen Vater zu lästern«, sagte Tile. »Er betrügt uns, Herr.«
»Und der Kaiser?«
»Der betrügt uns auch. Das Reich ist ihm doch schnurz – er kann ja nicht mal Deutsch. Aber Geld will er. Eine Türkensteuer. Was gehen mich die Muselmanen an? Für mich sind sie weit weg. Bei den Hungarn … Wo ist das? Jedermann ist doch der Rock näher als die Hose. Auch Euch, Ratsherr. Oder ist Euch das Magyarenreich wichtiger als Hildesheim?«
»Man darf nicht nur an sich selbst denken«, sagte Brandis ohne große Überzeugungskraft, denn nichts anderes tat er üblicherweise. Seine Familie – und Gott natürlich – bildeten den Mittelpunkt seiner Welt. Gesche war schwanger. Er wünschte sich einen Sohn. Das und seine Geschäfte beherrschten sein Denken sogar mehr als die Ratsangelegenheiten seiner Heimatstadt; insofern hatte der Wandergeselle schon Recht. Aber wenn Tile vor seinem Gedenkbuch saß, zwang er sich zu einem weiten Horizont. Die Nachwelt sollte nicht nur sehen, dass er ein guter Geschäftsmann und ein liebevoller Familienvater gewesen war, sondern auch ein Homo politicus.
»Ihr habt auch keine Arbeit für mich, Herr?«, fragte der Geselle.
»Kennst du die Lovekenstube?«, wollte Tile Brandis wissen; auf die Frage des Gesellen ging er vorerst bewusst nicht ein.
»Wie?«
»Die Lovekenstube?«
»Nein, Herr. Ist das eine Badestube?«
»Allerdings.«
»Mit drallen Bademägden?« Der Wandergeselle lächelte. »Kann man so sagen.«
»Ich kenne sie nicht … würde sie aber gern kennen lernen.«
»Nun, heute ist sie geschlossen«, sagte Brandis. »Aber vielleicht kann man sie morgen wieder besuchen … Wie ist dein Name?«
»Wenzel«, sagte der Geselle.
»Nun, Wenzel, auch ich habe keine Arbeit für dich.« Consul Brandis erhob sich. »Ich habe meine Hände zwar in vielerlei Geschäften, aber das Handwerk der Zimmerleute gehört nicht dazu. Tut mir Leid.« Er begab sich zur Tür und schlug dreimal gegen sie. Wenige Lidschläge später öffnete der Büttel. »Er kann gehen«, sagte Brandis mit einer Kopfbewegung hin zu dem Verdächtigen.
»Was, Herr Consul?«
»Spreche ich so undeutlich? Er ist entlassen.«
»Nicht mal als Knecht?«, fragte der Wandergeselle. »Ich mache alles, selbst die schmutzigsten Arbeiten.«
»Ich habe Knechte«, erwiderte Tile und ging hinaus.
»Tot?«, fragte Johanna von Alfeld. Ihr Gesicht war bleich.
»Ja, tot«, sagte Heinrich. Er hatte nicht die geringste Lust, über den Vorfall in der Lovekenstube zu sprechen. Hunger hatte er, aber die Weinsuppe war längst erkaltet. Heinrich von Alfeld brach sich ein Stück vom Brot.
»Soll ich die Suppe aufwärmen lassen?«, fragte Johanna. »Ich wäre dir sehr dankbar«, entgegnete Heinrich.
»Nun, dann sage ich der Magd Bescheid.« Johanna blieb aber sitzen. Weiber waren nun mal furchtbar neugierig. »Wer hat es denn getan?«
»Weiß ich doch nicht.« Heinrich von Alfeld hatte die Nase voll. Seine Ratskollegen hatten ihn bereits mit inquisitorischen Fragen gequält, nun wollte er in Ruhe gelassen werden.
»Hast du nichts gesehen?«
»Geh ins Bett!«, sagte von Alfeld müde. Er mochte kein weiteres Wort mehr wechseln, mit niemandem.
»Heinrich!« Jetzt machte Johanna auch noch diese Kuh augen, von denen sie glaubte, sie würden ihn erregen. Und sie neigte den Kopf zur Seite – das war alles andere als verführerisch. Die Frau, mit der Heinrich von Alfeld seit elf Jahren verheiratet war, widerte ihn nur noch an.
»Ins Bett! Oder ich hole den Stock!«
»Das darfst du nicht.« Johanna zog die Lippen kraus. Sie hatte Recht, als Ehemann durfte er seine Frau zwar schlagen, aber nur in Maßen. Übertrieb er die Züchtigung, würde man ihn vor den Rat zitieren, und sein blödes Weib hätte Anspruch auf Entschädigung. Warum hatte er sie nur geheiratet? Eine rhetorische Frage: Sein Vater hatte die Ehe gestiftet. Johanna war schließlich eine Raven, und die Raven waren reich. Deshalb hatte er die dumme Kuh ehelichen müssen. Pecunia non olet! Aber sie, sie stank ihm.
»Sofort ins Bett mit dir!«, befahl er erneut. Nun endlich gehorchte sie und verschwand.
Als junger Mann hatte er immerhin noch gehofft, dass Liebe aus Gewohnheit entstand. Aber aus Gewohnheit entstand nur Hass.
Heinrich von Alfeld schenkte sich Wein ein. Er handelte zwar mit Einbecker Bier, das als das beste Bier der Welt galt, aber als wohlhabender Knochenhauer und Ratsherr trank er natürlich am Abend einen Krug guten Franzenweins. Das konnte er sich leisten, auch dank Johannas üppiger Mitgift. Sie hatte dafür gesorgt, dass er sich zu den angesehensten Bürgern Hildesheims zählen durfte. Aber nun brauchte er sie nicht mehr. Er stand auf eigenen Füßen, und zwar sehr sicher.
Heinrich von Alfeld erhob sich und ging zur Tür. Schon lange grübelte er darüber nach, wie er sein Weib auf gewandte Weise beseitigen konnte. Den Beischlaf vollzog er seit Jahren nicht mehr; wenn ihn die Geschlechtslust ankam, ging er entweder in die Badestube oder zu seiner Tochter Anna. Anna war ein liebes Mädchen, sehr nachgiebig und mit einer sehr weichen Haut.
Heinrich riss die Tür auf. Im Vorraum hockte die Magd Frieda auf einer Bank, schwankend zwischen dem Bedürfnis, sofort einzuschlafen, und der Furcht, dass ihr Herr noch Wünsche äußern könnte.
Ihr Herr hatte einen Wunsch.
»Frieda, bring mir meinen Sohn!«, ordnete er an.
»Welchen, Herr?«
»Ja, welchen schon, dummes Stück?! Den ältesten natürlich.«
»Peter?« Frieda war noch nicht ganz bei sich.
»Ich habe nur einen ältesten Sohn«, sagte Alfeld und schlug die Magd ins Gesicht. Das stimmte nicht ganz, denn seinen ersten männlichen Nachkommen hatte er vor vielen, vielen Jahren mit Frieda gezeugt; Johanna war damals zu jung und nicht empfängnisbereit gewesen. Das Kind, das nicht einmal getauft worden war, hatte er sofort nach der Entbindung in der Abortgrube versenkt. Er wollte keine Bankerte – die verursachten nur Schuldgefühle und Kosten.
Frieda, die dick geworden war und Alfeld längst nicht mehr gefiel, machte sich unverzüglich auf den Weg. Heinrich kehrte in die Stube zurück und setzte sich auf die Bank vor dem Ofen, denn Wärme konnte er jetzt gebrauchen, und der einzige Wärmespender in seinem Haus war der Kamin. Und Anna, seine Tochter.
Peter erschien im Nachtgewand. Er war nun neunzehn Jahre alt und musste alsbald verheiratet werden. Waldemar Klingenbiel war seit langem scharf auf Peter. Seine Tochter Magdalena war zwölf, also heiratsfähig. Heinrich stand dieser Verbindung nicht im Wege. Waldemar war zwar kein Ratsherr, und das Sankt-Andreas-Knochenhaueramt war nicht das führende, aber Klingenbiel hatte Geld. Hundert Marien groschen war ihm die Ehe wert. Das war keine gigantische Summe, aber Alfeld würde seinen Sohn endlich loswerden.
»Setz dich zu mir«, bat Heinrich. Peter nahm Platz, am äußersten Ende der Bank. Heinrich von Alfeld wusste, dass sein Sohn ihn abgrundtief hasste, ging aber gelassen darüber hinweg. In seinem Haus hasste jeder jeden. Nur Anna, die hasste nicht. Sie liebte ihren Vater.
»Was wollt Ihr, Herr Vater?«, fragte Peter. Er schaute an Heinrich Alfeld vorbei und musterte die Ofenkacheln, als hätte er sie noch nie gesehen.
»Ja, was denkst du denn? Was soll ich wohl wünschen? Dass du krepierst?«
»Wünscht Ihr das, Herr Vater?«
»Ach was! Ich bin Knochenhauer, ich handle mit Fleisch. Und du bist ein Stück Fleisch für mich, das ich günstig verkaufen möchte.«
»An Waldemar Klingenbiel, Herr Vater?«
»Genau, Sohn. Du wirst seine Tochter Magdalena heiraten.« Heinrich von Alfeld lächelte. Magdalena war ein ausgesprochen süßes Mädchen. Peter würde sie zwar heiraten, aber Alfeld hoffte, auch etwas von dem Kuchen abzubekommen. Besser konnte es doch gar nicht sein. Nur Gott würde dieser sündhaften Konstruktion nicht gewogen sein; deshalb hatte Alfeld bereits vorsorglich päpstliche Ablassbriefe erworben, die ihm 99 999 Jahre Sündenablass und Schutz vor dem Fegefeuer gewährten, und dann konnte man weitersehen. Ein Vermögen hatten diese Briefe gekostet, doch sie waren ihren Preis wert.
»Ich liebe dieses Mädchen aber nicht, Herr Vater«, wagte Peter einen schwachen Einwand. Ernst nehmen musste Alfeld ihn nicht, denn Peter wollte erben, und das konnte er nur, wenn er sich wohl verhielt.
»Ja, das ist Pech«, sagte Heinrich. »Aber du weißt selbst, dass es Heiraten aus Liebe nur bei den Armen gibt. Büdner, Tagelöhner, Gaukler und anderes Gesindel dürfen ihrem Herzen folgen oder, wenn du so willst, auch ihrem Schwanz. Unser einer setzt eben andere Prioritäten. Klingenbiel gibt Magdalena eine beachtliche Mitgift. Ich habe schon mit meinem Schwager Dirich Raven gesprochen. Er verkauft uns ein Haus in der Jacobistraße, auf dem auch die Braugerechtigkeit liegt. Ich meine, Junge, du bist vollkommen missraten, was nur deiner Mutter geschuldet sein kann. Du kannst überhaupt nichts. Dass du zum Knochenhauer taugst, habe ich gar nicht erwartet. Aber deine Mutter wollte doch, dass du Priester wirst. Ich habe dein Studium an der Universität Erfurt finanziert … Und du? Ein Jahr hast du durchgehalten. Du bist dumm, Peter, so dumm wie deine Mutter. Theologie und Jurisprudenz sind für dich Bücher mit sieben Siegeln. Aber vielleicht, habe ich gedacht, wird ein anständiger Kaufmann aus ihm, wenn er schon in der Stadt versagt, in der Adam Riese tätig war. Adam Riese, sagt dir das was? Nein? Natürlich nicht. Du kannst ja nicht einmal rechnen! Genauer gesagt, du rechnest wie ein Lutheraner: Eins mit eins ist vier. So rechnet dieser Luther doch.«
»Herr Vater, so dürft Ihr nicht reden«, sagte Peter leise.
»Nein? Ich darf in meinem Haus nicht reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist? Weil mein missratener Erstgeborener ein Martinianer ist? Dein Luther bringt doch nur Unordnung ins Reich. Ich bin Metzger, ich weide Tiere aus und verkaufe das Fleisch, und mit Gott bin ich im Reinen.« Heinrich von Alfeld klopfte sich auf die Schulter. »Wirst du Magdalena Klingenbiel heiraten?«
»Wenn Ihr es wünscht.«
»O ja, das tue ich.«
»Dann heirate ich sie.«
»Brav, Peter.« Alfeld nahm den Schürhaken und stocherte in der Glut. »Im Sommer soll die Hochzeit sein. Und nun kannst du gehen. Gute Nacht!«
Die Brüder sangen. Sie lobpreisten den Herrn, was bei Predigerbrüdern nicht weiter verwunderlich war. Eusebius konnte zwar den Text nicht verstehen, aber er erkannte die Melodie. Eigentlich hatte er vorgehabt, am Stundengebet teilzunehmen. Durch das kleine, mit Sackleinen verhängte Fenster drang nicht viel Licht in die Zelle, aber Eusebius war klar, dass es längst tagte.
Er konnte nicht aufstehen. Mors est quies viatoris – finis est omnis laboris, dachte er: Der Tod ist die Ruhe des Wanderers – er ist das Ende aller Mühsal. Nicht, dass er sich prinzipiell den Tod wünschte; trotz seiner apokalyptischen Visionen lebte er gern. An diesem Morgen allerdings hätte er lieber die Ruhe des Wanderers genossen. Tote mussten nicht aufstehen. Sie konnten einfach liegen bleiben, und das für immer. Genauer gesagt, bis zum Jüngsten Gericht.
Eusebius hatte nicht nur Kopfschmerzen, vor allem peinigte ihn ein flaues Gefühl im Magen. Natürlich würde ihm der Bruder Arzt helfen können: ein Kräutertrank, und alles Übel war beseitigt. Die Frage war nur, wie es ihm gelingen sollte, zum Bruder Arzt zu kommen.
Unmöglich, dachte Eusebius und schloss die Augen, heute tue ich keinen Schritt.
»Ehrwürdiger Vater?«, fragte jemand. Es musste ein Mensch sein, denn nur Menschen waren der Sprache mächtig. Dieser Mensch war in Eusebius’ Zelle eingedrungen, ohne dass er es bemerkt hatte. Der Dominikanerpater öffnete die Augen und linste zur Tür. Dort stand ein blutjunger Novize.
»Nein«, sagte Eusebius.
»Nein, Ehrwürdiger Vater?«
»Nein, nein und nochmals nein.«
»Der ehrwürdige Prior meinte, ich solle mich um Euch kümmern.«
»So, meinte er das?« Eusebius ließ den Kopf auf das dünne Kissen sinken. Vermutlich hatte sich im Konvent längst herumgesprochen, dass er am vergangenen Abend mit dem Hildesheimer Weihbischof gesoffen hatte. Seiner Reputation war das offenbar nicht abträglich, denn immerhin hatte ihm der Prior einen hübschen Novizen geschickt.
»Ich habe hier einen Kräutertrank vom Bruder Arzt«, sagte der Knabe. »Trinkt ihn, und alle Eure Leiden sind … Der Bruder Arzt hat so ein komisches französisches Wort benutzt, als er mir den Trank gab. Ich bin doch nur ein Bauernsohn, Ehrwürdiger Vater!«
»Perdu?«
»Ja, so sagte er. Per dü!« Der Novize setzte sich zu Eusebius aufs Bett und lächelte. Aus dem Becher in seiner Hand dampfte es, und es roch nach Minze und Kamille.
Pater noster qui es in coelis, betete Eusebius still vor sich hin. Et ne nos inducas in tentationem – und führe uns nicht in Versuchung. »Wie heißt du?«, fragte er.
»Johannes, Ehrwürdiger Vater«, sagte der Novize stolz. Das war ein schöner Name. Der Täufer hieß so und der Lieblingsjünger Jesu ebenfalls. Aber andererseits ist es nichts Besonderes, dachte Eusebius, die Welt ist voll von Johannessen, und sie wird dennoch bald untergehen.
»Und du bist der Sohn eines Bauern?«, fragte Eusebius. »Warum hat dich dein Vater in den Konvent geschickt?«
»Ihr wart in Rom, Vater?«, erkundigte sich der Novize rasch. Eusebius horchte auf; die Frage nach seiner Herkunft war dem Jungen offenbar unangenehm.
»Ja, ja«, Eusebius machte eine abwehrende Handbewegung, »aber es ist sehr unhöflich, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Also noch einmal: Warum hat dich dein Vater in den Konvent geschickt?«
»Ich weiß nicht, Herr. Es hat etwas mit der Stiftsfehde zu tun. Habt Ihr von der Stiftsfehde gehört? Ich verstehe das ja alles nicht. Ich bin viel zu jung. Und ich kann noch nicht mal richtig lesen. Aber das Land meines Vaters … also, das hat alles irgendwie mit dem Bischof zu tun. Und mit dem Herrn von Calenberg. Aber das müsst Ihr den Prior fragen, Heiliger Vater. Der weiß Bescheid.«
»Johannes!«, sagte Eusebius streng. Allmählich fühlte er sich ein wenig besser, obwohl er den Tee noch nicht angerührt hatte. »Ich bin kein Heiliger Vater. So nennt man nur den Papst.«
»Habt Ihr den Heiligen Vater gesehen?«, fragte der Knabe. Er stellte den Becher mit dem Heiltrank auf den Fußboden und schaute Eusebius in einer Weise an, die den Mönch sofort den Blick abwenden ließ. Es war nicht nur kindliche Wissbegier und ein ebenso kindlicher Eifer, die Eusebius in den Augen des Novizen gesehen zu haben glaubte. Eusebius galt als weit gereister Mann, und bei einem Knaben, den man in einen Konvent eingesperrt hatte, erregte ein solcher Mann natürlich ein gewaltiges Interesse. Aber Johannes schien noch etwas anderes von Eusebius zu erwarten, etwas, was er bei den anderen Männern im Konvent nicht fand – und was Eusebius beunruhigte. »Wie ist er?«, fuhr der Junge fort. »Was hat er gesagt? Vater, bitte erzählt mir vom Papst.«
»Ich habe nicht mit ihm gesprochen«, Eusebius schmunzelte. »Aber er mit mir.«
»Und?«, fragte der Knabe atemlos. »Was hat er gesagt?« »Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu«, sagte Eusebius.
»Vater, Latein kann ich auch nicht.« Johannes rang die Hände. »Ich will ja … Ich will lernen! Könnt Ihr mir nicht alles beibringen? Ihr kennt doch die Welt.«
Kenne ich sie?, fragte sich Eusebius. Ja, ich kenne sie. Und sie ist schmutzig. Habgier und Laster beherrschen sie, mordende und plündernde Landsknechte machen sie unsicher, Päpste, Könige, Kaiser streiten bis aufs Blut noch um das kleinste Stück Land. Sie sprechen vom Glauben und meinen doch immer nur Macht und Besitz.
»Lasset uns preisen den Vater und den Sohn samt dem Heiligen Geist«, murmelte er.
»Ja, das ist das Tedeum«, sagte Johannes eifrig. »Das kenne ich. Aber der Heilige Vater muss doch … Hat er denn nichts anderes zu Euch gesagt?«
»Nein.«
»Was? Ihr habt Euch mit dem Stellvertreter Gottes auf Erden getroffen, und er hat nur das Tedeum gesprochen?« Johannes schaute den Frater verständnislos an.
»Ja, mein Junge. Ecco, wie die Italiener sagen: So ist es! Es war während einer Generalaudienz. Paul III. nahm mich in der Menge nicht einmal wahr. Und die Audienz fand außerdem in der neuen Peterskirche statt, die ja noch eine Baustelle ist. Um nicht zu sagen ein Trümmerfeld. Ob sie wohl jemals fertig wird?«
»Dafür erhebt der Heilige Vater ja den Peterspfennig«, sagte der Novize.
Eusebius schmunzelte angesichts des Eifers, mit dem der Junge sein Wissen unter Beweis stellen wollte. »Ecco.« Er richtete sich mühsam auf. Es war möglich, ohne dass ihn Übelkeit überkam. »Wie alt bist du, Junge?«
»Fünfzehn.«
»Und wie lange im Konvent?«
»Seit sechs Jahren, Ehrwürdiger Vater.«
»Dann kennst du dich aus in der Stadt?«
»Ich verlasse das Kloster nur selten, Vater.« Johannes ging auf die Knie und zog Eusebius die Sandalen an. »Es gibt so viel zu tun. Ich muss vor jedem Stundengebet neue Kerzen aufstecken, ich muss die Kirche kehren und den Kreuzgang und den Klosterhof, ich muss dem Bruder Arzt im Kräutergarten zur Hand gehen und auch dem Bruder Koch. Na ja, und ich muss noch sehr viel lernen. Die vielen gelehrten Bücher im Armarium, die will ich irgendwann alle lesen. Wenn ich richtig lesen kann. Und Latein beherrsche. Aber der Bruder Kantor bringt es mir bei. Ich kann meinen Namen schreiben, und wenn ich mir sehr viel Mühe gebe, schaffe ich die erste Seite der Summa theologica.« Johannes schnürte die Sandalen zu und schaute Eusebius von unten traurig an. »Ich verstehe sie aber nicht«, gab er zu.
»Nicht mal die erste Seite?«
Der Novize schüttelte den Kopf.
»Ich werde dir alles erklären.« Eusebius entsann sich wieder des Auftrags, den Weihbischof Fannemann ihm erteilt hatte – bevor der Wein so reichlich geflossen war. »Aber du musst mir auch helfen, Johannes.«
»Gern, Vater.«
»Von dem Mord in der Badestube hast du gehört?«
»Ich war heute schon auf dem Markt. Die ganze Stadt spricht davon.«
»Und was sagt man?«
»Dass es eine abscheuliche Untat ist.« Johannes richtete sich auf.
»Sicher. Aber haben die Leute auch Mutmaßungen? Wen halten sie für den Täter?«
»Darüber reden sie doch nicht mit mir, Vater«, entgegnete Johannes. »Ich bin für sie ein Mönchlein. Die Leute mögen uns nicht. Sie glauben, dass wir uns auf ihre Kosten bereichern. Dabei besitze ich nichts. Nicht mal meine Kutte gehört mir.«
»Schau auf den Tisch«, verlangte Eusebius. Johannes tat es. »Dort siehst du eine Geldbörse. Nimm ein paar Groschen und beschaffe uns unauffällige Kleider.«
»Aber das darf ich nicht, Vater!«
»Johannes, kannst du schweigen?«
»Das jedenfalls hab ich hier gelernt.«
»Ich habe für den Weihbischof einen geheimen Auftrag zu erledigen«, sagte Eusebius. Das war ein wenig übertrieben, denn Geheimhaltung hatte Balthazar nicht verlangt. Aber es wirkte: Johannes machte große Augen, und seine Wangen röteten sich.
»Wir unterstehen aber nicht der Diözese, sondern direkt dem Papst«, sagte der Junge. »Der Weihbischof kann uns doch gar keinen Auftrag erteilen?«
»Einen geheimen schon«, behauptete Eusebius und ließ Johannes nicht aus den Augen. Es sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn ein bisschen Geheimniskrämerei bei einem neugierigen Jüngling nicht auf fruchtbaren Boden fiel. »Außerdem möchte der Prior doch, dass du mir zur Seite stehst?«
»Das möchte er.«
»Also tust du, was ich dir befehle. Und du schweigst!«
»An welche Art von Kleidung dachtet Ihr, Ehrwürdiger Vater?«
»An bürgerliche«, sagte Eusebius. »Aber schlicht.«
»Nun langt doch zu, lieber Waldemar!« Heinrich von Alfeld deutete auf den Rinderbraten mit Oliven und Senf. »Nicht dass Ihr hinterher sagt, Ihr hättet beim künftigen Schwiegervater Eurer Tochter Hunger leiden müssen.«
»Aber mein lieber Heinrich, ich bin satt.« Waldemar Klingenbiel lehnte sich erschöpft zurück. Nach der Biersuppe mit Brot hatte er Biber, Schwanenfleisch und Schweinskopf gegessen, alles erlesene Speisen. Heinrich von Alfeld wollte offensichtlich beweisen, wie gut es ihm ging. Klingenbiel, der Knochenhauer war wie Alfeld, sah mit nur einem Blick auf den Rinderbraten, dass das Fleisch ganz frisch war. Er zögerte. Erst einmal nahm er einen Schluck von dem guten Einbecker Bier.
»Wir könnten auch Wein trinken«, sagte von Alfeld.
»Ich bin zufrieden«, entgegnete Klingenbiel.
»Aber Ihr esst doch noch? Halb verhungert lasse ich Euch nicht gehen.«
»Nun denn.« Klingenbiel zückte sein Messer, schnitt eine dicke Scheibe vom Rinderbraten, bestrich sie mit Senf und belegte sie mit Oliven. Völlerei war eine Sünde, aber es wäre auch Sünde, den Braten kalt werden zu lassen.
»So gefallt Ihr mir«, meinte von Alfeld. »Es gibt dann auch noch Konfekt und Nüsse.«
»Und wir sind uns einig?«, fragte Klingenbiel, um sich noch einmal zu vergewissern, dass alles Wichtige verhandelt worden war; immerhin ging es um die baldige Hochzeit seiner Tochter.
»Wie besprochen. Peter und Magdalena heiraten zu Sankt Johannes Baptista.«
»Das ist gut. Bis zum vierundzwanzigsten Juli bleibt uns noch genug Zeit, die Hochzeit vorzubereiten.« Klingenbiel biss ein Stück vom Braten ab. Das Fleisch war zart und saftig, und das gelang bei Rind nicht immer.
Auch Heinrich von Alfeld bediente sich.
»Damit sich Magdalena an Peter gewöhnt, könnte sie schon heute bei uns einziehen«, schlug er vor.
Um nicht gleich antworten zu müssen, spülte Waldemar Klingenbiel das Fleisch mit Bier hinunter. Alfelds Vorschlag gefiel ihm nicht. Es gab gewisse Gerüchte, dass sich sein Gegenüber gern mit sehr jungen Mädchen vergnügte. Vielleicht war an den Gerüchten nichts dran – Klingenbiel versuchte, sich selbst davon zu überzeugen. Im Hause von Alfelds wäre Magdalena aufs Beste versorgt. Ihr würde es an nichts fehlen. Heinrich von Alfeld war reich, viel reicher als er selbst. Und immerhin zählte auch Klingenbiel zu den wohlhabenden Bürgern. Fast nichts war ihm wichtiger, als seiner Tochter ein gutes Auskommen zu verschaffen. Vielleicht musste sie dafür das eine oder andere Opfer bringen.
Klingenbiel seufzte. »Ein ungewöhnlicher Gedanke«, murmelte er.
»Wir sind handelseinig?«
»Heinrich, das wisst Ihr doch.« Klingenbiel reichte seinem Gegenüber nach kurzem Zögern die Hand. »Es ist immer ein Vergnügen, mit Euch Geschäfte zu machen.«
»Zwei Wünsche noch, wenn es erlaubt ist.« Heinrich von Alfeld ergriff Klingenbiels Hand.
»Selbstverständlich.«
»Erstens: Lass uns Du sagen. Und zweitens: Wir sollten uns verwöhnen. Was hältst du von ein paar Stunden in der Badestube?«
»Eigentlich viel. Aber du traust dich da noch hin?«
»Was soll schon passieren?« Heinrich von Alfeld schlug Klingenbiel auf die Schulter. »Jetzt ist die Badestube doch noch sicherer als Abrahams Schoß.«
Jacob Findling hatte sich entschieden. Er musste handeln, und ihm blieb nur ein Weg. Wieder hatte Marie den Gesellen zu sich gerufen, hatte ihn gelockt und mit ihm zärtliche Worte gewechselt, um ihn dann abrupt von sich zu stoßen. Jacob fühlte sich zutiefst gedemütigt. Aber er verstand Marie auch: Zwischen ihnen stand nun einmal sein Ziehvater, der bei Marie die Rechte eines Ehemanns beanspruchen konnte. Das wollte Jacob endlich auch.
Am späten Vormittag hatte Waldemar Klingenbiel sein Haus verlassen. Jacob hatte eigentlich mit den Lehrjungen Schinken machen sollen, aber das konnten die Jungen auch allein. Er hatte sie instruiert, und dann war er seinem Ziehvater gefolgt. Es regnete nicht mehr, und auch der Wind hatte nachgelassen. Jacob hob den Blick. Der Himmel sah aus, als könne er noch unendlich viele Unwetter verfertigen, aber noch hielt er sich zurück.
Klingenbiel war nicht weit gegangen, nur vom Andreaskirchhof zur Saustraße. Im Haus Güldener Hirsch war er verschwunden. Jacob wusste, wer in diesem Haus mit den überkragenden Obergeschossen wohnte, der Ratsherr und Knochenhauer von Alfeld nämlich. Über dem Tor prangte ein mit Goldbronze bestrichener Hirschkopf. Hier in der Saustraße lebten die reichsten Männer Hildesheims. Von Alfelds Nachbar war Consul Tile Brandis. Sein fünfgeschossiges Haus war noch prächtiger. Das Fachwerk war mit allegorischem Schnitzwerk versehen, das die Gründungslegende Hildesheims darstellte, und dort, wo Jacob die Wohnstube vermutete, gab es einen ausladenden Erker. So reich wie die Familie Brandis würde Jacob sicher nie sein. Aber er befand sich auf dem besten Weg zu einem Wohlstand, der es ihm erlauben würde, Bürger und Meister zu werden.
Jacob tastete nach dem linken Ärmel seines Mantels. Dort befand sich der Dolch.
Wenn Klingenbiel tot war, stand er ihm bei Marie nicht mehr im Wege. War die Trauerfrist verstrichen, würde Jacob um ihre Hand anhalten – zu einem Zeitpunkt, da niemand mehr einen Zusammenhang mit dem Mord vermutete. Marie genösse dann das Witwenrecht, sie konnte das Handwerk ihres Gatten weiterführen, mit einem Gesellen oder eben mit einem neuen Ehemann. Und dieser Ehemann würde Jacob heißen.
Heute noch würde Waldemar Klingenbiel sterben, sollte Jacob den Mut aufbringen, seinen Vorsatz in die Tat umzusetzen. Er war fest entschlossen, hatte zugleich aber Angst. Wenn die Tat nun misslänge? Sich vorzustellen, einen Menschen zu töten, war das eine. In der Vorstellung genügte ein überraschender Stoß ins Herz. Aber Jacob hatte noch nie jemanden getötet. Vielleicht war das ja viel schwieriger, als er es sich ausmalte. Vielleicht würde Klingenbiel Widerstand leisten.
Und doch musste es sein.
»Du wirkst nachdenklich, Tile«, sagte Gesche Brandis. Da der Arzt ihr Ruhe verordnet hatte, befand sie sich noch in ihrer Schlafkammer, hatte sich aber ausgerichtet. Tile setzte sich zu ihr. Er hatte bereits gearbeitet und die ersten beiden Stunden nach der Morgenandacht in der Schreibkammer verbracht, um seine Geschäftskorrespondenz zu erledigen. Dann hatte ihn die Sehnsucht zu seiner Frau getrieben. Er streichelte ihren Bauch. Wenn er der Urinbeschau des Stadtarztes Vertrauen schenken durfte, wuchs dort ein Sohn heran.
»Ja, ich bin nachdenklich. Der Prediger der Andreaskirche meinte heute Morgen, dass Lutheraner hinter dem Mord an Peter Groper stecken. Er hat die Anhänger des Martinismus in Bausch und Bogen verdammt. Das ist ja nichts Neues. Aber wie man hört, werden sie von allen Kanzeln nicht nur eines unmoralischen Lebenswandels geziehen, sondern auch der Mordlust. Der Mord an Groper passt Weihbischof Fannemann ausgezeichnet ins Konzept.«
»Aber was hast du mit den Lutheranern zu schaffen?« Gesche nahm die rechte Hand ihres Mannes und hielt sie fest. »Als mein Vater noch Bürgermeister war, wagten sie nicht den Kopf zu heben.«
»Das stimmt nicht. Den Kopf gehoben haben sie schon …«
»Aber sie hatten nichts zu sagen.«
»Wohl wahr«, sagte Tile.
»Mein Vater hat eine Delegation nach Burgos geschickt, die Kaiser Karl ein Wappenprivileg für unsere Stadt abringen sollte, was ihr ja auch gelungen ist. Mittlerweile habe ich jedoch den Eindruck, dass seine Verdienste um unsere Stadt sehr schnell in Vergessenheit geraten sind. Das Wappen ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden, und über meinen Vater spricht man nicht mehr!«
»Ich schon, Gesche. Ich habe nicht vergessen, dass dein Vater ein verdienstvoller Mann war. Warum regst du dich auf?«
»Ich rege mich nicht auf!«
»Und ob.« Tile streichelte seiner Frau das Gesicht. Gesche musste sich sehr zusammenreißen, um ihn nicht anzulächeln, das spürte er.
»Ich frage mich nur, warum du auf Seiten der Protestanten stehst«, sagte sie.
»Dort stehe ich ja nicht«, widersprach Tile. »Was dieser Luther über Gott und die göttliche Gnade, was er von der Sünde und den Sakramenten denkt, ist mir egal. Ich bin Ratmann, Gesche, ich stehe auf Seiten meiner Stadt. Und schau dir Hildesheim an. Überall findest du geistliche Immunitäten, wo die Rechtsmacht des Rates nichts gilt. Und das betrifft nicht nur die Domfreiheit. Jedes gottverdammte Kloster verfügt über unbeweglichen Besitz, wo nur geistliches Recht gilt. Jeder Mörder braucht bloß ein paar Straßen weit zu laufen, und schon ist er der städtischen Gerichtsbarkeit entzogen.«
»Komm, Tile, die geistlichen Immunitäten achtet der Rat doch schon lange nicht mehr«, sagte Gesche.
»De facto nicht, da hast du Recht. Aber ich möchte, dass wir auch de jure nicht mehr vor den klerikalen Sonderrechten den Hut ziehen müssen. Wenn der Klerus enteignet ist, fällt auch seine ihm eigentümliche Jurisdiktion.«
»Du bist Lutheraner aus Geldgründen?« Gesche schüttelte den Kopf.
»Du willst mich einfach nicht verstehen. Seit der Stiftsfehde ist Hildesheim arm. Wenn wir das Kirchenvermögen kassieren, steht unsere Stadt viel besser da. Und sie ist endlich ein einheitliches Rechtsgebiet.«
»Und das möchtest du?«
»Das möchte ich, Gesche. Ich will mich nicht länger von Geistlichen an der Nase herumführen lassen, die das Wort Gottes, das sie verkünden, nicht einmal lesen können. Ich bin Geschäftsmann. Mein Alltag wird vom Handel und vom Geld bestimmt. Aber ich gebe es wenigstens zu. Die Kirche wird reich mit Ablässen, aber sie tut so, als gehe es ihr nur um den Glauben. Sie ist eine Mastgans, Gesche, und es wird Zeit, sie zu schlachten.«
»Aber wo bleibt Gott?« Gesche legte ihren Kopf an Tiles Schulter. »Wir dürfen Gott nicht vergessen.«
»Das tue ich auch nicht. Im Gegenteil. Aber der Papstkirche ist Gott längst gleichgültig geworden. Sie ist ein Handelsunternehmen wie die Fuggerei. Gott haben sie vergessen. Sie huldigen nur noch dem Mammon.«
»Und Martin Luther?«
»Er klärt den Glauben zu dem, was er sein sollte: eine persönliche Zwiesprache mit dem Herrn.«
»Du glaubst also nicht, dass Hildesheimer Protestanten hinter dem Mord an Groper stecken?«, fragte Gesche.
»Nein, das ist dummes Zeug. Sie haben ja kein Motiv.« Tile küsste seine Frau auf die Nasenspitze. Er hatte Gesche allein aus dem Grund geheiratet, dass sie die Tochter des nunmehr verstorbenen Bürgermeisters Hans Wildefuer war. Doch mittlerweile liebte er sie, und ihr Körper weckte seine Begierde.
»Ich liebe dich für deinen Eigensinn«, sagte Gesche. »Nur deshalb?«
»Nicht nur. Du bist ein großer, starker Mann.«
»Und du magst große, starke Männer?«
»Nicht alle. Nur einen.«
»Heißt er Tile?«
»Mhm.«
»Und welche Folgerungen soll ich daraus ziehen?«
»Die Antwort findest du unter meinem Hemd.«
Und in der Tat fand Tile dort die Antwort.