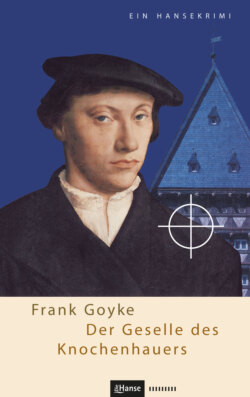Читать книгу Der Geselle des Knochenhauers - Frank Goyke - Страница 9
ERSTES KAPITEL
Der Ruf der Glocke
ОглавлениеDer Ratsherr Tile Brandis blickte nachdenklich auf sein Gedenkbuch, das aufgeschlagen vor ihm auf dem Tisch lag. Kurz bevor die Bierglocke den Feierabend verkündete, hatte er sich in seine Schreibkammer zurückgezogen, Tinte angerührt und den Federkiel geschärft. Nicht jeden Tag, sondern in unregelmäßigen Abständen pflegte er alle Denkwürdigkeiten aufzuschreiben, die ihn bewegten: Ereignisse in Stadt und Bistum, Geschehnisse im Reich, aber auch Familiäres. Bereits sein Vater Henning, aus dessen dritter Ehe Tile stammte, hatte Gedenkbücher geführt, und Tile setzte diese Tradition fort, um seinen Kindern und Kindeskindern Bericht zu erstatten von den Zeitläuften und um ihnen Rechenschaft abzulegen von seinem Tun und Lassen.
Brandis schaute zum Fenster. Der März ging seinem Ende entgegen, aber vom Frühling war noch wenig zu spüren. Stürmische Winde und anhaltender Regen ließen es geraten erscheinen, die meiste Zeit des Tages im Haus zu verbringen, aber das war einem Mann von Tiles Bedeutung nicht möglich. Nicht nur dass er zweimal in der Woche an Ratssitzungen teilnahm, am Montag und am Freitag, wenn der Zeiger am Rathausturm nach den Consules civitatis rief; als Angehöriger einer der reichsten Familien Hildesheims hatte er auch noch viele andere Verpflichtungen für das Gemeinwesen. So war er Oldermann des Knochenhaueramtes und der Tuchhändler, Gildemeister der Wollenweber und vom Rat eingesetzter Ältermann des Großen Heilig-Geist-Spitals bei der Andreaskirche. Er hatte erheblichen Grundbesitz zu verwalten, und seinen eigenen Geschäften – unter anderem dem Handel mit Tuchen und Gewürzen, mit kostbarem Glas und nicht minder kostbaren Pelzen, mit Bier und Wein – musste er schließlich auch noch nachgehen. Einige von ihnen konnte er zwar in der Schreibkammer abwickeln, aber sie zwangen ihn auch immer wieder, sein Haus in der Saustraße zu verlassen.
Tile Brandis reckte sich. Der Knecht hatte zwar den Ofen geheizt, aber richtig warm wollte es in der Kammer nicht werden.
Der Ratmann ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Den Kupferstich an der Wand hatte Tile bei einem Buchführer auf dem Markt erworben, und er gefiel ihm ausnehmend gut. Der Kupferstecher hatte eines der seltsamsten Wesen der Welt dargestellt, ein Tier, von dem die Christenwelt erst im Jahr des Herrn 1515 Kenntnis erlangt hatte. Damals hatten es Seefahrer nach Europa gebracht, aber sie waren im Mittelmeer gekentert, so dass man dieses gepanzerte Geschöpf nur tot hatte bergen können, um es hernach auszustopfen. Der Namen dieses unheimlichen Tieres, das ein Horn auf der Nase trug, war Rhinozer, und ein sehr berühmter Meister aus Nürnberg hatte den Stich angefertigt. Sein Name war Albrecht Dürer.
Consul Brandis wandte sich endgültig seinem Gedenkbuch zu. Er tunkte die Feder in die Tinte und begann zu schreiben.
Den gestrigen Morgen ging der Kohlenträger Peter Lüders in den Einbeckischen Keller, um dort so viel Branntwein zu trinken, dass er erstickte und tot zu Boden fiel, notierte er. Die ganze Stadt sprach davon, nicht weil der Tod eines Kohlenträgers den Bürgern besonders nahe ging, sondern wegen der Umstände seines Ablebens. Das Aqua vitae diente im Allgemeinen als Heilmittel, aber der Ratskellermeister war gern bereit, auch unbekömmliche Mengen auszuschenken, wenn man es ihm bezahlte. Helfe uns Gott!, schrieb Tile, während er überlegte, wie sich ein Kohlenträger solche Unmengen Branntwein überhaupt leisten konnte. Aber vielleicht war die Gesundheit dieses Lüders bereits angegriffen gewesen, so dass ein paar Gläser genügt hatten, um ihm den Garaus zu machen.
Der Ratmann rührte noch einmal die Tinte um. Unlängst waren Nachrichten aus Speyer eingetroffen, die es ebenfalls wert waren, niedergeschrieben zu werden.
Um Mittfasten wurde ein Reichstag gehalten zu Speyer, darin eine allgemeine Türkensteuer beschlossen wurde.
Die Türkengefahr war allgegenwärtig, auch wenn wohl kaum damit zu rechnen war, dass die Ungläubigen eines Tages vor Hildesheim standen. Ihre Belagerung von Wien im Jahre 1529 war allerdings ein großer Schock für die gesamte Christenheit gewesen, und sie hatte auch die Hildesheimer beschäftigt. Im Einbecker Keller, dem Ratskeller der Stadt, hatten die besseren Bürger schon überlegt, dass es gar nicht mehr darauf ankäme, welcher der christlichen Konfessionen man sich zuwende, sondern dass man besser erwäge, ob man nicht Muselmann werden solle. Tile Brandis schüttelte den Kopf. Ihm war klar, dass sich hinter diesen Scherzen eine große Angst versteckte, denn die Türken galten als rücksichtslos und grausam. Der Dom als Moschee, wie die Muselmanen wohl ihre Kathedralen nannten – das war eine entsetzliche Vorstellung. Immerhin hatten die Türken die Hagia Sophia in Konstantinopel auch in eine Moschee verwandelt. Außerdem betrieben sie Vielweiberei und pressten Frauen aus den eroberten Ländern in ihre Harems; so hieß es jedenfalls. Angesehene Hildesheimer Bürgertöchter als Liebesdienerinnen eines Sultans oder Wesirs? Helfe uns Gott!
Tile Brandis betrachtete, was er bisher geschrieben hatte. Es gab auch noch eine familiäre Neuigkeit, die der Niederschrift bedurfte: Seine Frau Gesche, eine Tochter des im letzten Dezember verstorbenen Bürgermeisters Hans Wildefuer, war schwanger. Wenn alles gut ging, würde sie im September, dem Monat der Obsternte, ein Kind gebären, und Tile hoffte sehr auf einen Knaben.
Tile Brandis hatte die Gänsefeder noch einmal erhoben, als plötzlich die Glocken läuteten. Der Ratmann legte die Feder auf den Tisch und sprang auf. Wenig später stürzte sein Knecht Bertolt in die Schreibkammer, die pelzgefütterte Schaube über dem Arm und das Barett in der Hand. Tile fuhr in den langen Mantel, den der Knecht ihm reichte. Der Ruf der Glocke war eindeutig, er verlangte von allen Bürgern, sich sofort zu versammeln. Und als der Ratsherr sein Haus verließ, hörte er auch den lauten Ruf »To jodute, to jodute!«, mit dem das Opfer oder der Zeuge eines Verbrechens die Untat beschrie.
Jacob Findling war zutiefst enttäuscht. Alles hatte er versucht. Er hatte auf Knien gelegen. Er hatte ewige Treue geschworen. Er hatte Verse vorgetragen. Sogar geweint hatte er. Aber sie – sie hatte nur gelacht.
Sie lachte gern, obwohl es Sünde war, denn das Lachen hatte der Teufel gemacht. Die Kirche verlangte, dass man das irdische Jammertal mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf durchquerte. Jeder Mensch und das Weib zumal neigte zur Sünde, und die Kirche wurde nicht müde, jederzeit daran zu erinnern.
Jacob zog den Kopf ein und ließ die Schultern hängen. Er war einer der größten Sünder von Hildesheim. Davon war er überzeugt. Er begehrte eine Frau. Weil er sie begehrte, hatte er sündige Gedanken. Weil er sündige Gedanken hatte, verübte er Schandtaten an sich selbst. Aber nicht nur deshalb lief er mit eingezogenem Kopf und hängenden Schultern die Stobenstraße entlang; er tat es vor allem wegen des Regens.
Jacob war ein Findelkind. Irgendeine verzweifelte Mutter, die ihn nicht ernähren konnte, hatte ihn vor fast zwanzig Jahren vor der Tür des Knochenhauers Waldemar Klingenbiel abgelegt, vermutlich weil sie wusste, dass er nicht nur ein wohlhabender Mann war, sondern auch ein freigebiger Christenmensch. Klingenbiel hatte für die Andreaskirche einen Altar, ein Vikariat und jährlich zehn Wachskerzen gestiftet. Und er hatte den Findling aufgenommen, obwohl er damals schon eigene Kinder ernähren musste.
Jacob hatte den Hohen Weg erreicht und wandte sich nach rechts. Nachdem er von dem Mann, den er Vater nannte, aus der Gosse aufgelesen worden war, hatte Klingenbiels Frau Dorothea noch weitere vier Kinder entbunden. Zwei von ihnen waren bereits im Wochenbett eingegangen, eines im ersten Lebensjahr, und das letzte war mit seiner Mutter gestorben. Klingenbiel, damals zweiunddreißig Jahre alt, hatte die fünfzehnjährige Marie Roden zur Frau genommen und war mit ihr nunmehr seit neun Jahren verheiratet. In Marie Klingenbiel war Jacob verliebt. Er begehrte die Frau seines Meisters, die er täglich sah, denn zuerst als Lehrjunge und nun als Geselle lebte er mit Meister und Meisterin unter einem Dach. Wenn Klingenbiel das Haus verließ, um in einen Gasthof oder zu einer Versammlung seiner Zunft zu gehen, empfing Marie den Gesellen heimlich in ihrem Schlafgemach. Sie schäkerte mit ihm, was ihn nur noch verliebter machte, verweigerte ihm aber die Erfüllung seines drängendsten Wunsches. Gern würde er mit ihr schlafen, aber ihr Allerheiligstes öffnete sie ihm nicht.
Jacob eilte den Hohen Weg ein, zwei Klafter entlang, um dann zum Andreaskirchhof abzubiegen. Der Wind warf ihm Regen ins Gesicht, und dann begannen mit einem Mal die Glocken zu läuten. Jacob erschrak. Es dämmerte bereits, und wenn zu dieser Stunde die Glocken geschlagen wurden, musste etwas Beunruhigendes geschehen sein.
Da der Knochenhauer Waldemar den Jungen nicht an Kindes Statt angenommen hatte, war aus Jacob nie ein echter Klingenbiel geworden. Er hieß ja nicht einmal Jacob. Den Namen hatte sich der Herr Vater ausgedacht. Seine unbekannte Mutter hätte ihn womöglich lieber anders genannt. Vielleicht Johannes. Johannes wie der Evangelist. Der war immerhin der Lieblingsjünger von Gottes Sohn gewesen.
Wie der Lieblingsjünger von Gottes Sohn würde Jacob gern heißen. Doch weil Waldemar Klingenbiel das Findelkind am Namenstag des Heiligen aus dem Dreck gezerrt hatte, hieß er eben Jacobus. Jacobus Findling zu allem Überfluss.
Die Glocke rief die Bürger zusammen, doch Jacob galt der Ruf nicht. Er hatte im Haus seines Ziehvaters das Metzgerhandwerk gelernt und war seit einem Jahr Geselle, und als Geselle genoss er nicht das Bürgerrecht. Weil er nicht adoptiert worden war, konnte er das Bürgerrecht auch nicht erben. Nur wenn es ihm gelang, eine Meisterin zu heiraten, würde er vor dem Rat den Bürgereid ablegen können. Oder wenn er selbst ein Meister wurde. Aber wie sollte ihm das gelingen?
Natürlich konnte er die Zunftgenossen des Knochenhaueramts um die Eschung ersuchen. Aber vermutlich würden sie ihn eher auslachen, als ihm die Aufnahme in die Zunft zu gewähren. Er hatte weder Geld für den Erwerb des Bürgerrechts noch für Kerzen in der Kirche, für eine Waffe zur Verteidigung der Stadt oder gar für die Meisterköste: Jeder neu aufgenommene Meister musste seinen zechlustigen Amtsbrüdern Essen und Bier ausgeben. Vor allem jedoch konnte Jacob nicht nachweisen, dass er echt und recht geboren sei. Er war ein Findelkind, niemand wusste also, ob er ehelich oder unehelich geboren war, doch die Ämter nahmen nur ehelich Geborene auf. Aber Jacob Findling wollte um keinen Preis länger ein gewöhnlicher Beisasse sein. Er wollte hoch hinaus und war bereit, sogar Klingenbiels jüngste Tochter Magdalena zu ehelichen, die Einzige, die der Vater noch nicht unter die Haube gebracht hatte. Sie war erst zwölf, und sogar die alte Kirche würde eine solche Verbindung geißeln – aber für einen entsprechenden Obolus fand sich immer ein Priester bereit, seinen Segen zu erteilen. Die neue Kirche war nicht so leicht zu kaufen. Jacob verstand nicht viel von solchen Dingen, doch der Vater bekannte sich zu den Martinianern. Und er hatte Magdalena schon einem Sohn des Ratsherrn Heinrich von Alfeld versprochen. Jacob würde sie also nicht heiraten können. Außerdem liebte er Marie. Und die war verheiratet.
Jacob überquerte den Andreaskirchhof und erreichte, bis auf die Haut durchnässt, das Haus Blauer Schwan, in dem er seit beinahe zwanzig Jahren lebte. Er war hier glücklich gewesen, denn Klingenbiel hatte ihn nicht schlechter behandelt als seine leiblichen Kinder. Dafür liebte er den Mann, den er Vater nannte. Er war ihm sehr dankbar dafür, dass er ihm Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht hatte. Das hatte der Vater selbst getan, er hatte das Findelkind nicht auf eine Schule geschickt. Und Jacob war ein gelehriger Schüler gewesen, nicht weil er gern lernte, sondern aus Dankbarkeit.
Als Jacob die Diele des Hauses betrat, traf er auf den Hausknecht Matthias, der Klingenbiel schon seit sehr langer Zeit diente. Er war alt geworden bei dem Meister, versah seine Arbeit aber noch immer so, wie es von ihm erwartet wurde.
»Na, Geselle?«, fragte er und feixte. Matthias war damit beschäftigt, einen Sack Gerstenmalz durch die Diele zu wuchten. Oftmals grinste er, wenn er Findling sah, belächelte oder verspottete ihn sogar. »Wieder mit anderen Gesellen beim Bier gesessen und sich die Köpfe heiß geredet über diesen Mönch und seine Schriften, die ihr doch sowieso nicht versteht?«
»Du etwa? Verstehst du sie?«, fragte Jacob; er wusste schließlich, dass der Knecht nicht einmal lesen konnte. Aber Matthias hatte Recht: Viele der oftmals aufmüpfigen Gesellen hatten vom Rat verlangt, die evangelische Konfession in Hildesheim zuzulassen, weil sie sich davon eine Verbesserung ihrer Lage erhofften. Manchmal hatten sie sogar handfeste Argumente verwendet und Ratmannen angegriffen. Sie redeten auch gern von Luther und Melanchthon und selbst von Müntzer, dem Verbrecher. Aber Jacob beteiligte sich nie an diesen Gesprächen, er lauschte nur.
Matthias zuckte mit den Schultern – und grinste. Jacob hasste dieses herablassende Grinsen des Knechts, der ihm immer schon zu verstehen gegeben hatte, was Jacob, der gern Johannes heißen würde, in Wahrheit war: Bloß ein Kind aus dem Abtritt. Ein Nichts, verurteilt zu ewiger Dankbarkeit seinem Adoptivvater gegenüber. Ja, dankbar musste er sein, immer nur dankbar. Aber er konnte lesen, schreiben und rechnen, er beherrschte das Handwerk des Knochenhauers, warum also sollte er nicht Meister werden? Mit einer Meisterin an seiner Seite, mit einem eigenen Haus, mit einem Scharren im Haus des Knochenhaueramtes von Sankt Andreas – eines von drei Schlächterämtern der Stadt – und mit Gesinde, Lehrjungen, Gesellen?
Die Verfassung der Stadt und die Zunftordnung sprachen dagegen, und das waren eherne Regeln, die niemand auch nur in Zweifel zog. Wenn nicht ein Wunder geschah, konnte nur Klingenbiels Tod ihm helfen.
Auf dem Markt hatten sich beim Pipenborn, der Hildesheimer Wasserkunst, etliche bewaffnete Bürger versammelt, die nicht gerade glücklich waren, bei Sturm und Regen zusammengerufen worden zu sein. Tile Brandis entdeckte auch einige Ratsherren sowohl des sitzenden als auch des ruhenden Rates, die sich um Bürgermeister Harmen Sprenger geschart hatten. Bei ihnen war Brandis’ Platz, also gesellte er sich dazu.
»Was ist denn geschehen?«, verlangte er zu wissen.
»Einem auswärtigen Kaufmann wurde die Kehle durchgeschnitten«, sagte Consul Dirich Raven und strich sich über den Kugelbauch, wie er es häufig tat. Selbst der lange und weite dunkle Mantel vermochte den Bauch nicht zu verbergen, und das sollte er auch gar nicht; man sagte Raven nach, dass er sehr stolz auf seine Beleibtheit war, weil sie von Wohlstand sprach. Der Ratsherr gehörte zu den reichsten Kaufleuten der Stadt, rangierte in der Schoßliste gleich nach Brandis und aß sehr gern und viel. Er hielt es nicht mit den Mönchen, die mehr als zwei Mahlzeiten am Tage für tierisch ansahen. Und warum sollte er auch? Er war kein Mönch, und mochte seine Esslust auch tierisch sein, ihm schmeckte es.
»In der Badestube«, ergänzte Hinrich Einem, der am Sonnabend nach den Drei Königen aus dem sitzenden Rat ausgeschieden war. Er gehörte damit immer noch dem Rat an, musste aber an dessen Sitzungen nur noch teilnehmen, wenn es um lebenswichtige Entscheidungen ging.
»In der Badestube?« vergewisserte sich Tile Brandis. »Das ist ja eine besonders gemeine Tat. Im Zuber ist ein Mensch ganz nackt und hilflos.«
Hinrich Einem nickte. Im Schein der Fackeln und Traglampen wirkten seine wasserblauen Augen mehr wässrig als blau.
Die Glocke war mittlerweile verstummt, und gewiss waren auch längst alle Tore verschlossen worden, damit der Täter nicht entwischen konnte – wenn er sich überhaupt noch in der Stadt aufhielt.
»In der Lovekenstube«, sagte Eggert Unverzagt. Er war nicht weniger dick als Raven, versuchte aber im Gegensatz zu diesem, seinen Bauch mit allerlei bunter Kleidung zu verbergen, womit er jedoch noch besonders auf seine Fettleibigkeit aufmerksam machte.
Aus der Saustraße eilte gerade Christoph von Hagen mit einem Dutzend seiner Anhänger herbei. Von Hagen stand nicht nur einem der sechs Stadtquartiere vor, die man Bäuerschaften nannte, und zwar der Großen Bäuerschaft, die sich um den Andreaskirchhof und den Großen Markt erstreckte, er war auch Führer der Hildesheimer Protestanten. Christoph war sehr groß und hatte breite Schultern. Man sagte ihm nach, dass er stark sei wie ein Bär. Tile Brandis konnte das nicht beurteilen, da er seine Kräfte weder mit Bären noch mit von Hagen maß.
»Und woher stammt das Opfer?«, fragte er den Proconsul Sprenger.
»Aus Einbeck.« Sprengers eng stehende Augen verliehen seinem Fuchsgesicht einen schwer zu deutenden Ausdruck. Manche hielten ihn für listig, andere für dumm. Tile Brandis neigte zu Letzterem, sprach es aber niemals aus, nicht einmal hinter geschlossenen Türen; dafür war er wiederum zu klug.
Der Bürgermeister winkte Christoph von Hagen zu sich. Der Vorsteher der Majorisbäuerschaft wischte sich mit einem Tuch das Regenwasser aus dem Gesicht.
»Man hört von Mord«, sagte er.
»In der Lovekenstube«, sagte Unverzagt noch einmal. »Unmöglich!« Von Hagen war genauso überrascht, wie Brandis es gewesen war.
»Wir müssen die ganze Stadt nach dem Verbrecher durchkämmen«, sagte Bürgermeister Sprenger. »Am besten Bäuerschaft für Bäuerschaft. Christoph, teile du die Leute ein.«
»Kennen wir den Untäter denn?«, fragte dieser.
»Noch nicht.« Harmen Sprenger schüttelte den Kopf. »Nimm erst einmal jeden fest, der verdächtig aussieht und sich verdächtig verhält. Ich begebe mich mit dem Rat zur Lovekenstube, um den Bader, seine Mägde und Knechte sowie unseren Freund Heinrich von Alfeld zu verhören. Wenn wir Genaueres in Erfahrung bringen, schicke ich dir einen Boten.«
»Heinrich von Alfeld?«, fragte Tile Brandis.
»Er war mit dem Einbecker in der Badestube«, erklärte Ratsherr Raven. »Offenbar sind sie Geschäftspartner. Gewesen.«
»Christoph, du weißt, was zu tun ist?« Bürgermeister Sprenger drängte zum Aufbruch; ihm war deutlich anzusehen, dass er den unwirtlichen Markt so schnell wie möglich verlassen wollte. Christoph von Hagen nickte. Er wandte sich zu seinen Männern um und erteilte ihnen ein paar knappe Befehle, dann ging er zu den bewaffneten Bürgern beim Pipenborn. Nachdem er sie eingewiesen hatte, strömten sie in kleinen Gruppen in alle vier Himmelsrichtungen auseinander. Einige versuchten sogar, Pechfackeln zu entzünden, aber wenn es ihnen überhaupt gelang, die durchfeuchteten Fackeln in Brand zu setzen, blies der Sturm sie rasch wieder aus.
Bürgermeister Sprenger seufzte. Er schlug den Pelzkragen hoch, schaute seine Ratsleute aufmunternd an und forderte sie mit einem Nicken in Richtung der Saustraße auf, ihm zu folgen.
»Wir wissen ja nicht einmal, ob der Verbrecher noch in der Stadt ist«, sagte Consul Einem.
»Oder die Verbrecher«, gab Eggert Unverzagt zu bedenken. »Für eine Ausjagd ist es ja wohl zu dunkel«, meinte der Proconsul Sprenger unwirsch.
»Und dann dieses Wetter!«, stöhnte Dirich Raven und strich sich über den Bauch.
Heinrich von Alfeld hockte, mittlerweile vollständig angekleidet, auf einer Bank beim Kamin und ließ den Kopf hängen. Die beiden Bademägde, ebenfalls nicht mehr nackt, kauerten auf dem kühlen Steinboden. Immer wieder brachen sie in Tränen aus. Der Knecht wiederum lehnte an der Wand und starrte vor sich hin. Niemand verlor ein Wort, und keiner wagte, den Blick zu heben und zu dem Badezuber zu schauen, in dem die Leiche des Einbeckers versunken war. Der Vorhang war noch immer aufgezogen, und wer genau hinschaute, konnte die Blutspritzer an der weiß gekalkten Wand sehen, aber es schaute eben keiner hin.
Der Bademeister wartete trotz des Unwetters vor seinem Haus in der Stobenstraße. Er war es gewesen, der das Verbrechen lauthals beschrien hatte, wie es das Gesetz verlangte. Außerdem hatte er die Nachbarn dazu angehalten, die Büttelei zu verständigen, und dafür gesorgt, dass die Glocke geläutet wurde. Immerhin war er ein Bediensteter der Stadt, er wusste genau, was von ihm erwartet wurde, Umsicht nämlich und Wohlverhalten.
Einer der Büttel war sofort zu ihm geeilt, hatte einen angewiderten Blick in den Badezuber geworfen und wartete nun mit ihm auf die Ratsherren. Diese hatten keinen allzu langen Weg zurücklegen müssen. Sie waren durch die Saustraße gehastet, die den Markt an seiner südwestlichen Ecke verließ und in der viele hoch angesehene und reiche Bürger lebten, hatten den Hohen Weg überquert und dann bereits den Anfang der Stobenstraße erreicht, die sozusagen die westliche Verlängerung der Saustraße darstellte. Als er die Ratmannen entdeckte, ging der Bader unverzüglich auf sie zu.
»Ihr Herren!«, rief er. »Welche Not, welche Not!«
»Ja, ja!« Bürgermeister Sprenger schob den Bader beiseite. Sein Hermelinmantel hatte sich mittlerweile vollgesogen wie ein Schwamm, und er eilte voran zur Lovekenstube, also dorthin, wo man zumindest vor dem Regen Schutz fand.
»Berichte!«, forderte Tile Brandis den Bademeister auf, während sie dem Bürgermeister folgten. Auch die übrigen Consules schlossen sich ihnen an.
»Ich weiß nichts«, beteuerte der Bader. »Drei Gäste kamen heute nur …«
»Drei?«
»Ja, Herr! Der hochlöbliche Ratmann von Alfeld, sein Freund aus Einbeck und der Knochenhauer von Sankt Andreas, der hoch angesehene Herr Waldemar Klingenbiel …«
»Der war auch im Bad?«
»Nein, Herr. Er leidet seit Wochen unter Heiserkeit und Magendrücken. Ich habe ihn zur Ader gelassen.«
»Ach was, Magendrücken?« Consul Raven zog die Brauen hoch. »Das kommt wohl von der Völlerei …«
Die Männer betraten eine kurze und schmale Diele, von der mehrere Räume abgingen. Der Bader wies nach links. Dunst schlug den Ratsherren entgegen, als sie in die eigentliche Badestube einrückten.
Heinrich von Alfeld hob den Blick. Er war selbst Ratmann, und doch stand er auf, als er den Primus inter pares zwischen Brandis, Raven, Einem und Unverzagt ausmachte, schließlich war er ein höflicher Mann selbst noch in einer Situation, in der niemand von ihm Höflichkeit erwartete. Der Knecht trat einen Schritt vor, die Mägde klammerten sich aneinander. Nach wie vor boten sie ein Bild des Jammers.
»Wo?«, erkundigte sich Sprenger. Der Bader wies zu den beiden hölzernen Wannen. Sprenger ging sehr langsam auf sie zu. Er schaute in den rechten Zuber, und seine Gesichtshaut wurde augenblicklich weiß. »Teufel auch«, flüsterte er.
Tile Brandis trat ebenfalls näher, während sich die drei übrigen Ratsherren lieber im Hintergrund hielten. Vornübergesunken schwamm ein nackter Mensch im Zuber. Ein Brett lag quer über der Wanne, auf dem eine Weinkruke und ein Becher umgestürzt waren. Der Rebsaft war über das glatte Holz gelaufen und dann in das Wasser getropft, aber nicht er hatte für dessen blutige Farbe gesorgt. Brandis drehte sich um.
»Büttel!«, rief er. Dann deutete er zu dem Toten. »Hebe ihn heraus!«
Der Büttel tat, wie ihm geheißen. Er packte den schweren Körper und mühte sich redlich, aber allein schaffte er es nicht, ihn aus dem Wasser zu zerren. Allerdings gelang es ihm, den Toten wenigstens aufzurichten. Dessen Kopf fiel sofort nach hinten. Sprenger und Brandis wichen einen Schritt zurück. Eine tiefe Wunde mit glatten Rändern, die offenbar bis zu den Wirbeln reichte, gähnte unterhalb des Kehlkopfs. Es sah aus, als habe der Tote einen zweiten, riesigen Mund, der die Ratsherren blutig angrinste.
»Gott im Himmel!«, murmelte Tile Brandis und schaute rasch zu Heinrich von Alfeld. »Wer dies auch immer angerichtet hat, wie konnte er nur entkommen?«
Balthazar Fannemann, Dominikanermönch, Professor der Theo logie, seit seiner Ernennung durch Papst Paul III. am zwanzigsten August im Jahr des Herrn 1540 Titularbischof von Missene, Weihbischof von Hildesheim und damit Vikar Bischof Valentins in pontificalibus, setzte sich zu Tisch. Da er nicht gern allein speiste, hatte er ein paar Vertraute um sich versammelt: den bischöflichen Offizial, der für die geistliche Gerichtsbarkeit im Stift zuständig war, den Subdiakon Johann Caspari von Sankt Godehard, der ihm bei vielen seiner Weihehandlungen half und gelegentlich delikate Aufträge erledigte, den Domherrn Arnold Friedag sowie als Ehrengast einen gerade aus Rom zurückgekehrten Pilger.
Eigentlich war es nicht üblich, dass Wallfahrer zum Essen auf die Domburg eingeladen wurden, aber Bruder Eusebius war nicht irgendwer. Er gehörte ebenso wie Fannemann dem Dominikanerorden an, die beiden Männer kannten sich, und zwar seit langem. Sie hatten gemeinsam die theologische Fakultät der Universität von Paris besucht, waren sich bei Kapiteln der Ordensprovinz Saxonia gelegentlich wieder begegnet und hatten so manche gelehrte Disputation geführt, denn Eusebius war ein ausgesprochen schriftkundiger Mann und der Weihbischof immerhin Professor. Vielleicht war es zu hochgegriffen, von einer Freundschaft zu sprechen, aber Balthazar und Eusebius standen sich durchaus nahe. So nahm es nicht wunder, dass Bruder Eusebius nach seiner Ankunft in Hildesheim sogleich seinen alten Bekannten aufsuchte, von dessen beachtlicher Karriere er bereits auf seiner Reise gehört hatte.
Fannemann hatte ihn gebeten, zum Essen dazubleiben, auch weil er von ihm Neuigkeiten aus dem Dunstkreis der päpstlichen Kurie zu erfahren hoffte. Die Bedienmagd hatte kaum die Gurkensuppe mit Safran, Pfeffer und Honig aufgetragen, da sprach er ihn sofort darauf an. »Nun verrate uns doch, lieber Bruder Eusebius, was pfeifen die Spatzen in Rom von den Dächern?«, bat er mit einem Lächeln.
»Das lässt sich nicht mit ein paar Worten sagen, Eminenz«, entgegnete der Mönch. Der Weihbischof lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Eusebius sah angegriffen und erschöpft aus, aber er hatte ja auch eine lange, eine sehr lange Reise hinter sich.
»Nicht doch!« Fannemann winkte ab, ohne die verschränkten Arme voneinander zu lösen. »Wir sind Ordensbrüder, also vergiss die Formalitäten.« Immerhin hatte Fannemann sein schwarz-weißes Habit angelegt und auf alle Zeichen seiner bischöflichen Macht und Würde verzichtet, die ohnehin nur geborgt waren; als Weihbischof vertrat er den Hildesheimer Oberhirten Valentin von Teteleben bei allen kirchlichen Amtshandlungen. Bischof Valentin hielt sich nur selten in seiner verarmten Diözese auf. Er war nicht nur Episcopus Hildensemensis, sondern auch Domherr zu Mainz, aber nicht wegen der dortigen Anwesenheitspflicht war er so häufig abwesend. Der Grund war seine Domherrnpfründe, aus der er das Geld bezog, das er so dringend brauchte. Außerdem hatte Teteleben am Reichstag zu Speyer teilgenommen, wo er dem päpstlichen Gesandten am dritten März ein Memorial überreicht hatte, an dessen Abfassung Fannemann beteiligt gewesen war: ›Ich fand die hildesheimische Kirche verwahrlost in geistlicher und irdischer Hinsicht und beraubt aller bischöflichen Tafelgüter, so dass sie mir den Lebensunterhalt nicht bietet. Nichtsdestoweniger habe ich durch fleißige Reform meiner Kirche und Haltung einer bischöflichen Synode die erforderliche Ordnung im Bistum zurückgeführt; ich habe einen Weihbischof und Offizial, desgleichen Seelenhirten und Kirchen-Rektoren an Orten der Stadt und Diözese Hildesheim angestellt, die dem Volke im Dienste der gesunden Lehre und in Verwaltung der Sakramente durch Wort und Beispiel Führer und Helfer sind, so dass durch Gottes Gnade bis jetzt meine Kirche mit genügend gutem Erfolge regiert ist.‹ Auf diese Schrift, die er seinem Bischof quasi in die Feder diktiert hatte, war Fannemann nicht wenig stolz. Und stolz war er auch auf seine Stellung innerhalb des Bistums, die er allein Eusebius zu Ehren an diesem Tag nicht betonen wollte. Fannemann regierte das Stift. Das wurde von Tag zu Tag schwieriger, aber noch gelang es ihm, das Schiff um alle Klippen zu steuern. Die größte und gefährlichste Klippe waren die Protestanten. Es wurden immer mehr.
»Auch wir sind erpicht, von Rom zu hören«, sagte Domherr Friedag. Fannemann schaute Eusebius an und zuckte die Schultern. Er wusste, dass Friedag ihm nur nach dem Munde redete. Was den Weihbischof bewegte, das bewegte scheinbar auch das Kapitel. Aber Fannemann war schon seit langem klar, dass die Domherren nur ihren eigenen Interessen folgten, die mit Lehen und Pfründen zu tun hatten und nicht mehr mit dem Glauben. Der größte Fehler bestand darin, ihnen zu vertrauen. Fannemann vertraute niemandem, nicht einmal dem Bischof, sondern nur sich selbst. Und er vertraute Eusebius, weil der ihm nicht gefährlich werden konnte.
Der Mönch tunkte seinen Löffel in die Suppe.
»Am meisten hat den Hof unseres Pontifex und wohl auch ganz Rom ein Fresko erregt«, sagte er, bevor er den Löffel zum Mund führte.
»Ein Fresko?«, fragte Johann Caspari. Weihbischof Fannemann nickte. Er hatte schon davon gehört.
»Eine Wandmalerei von ungeheurer Wucht und Größe«, erklärte Eusebius. »Paul hat einen sehr berühmten Florentiner Maler damit beauftragt, die Sixtinische Kapelle auszumalen. Michelangelo Buonarroti heißt dieser Maler, und er arbeitete sechs Jahre an einem Jüngsten Gericht. Am Abend vor Allerheiligen Anno Domini 1541 wurde es enthüllt.« Der Dominikanerpater nahm rasch noch einen Löffel von der Gurkensuppe, bevor die Magd sie forttrug. Wenige Augenblicke später wurde gesottener Karpfen in Rosinensoße aufgetischt. Da Fannemann sich in erster Linie als Ordensbruder sah, achtete er streng auf die Speisegebote. Die Verlotterung der Sitten in den Klöstern und beim Klerus allgemein bekämpfte er, soweit es in seiner Macht lag, und deshalb kam bei ihm kein Vierfüßlerfleisch auf den Tisch. Er war sicher, dass Eusebius diese Strenge zu schätzen wusste. Dieser schien gerade mehr mit der Sättigung seines gesunden Appetits beschäftigt und blickte hungrig auf den Karpfen. Allzu viele Berichte aus der ewigen Stadt konnten sie wohl nicht von dem weit gereisten Mönch erwarten, sonst würde dieser am vollen Tisch des Weihbischofs verhungern.
»Und was machte dieses Fresko zum Gesprächsgegenstand der Kurie?«, wollte Friedag denn auch wissen. Die Magd legte auf.
»Nun, sehr vieles. Man warf dem Maler Unzüchtigkeit vor, ja sogar Ketzerei. Christus ist dargestellt wie ein jugendlicher heidnischer Titan – und ohne Bart! Die Engel sehen aus wie Ringkämpfer, Johannes der Täufer gar ist vollkommen nackt. Bei der heiligen Katharina sieht man den baren Busen, und …«, Eusebius schluckte, »und bei vielen männlichen Figuren das Geschlechtsteil.«
»Unerhört!«, rief der Offizial. »Das ist Blasphemie!« Weihbischof Fannemann zuckte nur die Achseln. Er freute sich über den Besuch seines Mitbruders Eusebius und war mild gestimmt. Davon abgesehen, wusste er über das Geschlechtsleben seines Offizials genau Bescheid. Es war mehr als blasphemisch, aber Fannemann schwieg dazu: Als Weihbischof setzte er seine Bediensteten wie Schachfiguren, und Schachfiguren hatten keine Seele. Er liebte dieses Spiel, und das Schachzabelbuch des Konrad von Ammenhausen kannte er beinahe auswendig. Die Dombibliothek besaß eine Abschrift, die aber in den Listen des Küsters als ständig ausgeliehen erschien: Fannemann las neben der Heiligen Schrift Konrads Werk als Einschlafhilfe. Von Ammenhausen war ein Benediktiner gewesen und hatte dieses wunderbare Buch im Sankt-Georgen-Kloster in Stein am Rhein verfasst. Eigentlich handelte es weniger vom Schach als von der Moral. Moral konnte die Menschheit dringend gebrauchen. Sie war notwendiger als Nahrung, denn ein großer Teil der Geschöpfe Gottes hatte keine mehr.
»Nun ja«, Eusebius gelang es, rasch ein Stück Fisch in den Mund zu schieben, das er hastig verschluckte, denn die Magd war mit dem nächsten Gang erschienen. Wenn man ihm noch weiter Löcher in den Bauch fragte, würde er vermutlich an der reich gedeckten Tafel seines Ordensbruders verhungern.
Fannemann hatte es immerhin zum Weihbischof gebracht. Trotz dessen aufmunterndem Lächeln fühlte sich Eusebius ziemlich klein neben ihm. Und Eusebius liebte das Werk dieses verrückten Michelangelo ebenso wie sein Papst. Es war vermutlich nicht ganz der Schrift treu, aber es war erhebend. »Der Heilige Vater jedenfalls sank vor dieser gewaltigen Arbeit sofort auf die Knie.« Eusebius warf einen verstohlenen Blick auf den kross gebratenen Kapaun.
Doch bevor sich die Herren dem verschnittenen Hahn widmen konnten, erschien ein bischöflicher Beamter.
»Da sind zwei Weltgeistliche, Eminenz, die Euch dringend zu sprechen wünschen«, meldete er.
»Später«, sagte der Weihbischof mit säuerlicher Miene. »Wir essen jetzt.«
»Das sehe ich, Herr«, sagte der Beamte. »Aber die beiden Priester wirken ziemlich abgehetzt. Es scheint sich um eine wichtige Angelegenheit zu handeln.«
Eusebius griff schnell nach einem Flügel und brach ihn ab. Fannemann nickte ihm aufmunternd zu, während er zu dem Beamten sagte: »Dann bitte sie in Gottes Namen herein.«
Nachdem sie mit Heinrich von Alfeld und den Bademägden gesprochen hatten, konnten sich die Ratsherren ein ungefähres Bild von der Tat machen. Irgendjemand hatte sich in die Badestube geschlichen, den Vorhang hinter seinem Opfer beiseite geschoben, ihm mit einem schnellen, kräftigen Schnitt die Kehle durchtrennt und war dann unerkannt hinausgelaufen in Regen und Sturm. Der Mörder war ein ziemlich hohes Risiko eingegangen, denn immerhin hatte der Ratmann von Alfeld direkt neben seinem Opfer gesessen, oder der Bader und sein Knecht hätten ihn überraschen können. Sie befanden sich zwar in einem Nebenraum, wo sie den Knochenhauer Waldemar Klingenbiel zur Ader ließen, aber es hätte immerhin sein können, dass einer von ihnen die eigentliche Badestube betrat, um sich nach dem Befinden der Gäste zu erkundigen. Waldemar Klingenbiel hatte übrigens von dem Ereignis nichts mitbekommen. Erschöpft vom Aderlass, war er eingeschlafen, und er schlief immer noch.
»Und Ihr habt wirklich nichts gesehen?«, fragte Bürgermeister Sprenger den Ratskollegen Meister Alfeld.
»Ich sagte doch schon, dass ich die Augen geschlossen hielt«, erwiderte Heinrich. »Ich wollte das Bad genießen …«
Mehr wohl die geschickten Hände und Lippen der Magd, dachte Tile Brandis, sagte jedoch nichts; er behielt seine Meinung lieber für sich, solange ihm nicht ausdrücklich ein Kommentar abverlangt wurde.
»Aber du?« Sprenger deutete auf die jüngere der Bademägde. Sie trug eine sehr offenherzige Bluse, und Brandis war sicher, dass sie Männern für Geld in jeglicher Hinsicht dienstbar war. »Oder du?« Sprenger zeigte auf die andere Magd, die weitaus älter und bereits grauhaarig war und züchtig tat. Beide schüttelten den Kopf. Sie sahen noch immer verheult aus, weinten aber nicht mehr.
»Warum ist Peter Groper überhaupt nach Einbeck gekommen?«, fragte Tile Brandis von Alfeld.
»Wir wollten über ein Geschäft sprechen«, antwortete der Metzgermeister.
»Welche Art von Geschäft?«
»Peter lieferte mir Bier«, erklärte von Alfeld. »Zehn Fuder im Frühjahr und zehn Fuder im Herbst, also vierzig Fässer pro Jahr. Zwanzig Fässer kaufte ich im Auftrag des Rates für den Ausschank im Einbeckschen Keller. Die andere Hälfte habe ich nach Braunschweig weitergehandelt.«
»Und er brachte Euch das Bier nach Hildesheim?«
»Natürlich nicht. Ihr wisst doch genau, Tile, dass die Einbecker Brauer normalerweise Zwischenhändler benutzen. Aber was sollen diese Fragen?«
Tile Brandis schaute den Ratsherrn und Knochenhauer ernst an. »Mein lieber Heinrich, warum sind wir hier?«
»Ja, natürlich. Verzeiht!« Heinrich von Alfeld fuhr sich über die Augen. »Ich habe einen Freund verloren … Doch fragt weiter, ich will Euch Rede und Antwort stehen.«
»Danke.« Tile Brandis blickte zu den anderen Ratsherren. Consul Raven bemühte sich um eine undurchdringliche Miene, während er sich über seinen Bauch strich. Aus den Gesichtern von Hinrich Einem und Eggert Unverzagt war deutlicher Widerwille abzulesen, und das Interesse von Bürgermeister Sprenger galt vor allem den Mägden. Doch alle vier, das spürte Brandis, wären froh, wenn er die Untersuchung übernahm. Das war nicht seine Aufgabe, er war im Rat nicht für die Gerichtsangelegenheiten zuständig. Über den Mörder zu Gericht zu sitzen, wenn man seiner denn habhaft wurde, war allerdings Sache des ganzen Rates. Tile war vor allem neugierig. Und dass hier etwas faul war, lag auf der Hand.
»Ich nehme also an, Heinrich«, er wandte sich wieder dem Knochenhauer zu, »dass Ihr nach Einbeck fuhrt, um das Bier zu holen?«
Heinrich von Alfeld nickte. »Meine Knechte fuhren«, sagte er.
»Wann hätten sie wieder fahren sollen?«
»Sobald das Wetter besser ist.«
»Ja, seht Ihr, und das verwirrt mich. Es regnet und stürmt seit Tagen …« Ratmann Brandis ließ sein Gegenüber nicht aus den Augen. »Und ausgerechnet bei diesem Unwetter macht sich Peter Groper auf den Weg nach Hildesheim, um mit Euch ein Geschäft zu besprechen?«
Heinrich antwortete mit einem Schulterzucken.
»Worum ging es denn?«
»Das weiß ich nicht!« Alfeld setzte einen gequälten Ausdruck auf. »Er ist heute angekommen. Deshalb habe ich einen Abend in der Badestube vorgeschlagen: damit er sich nach der Reise so richtig durchwärmen kann. Über die Geschäfte wollten wir erst beim Essen sprechen.«
»Wo ist sein Reisegepäck?«
»In meinem Haus. Peter war mein Gast, also hat er auch bei mir gewohnt.«
»Ich finde, das genügt jetzt«, mischte sich Proconsul Sprenger ein.
Brandis vermutete, dass es den Bürgermeister zur Abendsuppe und zum Rheinwein zog, aber er überging den Einwand. »Ich möchte das Gepäck sehen.«
»Ich bringe es aufs Rathaus«, sagte Alfeld.
»Gut. Büttel!« Tile Brandis drehte sich abrupt um.
»Ja, Herr?«
»Sorge dafür, dass auch der Leichnam zum Rathaus gebracht wird«, befahl Brandis. »Dann rufe den Stadtphysikus, damit er die Wunden vermessen kann.«
So verlangte es das Gesetz. Vom Umfang und der Tiefe der Wunden hing ab, wie hoch der Schadenersatz war, den der oder die Täter den Angehörigen des Opfers zu leisten hatten – wenn man ihn oder sie denn fand. Groper war kein Bürger Hildesheims. Dennoch hatte seine Familie Anspruch auf Rechtsbehelf durch den Hildesheimer Rat, was Brandis richtig fand. Einbeck gehörte zur Sächsischen Städtekonkordie. Deren Gründungsurkunde war im Jahr des Herrn 1384, also vor Brandis’ Geburt, von Goslar, Braunschweig, Hildesheim, Hannover, Lüneburg, Einbeck, Helmstedt, Göttingen, Halberstadt, Quedlinburg und Aschersleben besiegelt worden. Anno 1426 hatte man den Vertrag nicht nur bekräftigt, sondern ihn auch erweitert. Magdeburg, Halle an der Saale, Osterode und Nordheim waren aufgenommen worden, und man hatte sich gegenseitiger Rechtshilfe versichert. Wurde in einer der Städte ein Verbrechen begangen, oder wurde ein Bürger dieser Städte Opfer einer Untat, waren alle Städte verpflichtet, den Täter zu verfolgen. Tile Brandis hielt diesen Vertrag für ein ausgesprochen kluges und ehrenwertes Dokument, zumal er an seiner Abfassung mitgewirkt hatte.
»So soll es sein«, sagte Harmen Sprenger. Offenbar wollte er so schnell wie möglich den Ort der Untat verlassen.
»Bader, eines möchte ich von dir noch wissen.« Tile Brandis sprach zwar den Bademeister an, schaute aber auf Alfeld.
»Ja, Herr?«
»Als du Klingenbiel zur Ader ließest, war dein Knecht bei dir, nicht wahr? Warum?«
»Er musste das ausströmende Blut in einer Schale auffangen«, entgegnete der Bader.
»Hochwürden, ein Mord!«, sagte einer der beiden Kleriker, kaum dass sie das bischöfliche Speisezimmer betreten hatten. Der Schweiß lief ihm über das Gesicht.
»Ein Mord?« Der Offizial richtete sich auf.
»In der Stadt«, sagte der zweite Geistliche. Er war jünger und schwitzte nicht so stark. »Ein Holzhändler aus Einbeck … In der Badestube … erstochen.«
»Auf städtischem Rechtsgebiet?«, erkundigte sich Domherr Friedag. Die Geistlichen nickten. Bruder Eusebius legte den Hahnenflügel zurück auf den Teller.
»In der Badestube?« Fannemanns Mund umspielte ein kaum wahrnehmbares Lächeln. Bruder Eusebius bemerkte es und war verwundert, denn ein Mord war ein verdammenswertes Verbrechen, über das man nicht schmunzelte. Traurig blickte er zu dem Kapaun. Eine innere Stimme sagte ihm, dass der Vogel unverzehrt in die Küche wandern würde.
»Wenn das Verbrechen auf städtischem Grund begangen wurde«, sagte der bischöfliche Offizial, »dann ist der Rat für die Verfolgung und das Gericht zuständig.«
»Was heißt: Wenn?«, fragte Fannemann sichtlich vergnügt. »Wir wissen doch, dass die Untat dem Stadtrecht unterliegt, schließlich wurde sie in einer städtischen Badestube begangen. Sie geht uns also überhaupt nichts an.«
»So ist es«, bestätigte Eusebius. Noch stand der Kapaun auf dem Tisch, und der Mönch hatte mittlerweile solchen Hunger, er würde ihn auch kalt verschlingen, wenn das nicht unangemessen wäre.
»Für den Rat ist das natürlich eine unerfreuliche Angelegenheit«, meinte der Weihbischof. »Morde gibt es ja häufiger, aber stellt euch mal vor, was geschieht, wenn sich herumspricht, dass der Rat nicht in der Lage ist, Fremde innerhalb der Stadtmauern vor Übergriffen zu schützen. Danke!« Fannemann bedeutete den beiden Weltgeistlichen mit einem Fingerzeig, dass sie sofort verschwinden sollten. Sie gingen hinaus, begleitet von dem bischöflichen Beamten. Eusebius starrte nicht mehr den Kapaun, sondern seinen Ordensbruder an: Fannemann brütete offensichtlich einen hinterhältigen Gedanken aus. »Man könnte die Tat auch als Verletzung des Gastrechts sehen«, spann dieser seinen Einfall fort, nun ohne unberufene Zeugen. »Ein Zeichen des Chaos, ausgelöst von den Lutheranern. Denkt an die Einbecker. Sie haben 1529 die evangelische Konfession eingeführt, und elf Jahre später brennt die Stadt ab. Ein Strafgericht Gottes?« Fannemann hatte sich in eine Hochstimmung geredet, aber nur Eusebius bemerkte es.
»Den Brand hat man doch aber Heinrich dem Jüngeren angelastet, und der ist bekanntlich seit dem Tod Herzogs Georg von Sachsen der einzige katholische Fürst im Norden des Reiches«, gab Johann Caspari zu bedenken. »Mehr noch, als Kaiser Karl 1538 in Nürnberg den Heiligen Bund gründete, bestellte er Herzog Heinrich zum Bundeshauptmann für Norddeutschland …«
»Ja, ja, das ist bekannt.« Balthazar Fannemann wischte den Einwand mit einer herrischen Geste fort. »Angelastet, hast du richtig gesagt. Es wurde ihm angelastet. Glaubst du es denn? Warum sollte der Herzog eine solche Brandstiftung in Auftrag geben? Man hat einfach einen Schuldigen gesucht, und ein katholischer Reichsfürst passt den Martinianern natürlich am besten ins Konzept.« Er trank einen Schluck Wein. »Aber selbst wenn es wahr wäre – das ist vollkommen gleich. Nicht die Wahrheit entscheidet, sondern das, was man dafür ausgibt. Caspari, hole meinen Sekretär!«
Der Subdiakon stand auf und verließ schnurstracks den Raum. Balthazar Fannemann lächelte Bruder Eusebius zu. Der begann sich ein wenig unbehaglich zu fühlen, weil er nicht wusste, womit er dieses Lächeln verdient hatte. Der Weihbischof plante etwas, das war ihm an der Nasenspitze anzusehen. Eusebius war klug und gebildet, er verfügte auch über Menschenkenntnis, und doch ahnte er nicht, was Bruder Balthazar vorhatte. Immerhin war sein alter Freund ein Mann der Macht. Wenn solche Männer etwas ausheckten, kam selten etwas Gutes dabei heraus.
Der bischöfliche Secretarius erschien sofort, als hätte er in einem Nebenraum auf die Befehle seines Herrn gewartet. Fannemann diktierte ihm ein Schreiben an alle Prediger des Stifts, die dem Bischof unterstellt waren. Er wies sie an, in ihren Kanzelreden die von den Protestanten verursachte Unordnung und seelische Verwirrung für den Mord in Hildesheim verantwortlich zu machen. Sie sollten aber nicht die Gelegenheit nutzen, die Badestube als Ort der Sünde zu brandmarken; es komme allein darauf an, das Verbrechen als Ausdruck religiöser Wirren zu deuten. Nur ein Mensch, der gegen Gottes ewige Ordnung eingestellt sei, könne einem anderen Menschen, der von Kleidung und Waffen entblößt ein Bad nähme, Derartiges antun.
»Gegeben zu Hildesheim etc. pp., D. theol. Fannemann, Vikar des Episcopus Valentin in pontificalibus etc. pp.«, beendete der Weihbischof sein Diktat und lehnte sich zufrieden zurück. Eusebius war beeindruckt. Negativ beeindruckt, wenn es so etwas gab. Fannemann war ein brutaler Fuchs. Und der Kapaun war mit Sicherheit eiskalt. »Schreib es nun schnell in der notwendigen Anzahl ab und bringe es mir zum Siegeln in mein Kabinett«, befahl der Weihbischof seinem Sekretär. »Ich möchte, dass es morgen nach Sonnenaufgang von Boten verbreitet wird.«
»Wie Ihr wünscht, Hochwürden.« Der Secretarius dienerte und verließ eilig den Raum.
Fannemann blickte in die Runde. »Die Tafel ist aufgehoben«, verkündete er. Etwas ratlos standen die Gäste auf. Niemand hatte etwas von dem Kapaun gegessen, und eigentlich wurden noch zwei weitere Gänge erwartet. Man war auf eine angenehme Plauderei eingestellt gewesen – und auf eine erlesene Speisefolge natürlich –, aber da der höchste geistliche Würdenträger der Diözese nach dem Bischof allein zu sein wünschte, musste man nun aufbrechen.
Doch Fannemann wollte offenbar keineswegs allein sein.
»Eusebius, ich bitte dich, noch ein wenig zu bleiben«, sagte er. Eusebius runzelte überrascht die Stirn, schwieg jedoch und nahm wieder Platz. Caspari, Friedag und der Offizial verabschiedeten sich mit den üblichen Höflichkeitsfloskeln, Balthazar Fannemann rief nach der Magd und verlangte Wein und Gebäck. Dann legte er seinem Ordensbruder die Hand auf den Arm und senkte vertraulich die Stimme.
»Weißt du schon, wo du dich niederlassen wirst?«, erkundigte er sich.
Frater Eusebius zuckte die Schultern. Die Frage war berechtigt. Nachdem er im Alter von zwölf Jahren in das Braunschweiger Paulinerkloster eingetreten war, hatte er fast zwei Jahrzehnte mit dem Studium der Heiligen Schrift und der Kirchenväter, der theologischen Gelehrten und sogar der Schriften von Häretikern und des Martin Luther verbracht, aber auch mit Seelsorge und mit der Verkündigung von Gottes Wort getreu dem Motto des Thomas von Aquin: ›Beschauen und das in der Beschauung Erkannte an andere weitergeben‹. Er hatte die Einheit von Theologie, Seelsorge und Predigt gelebt in der festen Überzeugung, es bis an sein Lebensende in Braunschweig zu tun. Dann jedoch führte der Rat am fünften September Anno incarnacionis Domini 1528 die evangelische Konfession in der Welfenstadt ein. Sowohl die Franziskaner als auch die Dominikaner leisteten Widerstand, und das wurde beiden Orden zum Verhängnis. Ihnen wurde der Gottesdienst verboten, und bereits im April 1529 verließen die Franziskaner die Stadt. Die Predigerbrüder hielten länger durch. Aber sie wurden in ihren Konvent eingesperrt, der Rat zog all ihr Hab und Gut ein, und sie litten Hunger und Jammer. Anno 1536 kehrten auch sie Braunschweig den Rücken. Für immer.
Das war vor sechs Jahren gewesen. Immer schon hatte Bruder Eusebius eine Wallfahrt zu den Stätten der Heiligen unternehmen wollen, um sich von seinen Sünden zu reinigen und um Gott besonders nahe zu sein. Sechs Jahre hatte seine Pilgerreise gedauert, nicht etwa weil er so ein schwerer Sünder gewesen wäre, sondern weil er eine neue klösterliche Heimat gesucht hatte. Er war in Aachen gewesen, in Einsiedel, in Santiago de Compostela und in Rom. Monatelang hatte er in der Basilica Santa Croce jeden Tag gebetet und einmal in der Woche die Beichte abgelegt, aber all diese Übungen hatten seine Furcht nicht überwinden können. Eusebius’ Ängste waren auf seiner jahrelangen Reise durch Europa nur noch stärker geworden: Der Predigerbruder fürchtete sich vor einem unmittelbar bevorstehenden Weltende.
Viele Zeichen sprachen dafür. Die Türken stellten eine beständige Gefahr für das Heilige Römische Reich dar, und in allen Weissagungen hieß es, dass am Ende der irdischen Welt fürchterliche und Blut trinkende Völker die Christenheit heimsuchen würden. Frater Eusebius war auf seiner Wanderung in den dritten Krieg Kaiser Karls V. gegen den französischen König Franz I. geraten und hatte das Wüten der kaiserlichen Landsknechte aus nächster Nähe beobachten können. In Rom hatte er die Folgen des Sacco di Roma gesehen, jener Plünderung der Ewigen Stadt durch Karls Truppen im Jahr des Herrn 1527, von der die Römer immer noch mit gesenkter Stimme sprachen. Monatelang hatten die Kaiserlichen in Rom geraubt, vergewaltigt und gemordet, fünfzigtausend Menschen waren den Massakern und der Pest zum Opfer gefallen – für die Stadt eine wahrhafte Apokalypse. Nahm man die Lehre des Martin Luther, den mit ihr verbundenen Abfall etlicher Christen vom rechten Glauben und schließlich die Vertreibung der Bettel orden aus Braunschweig hinzu, so konnte es kaum Zweifel daran geben, dass Gottes Zorn über die Christen hereingebrochen und der Antichrist geboren war.
Doch noch etwas anderes war mit Eusebius in Rom geschehen: Ein schmerzhaftes Heimweh begann ihn zu quälen. Er sehnte sich nach seiner Heimat Saxonia, und als er von einem Bediensteten der Kurie erfuhr, dass Hildesheim als letzte der sächsischen Städte dem Luthertum noch widerstand, wurde aus der Sehnsucht Gewissheit. Er musste zurückkehren. In Hildesheim, das in der Nähe von Braunschweig lag, würde er endlich zur Ruhe kommen.
Auch seine Rückreise wurde eine Wallfahrt. Er besuchte Altötting und das Heilige Blut in der Sankt-Alexandri-Stiftskirche zu Einbeck. Dort unternahmen die Bürger, unter ihnen vielleicht auch der getötete Peter Groper, zwar alles, um ihre Stadt wieder aufzubauen, aber die Spuren des schrecklichen Stadtbrands waren noch überall zu sehen: apokalyptische Zeichen also auch hier.
»Du bist nachdenklich, Bruder Eusebius?«, fragte Weihbischof Balthazar. »Und du zögerst?«
»Nein, ich zögere nicht.« Eusebius straffte seinen Oberkörper. »Ich möchte den Rest meines Lebens im Paulikloster von Hildesheim verbringen.«
»Ausgezeichnet, mein Lieber. Ganz ausgezeichnet.« Fannemann presste den Arm des Mönchs. »Ich möchte dir einen Auftrag erteilen. Ich weiß, unser Orden untersteht allein Rom, aber wir gehören ihm beide an. Nimm es also als Bitte von Ordensbruder zu Ordensbruder, als freundschaftlichen Auftrag gewissermaßen.« Der Weihbischof gab seiner Stimme einen schmeichelnden Ton, der Eusebius sofort misstrauisch machte. Fannemann war mehr als ein gewöhnlicher Ordensbruder, und wenn er um etwas bat, tat er es aus einem Machtbewusstsein, das Widerspruch gar nicht zuließ. Eusebius mochte Menschen wie Fannemann nicht besonders. Aber er war vom Wohlwollen des Weihbischofs abhängig.
»Was soll ich tun?«, fragte er.
»Höre dich in der Stadt um. Trage alles zusammen, was einen Anhänger Luthers mit dem Mord in der Badestube in Verbindung bringen könnte.«
»Und wenn es nun kein Lutheraner war?«
»Ich spreche nur von Möglichkeiten, mein Freund«, sagte Fannemann, lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Bruder Eusebius war von dessen Ansinnen alles andere als begeistert. Er war Seelsorger und Prediger und für Spitzeldienste nicht geeignet. Jedoch war er nicht nur ein wissbegieriger, sondern auch ein neugieriger Mensch, und so gab er Fannemann zwar keine Zusage, aber er lehnte auch nicht rundheraus ab.
Der Büttel und der Badeknecht hatten die sterblichen Überreste des Einbecker Holzhändlers Groper auf einem Handwagen zum Rathaus geschafft und sie dort in einer Kammer aufgebahrt. Obwohl sie den Wagen mit einer Plane abgedeckt hatten, war die Haut des Toten noch immer feucht. Und sehr weiß war sie, so weiß die das Fleisch eines gekochten Huhns: Groper hatte sehr viel Blut verloren, ja er war regelrecht ausgeblutet.
Die Ratsherren stand um den Tisch herum, auf dem die Leiche lag. Der Stadtphysikus, ein auf der Universität ausgebildeter Arzt, breitete seine Instrumente aus, mit denen er die Wunde vermessen wollte. Diese Aufgabe hätte auch ein Wundarzt oder sogar der Bader übernehmen können, denn auch sie waren Heilkundige, aber das Zeugnis des Physikus wog schwerer, weil es amtlich war.
»Ich weiß nicht, ich weiß nicht«, sagte Consul Raven ein ums andere Mal. Sein Gesicht war von Ekel verzerrt. Auch Tile Brandis spürte einen starken Druck im Magen, sagte aber nichts.
»Was weißt du nicht?«, wollte Eggert Unverzagt wissen und zog unwillkürlich seinen gelben Umhang fester um sich. Er wandte den Blick von dem Toten mit der klaffenden Halswunde ab und seinem Ratskollegen zu. Der Stadtphysikus begann sein Werk.
»Ich kann einfach nicht glauben, dass der Mörder unerkannt entkommen konnte«, erklärte Raven.
»Aber Heinrich hat’s uns doch erklärt«, sagte Bürgermeister Sprenger. »Ich schließe auch die Augen, wenn ich ein Bad nehme.«
»Aber die Mägde!«, sagte Raven.
»Du weißt doch, wie sehr sie beschäftigt sind«, sagte Hinrich Einem mit einem wasserblauen Augenzwinkern und sprach damit aus, was Tile bereits in der Lovekenstube gedacht hatte.
»Was meinst du damit?«, fragte Harmen Sprenger scheinbar entrüstet. Brandis schwieg weiterhin. Natürlich wusste der Bürgermeister ganz genau, was Einem gemeint hatte. Vermutlich nahm auch er die verschwiegenen Dienste der Bademägde gern in Anspruch und spielte vor allem aus diesem Grund den Empörten.
Hinrich Einem wurde einer Antwort enthoben. Der alte Knecht des Knochenhauers von Alfeld brachte zwei Satteltaschen, das Gepäck des Peter Groper. Er wurde angewiesen, es auf einen weiteren Tisch in der Nähe des Fensters zu legen und sich sofort zu trollen. Alle Ratsherren drehten dem Toten den Rücken zu und nahmen die Taschen in Augenschein. Consul Brandis öffnete sie.
In der einen Satteltasche befanden sich ein Regenumhang sowie ein Wams und Beinkleider zum Wechseln, in der zweiten ein Nachtgewand, die Schlafmütze, ein Lederbeutel für die Wegzehrung und ein Schlauch für Wasser oder Wein. Brandis breitete all dies auf dem Tisch aus. Dann fuhr er mit den Händen noch einmal in beide Taschen. Er tastete ihr Inneres gründlich ab und stutzte.
»Keine Papiere«, stellte er fest.
»Unmöglich«, meinte Raven. »Er war ein Kaufmann auf der Fahrt, Tile. Reist du ohne Papiere?«
»Natürlich nicht.« Tile Brandis deutete auf die Kleidungsstücke des Toten, die ebenfalls aufs Rathaus gebracht worden waren. Gemeinsam mit Dirich Raven durchsuchte er auch sie. Die beiden Männer fanden dort zwar die Geldkatze des Holzhändlers und Brauers, die zwei Mariengroschen und drei Kreuzgroschen enthielt, ansonsten aber leer war.
»Wir werden Heinrich von Alfeld fragen müssen, ob er etwas über den Verbleib der Papiere weiß«, sagte Brandis. Die Ratmannen nickten. Dann wurde die Tür geöffnet, und Christoph von Hagen betrat die Kammer. Er warf rasch einen Blick auf den Toten, zuckte nur die Achseln und widmete seine Aufmerksamkeit den Herren des Rates. Seine kotigen Stiefel hinterließen feuchte Spuren auf den Dielen, als er näher trat.
»Wir haben ein paar zwielichtige Gestalten in Gewahrsam genommen«, verkündete er. »Zwei Bettler, die sich an der Stadtmauer beim Dammtor herumgetrieben haben, einen Tagelöhner, der laut grölend auf das Kreuztor zugewankt ist, obwohl er gar nicht in der Neustadt wohnt, und einen Wandergesellen, der in der Taverne Bunter Ochse lautstarke Reden wider Papst und Kaiser geführt hat.«
»Die üblichen Verdächtigen also«, murmelte Tile Brandis.
»Wie meinen?« In Christoph von Hagens Gesicht breitete sich Zornesröte aus.
»Nichts.« Brandis winkte ab.
»Wo sind sie?«, wollte Sprenger wissen.
»Im Keller, wo sonst?«
»Ich bin fertig«, meldete sich nun der Stadtarzt zu Wort. Alle drehten sich zu ihm um.
»Zu welchem Ergebnis bist du gekommen?«, erkundigte sich Eggert Unverzagt.
»Ich denke«, sagte der Stadtarzt und deutete auf ein Pergament neben dem Toten, das er nicht nur mit Maßen bekritzelt, sondern auch mit blutigen Fingerabdrücken versehen hatte, »drei Mariengroschen ist die Wunde wert.«
Jacob Klingenbiel konnte wie so oft nicht schlafen. Er teilte sich die kleine, stickige Kammer neben den Lagerräumen des Hauses Blauer Schwan mit den Lehrjungen Michael und Jonas, die er um ihre unbeschwerte Jugend beneidete. Zwar waren Lehrjahre weiß Gott keine Herrenjahre, und die Burschen mussten nicht nur alle möglichen niedrigen Arbeiten verrichten, sie wurden auch für kleinste Verfehlungen an den Ohren gezogen, in den Hintern getreten oder gar mit dem Stock geprügelt. Wenn Michael und Jonas abends in das Bett fielen, das sie miteinander teilten, schliefen sie sofort ein. Aber niemand konnte ihnen ihre kindliche Fröhlichkeit nehmen, keine Drohungen und auch kein Wutausbruch des Meisters. Sie waren arbeitsam und zeigten sich anstellig, auch wenn sie manchmal noch etwas ungeschickt waren und zu harmlosen Streichen aufgelegt, doch immerhin hatten sie ein Ziel: ihre Lossprechung. In einigen Jahren konnten sie Gesellen werden. Allein die bloße Möglichkeit spornte sie an.
Jacob war Geselle, doch was hatte er davon? Gar nichts. Wenn Klingenbiel an einer der Morgensprachen des Sankt-Andreas-Knochenhaueramtes teilnahm, um auf dieser Zusammenkunft mit den anderen Meistern über zünftische Angelegenheiten zu beraten, um einen neuen Meister in das Amt aufzunehmen, was aus Brotneid immer seltener geschah, oder um sich schlicht und einfach voll zu fressen und zu besaufen, dann fand seine junge Frau immer einen Grund, die Lehrlinge und das Gesinde mit Aufträgen aus dem Haus zu schicken. Jede Morgensprache dauerte lange und endete mit einer Zecherei, denn immer gab es Metzger, die gegen die Zunftordnung verstießen, indem sie zu viel schlachteten oder ihre Gewichte manipulierten oder schlechte Waren feilboten, und daher war die Kasse mit den Strafgeldern gut gefüllt.
Waren Meister und Gesinde außer Haus, erwartete Marie den Gesellen in ihrer Schlafkammer. Sie lag nackt unter der Daunendecke, die sie anhob, wenn Jacob kam. Jacob schlüpfte zu ihr, und ihm war fast alles erlaubt. Er durfte die Gattin seines Meisters küssen und überall berühren, wo er nur wollte, allein von ihrem Nest, ihrer Höhle, vom Sitz der Sünde konnte er nur träumen, wenn er nachts in seinem Bett lag und den Atemzügen der Lehrjungen lauschte. Aber er wollte sie besitzen, so wie Klingenbiel sie besaß. Er wollte die Erlaubnis zum Betreten der fremden Welt zwischen den Schenkeln des Weibes, und zwar eine Erlaubnis nicht nur von Marie, sondern eine mit kirch lichem Segen. Der Traum genügte ihm nicht mehr.
Jacob legte Hand an sich. Er achtete darauf, keine Geräusche zu verursachen, aber das altersschwache Bett knarrte, selbst wenn er sich noch so vorsah. In Maries Höhle wollte er stundenlang verweilen. In seinem Bett ging alles viel zu schnell.
Nachdem es vorbei war, atmete Jacob noch eine Zeit lang heftig. Er hatte sich der Sünde der Selbstbefleckung hingegeben, aber das war mit zwanzig Vaterunsern und einem halben Pfennig für die Armenkollekte aus der Welt zu schaffen. Bei jeder Beichte bekannte er, was er Nacht für Nacht tat, und manchmal hatte er das Gefühl, dass der Priester seinem Geständnis nicht nur angehaltenen Atems lauschte, sondern dass sich seine Hände dabei unter die Soutane verirrten.
Knecht Matthias täuschte sich, als er vermutet hatte, Jacob hätte am Abend Bier getrunken. Der Geselle war keineswegs in einer Schänke gewesen, weder im Bunten Ochsen noch im Pferdekopf oder in der Sau, sondern er hatte im Frauenhaus Befriedigung gesucht. Neben Kost und Logis bekam er von Vater Klingenbiel auch ein wenig Geld, das er in einen kleinen Lederbeutel tat, den er auf einem Balken in der Diele versteckte. Andere Gesellen setzten ihre mehr als bescheidenen Einkünfte in Bier um, Jacob trug sie zu den losen Frauen, denn es lohnte sich nicht, das Geld zu sparen: Für Eschung und Bürgereid würde es niemals reichen. Und im Frauenhaus bekam man ein passables Weib bereits für einen halben Kreuzgroschen, den Preis von einem Pfund Schweinefleisch oder einem Pfund Hirsch.
Aber es nutzte nichts, die Hübschlerinnen verschafften ihm nur eine kurzzeitige Erleichterung. Er hatte eine Favoritin, Kristin, die fünfzehn Jahre alt war, aber manchmal trieb er es auch mit der Hurenmutter, mit Madame Catherine, wie sie sich nannte, seitdem ihr irgendein Durchreisender erzählt hatte, Kaiser Karl sei am burgundischen Hof aufgewachsen und beherrsche nur Französisch. Katharina, wie sie wirklich hieß, behauptete gern, als junges Mädchen dem Enkel des im Volk sehr beliebten Kaisers Maximilian oft zu Willen gewesen zu sein, dabei hatte sie Hildesheim nie verlassen. Und sie war entsetzlich ungebildet: Sie hielt Burgund für eine spanische Provinz. Doch Jacob hörte ihr gern zu, wenn sie ihn in die Arme nahm und ihn ihren Kaiser nannte. Sie tippte auf seine Nase, strich ihm über die Stirn, berührte sein Kinn und erklärte, Karl, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, der König von Spanien und Neapel, der Herr der Niederlande und Herrscher über Amerika sehe eigentlich aus wie er. Jacob Findling, der ein Nichts war, genoss diese Schmeicheleien. Er genoss das Gefühl von Geborgenheit, das er nur bei Katharina hatte, er genoss, dass er ihr mit seinem Wissen überlegen war, und er genoss, dass er mit ihr reden konnte; Kristin kicherte immer nur, wenn er von sich und seinen Träumen sprach.
Aber Befriedigung, wirkliche Befriedigung verschafften ihm beide Frauen nicht. Die erhoffte er sich allein von Marie, die sich verweigerte. Denn sie liebte er.
Jacob war der festen Überzeugung, sie zu lieben. Er liebte sie so sehr, dass er sie heiraten wollte.
Heiraten wollte er sie auch, um aufzusteigen. Um nicht mehr Jacob Findling zu sein, sondern Meister Johannes Klingenbiel.