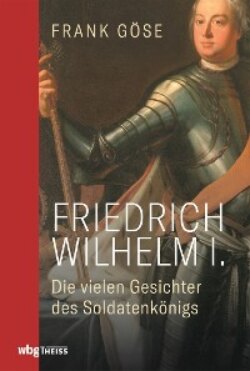Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 18
Asketisches Hofleben?
ОглавлениеNatürlich bekam der höfische Alltag die nach 1713 eingeleiteten Sparmaßnahmen zu spüren, allerdings dürfen ihre Wirkungen nicht überzeichnet werden. Ähnlich wie bei der personellen Zusammensetzung waren die Einschnitte innerhalb der Hofökonomie weniger gravierend als angenommen. Es handelt sich schlichtweg um ein Klischee, wonach nunmehr »sofort aller Glanz an dem königlichen Hofe« verschwunden »und statt des sonst geräuschvollen Treibens auf dem Berliner Schlosse … tiefe Stille« eingetreten sei, »die nur durch die harten Tritte der Soldaten unterbrochen wurde«.59 Hier haben die bekannten Passagen aus den Memoiren Wilhelmines, so etwa über die angeblich recht kärglichen Mahlzeiten am Hof ihres Vaters, ein sehr einseitiges Bild vermittelt. Einige der Fourierzettel sind aber überliefert und belegen, dass die Tafel der königlichen Familie trotz der Verringerung des Küchenpersonals in der Regel doch gut gefüllt und das Essen auskömmlich war.60 Freilich sind die Abstufungen im Vergleich zur Tafel Friedrichs I. mit ihren Delikatessen unübersehbar – aber die Behauptung Wilhelmines, dass man habe hungern müssen, wird wohl eher der Nachwirkung des erlittenen Ungemachs der ältesten Königstochter auf anderen Feldern zuzuschreiben sein. »Guhte Menage!« wurde vielmehr zum Leitmotiv seiner Bemühungen auch auf diesem Terrain.61 Deshalb stellt die Charakterisierung Friedrich Wilhelms I. als asketischer Genussfeind, der sich allenfalls für exzessive Trinkgelage begeistern konnte, eine Legende dar. Zeitgenössische Berichte schildern den Gefallen des Königs an ausgesuchten Tafelfreuden; darin begegnet er uns auch zuweilen als ein zuvorkommender und kommunikativer Gastgeber.62 Zwar überwog deftige Hausmannskost in Gestalt von Rind- oder Schweinefleisch und Grünkohl mit Schinken, dennoch gehörten auch Austern, Froschschenkel, Ragouts, Wildbret und Pasteten zu den kredenzten Speisen.63 Friedrich Wilhelm könnte man ein fast schon animalisches Verhalten zu Essen und Trinken attestieren. Und dies schloss nicht nur den Verzehr fett- und kalorienreicher Nahrung und den überreichen Genuss alkoholischer Getränke ein. Wohl seit seinen Besuchen in den Niederlanden wusste er zum Beispiel den Käse aus den Generalstaaten sehr zu schätzen. Immer wieder finden sich in den Quellen eigenhändige Anweisungen, ihm Lieferungen etwa des Edamer Käses zukommen zu lassen, verbunden mit dem Wunsch, dass »derselbe auswendig gelb und inwendig weiß seyn« müsse.64 Als dieser dann vier Wochen später in Potsdam eingetroffen war, beklagte sich Friedrich Wilhelm über die mangelnde Qualität: er sei »zu jung und weich«, und verband damit den wohl noch aus seiner Erinnerung gespeisten Hinweis an den Lieferanten: »Ihr müßet dieselben von Utrecht kommen lassen, woselbst sie am besten anzutreffen; wo die Scheuten nach Amsterdam anlegen, da ist eine boutique neben der anderen von solchen Käsen.«65 Und die auf seine Veranlassung 1725 bei Potsdam angelegte Meierei ging wohl auf sein Interesse zurück, bei seinen Aufenthalten in der Stadt »immer gute Milch zu haben«.66
Auch wenn der König Bier als sein »ordinäres Getränk« bezeichnete67, bevorzugte er Rhein- und Moselweine »von angenehmer Göre und Mildigkeit«.68 Es verwundert vor diesem Hintergrund nicht, dass sich eine besondere »Nähe« und damit die Gunst zum König durch freigiebiges Verhalten befördern ließ. So wurde darüber berichtet, dass der Minister v. Grumbkow im Februar 1728 einen »ganzen Wagen voll Tockayer Wein dahier« eingebracht hatte und auf der Abendtafel in seinem Hause präsentiert habe. Daraufhin »soll der König bis in die späte Nacht sich sehr frölig und gnädig bezeiget haben«.69 Man wusste an anderen Höfen von diesen bacchantischen Vorlieben und wählte deshalb einen auserlesenen Tropfen gern als diplomatisches Geschenk. Doch der exklusive Weingeschmack Friedrich Wilhelms I. konnte selbst bei guter Bezahlung der Zulieferer zuweilen Beschaffungsprobleme bereiten.70
Entgegen manchen Urteilen fanden natürlich auch nach dem Herrscherwechsel von 1713 aufwendige Hoffestlichkeiten statt. Vor allem im Rahmen von Fürstentreffen und den nicht wenigen familiären Feierlichkeiten (besonders bei Verlobungen und Hochzeiten) gab es dazu immer wieder Gelegenheiten. Dabei scheute man durchaus nicht kostspielige Investitionen. So wurde anlässlich des Besuches Augusts des Starken im Jahre 1728 der zu Lebzeiten des ersten preußischen Königs in der Ausführung unvollendet gebliebene Weiße Saal im Berliner Stadtschloss fertiggestellt und von den Zeitgenossen gerühmt.71
Zwar hat Friedrich Wilhelm I. mehrfach seiner Aversion gegen »operas, Komedien, Redutten, Ballets, Masqueraden« Ausdruck verliehen, dennoch wäre es eine grobe Überzeichnung der Realität, wollte man ihm die Neigung zu Lustbarkeiten völlig absprechen.72 Dieser König bewegte sich bei solchen Anlässen durchaus im Rahmen des üblichen Zeremoniells, auch wenn mitunter seine etwas derbe Art zu einer gewissen unfreiwilligen Komik führen konnte. So war er zum Beispiel Markgraf Karl Wilhelm Friedrich zu Brandenburg-Ansbach, dem Bräutigam seiner Tochter Friederike Luise, anlässlich seines 1729 absolvierten Besuches in Potsdam bis eine Meile vor der Residenz entgegengeeilt und ist dann nach dessen Begrüßung laut einem zeitgenössischen Bericht »bei der Karosse hergeritten«. Anschließend machte er den hohen Gast im Potsdamer Stadtschloss mit der Königin und seiner Braut Friederike Luise bekannt; dabei nahm der König »ihre bede Häupter und druckte sie durch eine darauf erfolgende tendre Embrassade zusammen, daß bede hohe Verlobte mehr roth als blaß wurden«.73 Dieses auf den ersten Blick derbe, aber auch von einer starken emotionalen Anwandlung zeugende Verhalten des Königs setzte sich während der Hochzeitsfeier der beiden fort. Bei diesem Anlass habe Friedrich Wilhelm seine Tochter nach dem Bericht eines Gesandten »mitten im Tantz in die Höhe gehoben, an seine Brust gedrückt und gesagt: Du bist und bleibest doch allezeit meine liebste Tochter.«74
Die bei dieser Begebenheit aufscheinende, fast schon exzessiv zu nennende Begeisterung des Königs für den Tanz ist jedoch nicht nur mit der Gemütsaufwallung vor dem Hintergrund der Hochzeitsfeier seiner geliebten Tochter zu erklären. Seiner Mutter, der Königin Sophie Charlotte, war es bekanntlich ein besonderes Anliegen gewesen, ihn zu einem galanten Tänzer zu formen, auch wenn ihm selbst diese Auftritte nach eigenem Bekunden ein Gräuel waren.75 Des ungeachtet hat er es hier tatsächlich zu einer gewissen Meisterschaft gebracht. Für die Zeit nach seinem Regierungsantritt sind – neben der Hochzeit der Prinzessin Friederike Luise – mehrere Quellenbelege überliefert, dass sich der König bei »solennen« Anlässen als Tänzer betätigte.76 Dass er sich dabei nicht nur ungeliebten Konventionen unterordnete, sondern offenbar Gefallen an einem solchen »Divertissement« fand, offenbart sein freimütiges Bekenntnis gegenüber dem Grafen Seckendorff anlässlich seines Besuches in der kursächsischen Residenz 1728: »… ich bin in Dressen und springe und tantze, ich bin mehr fatiguiret, als wenn ich alle Tage zwei Hirche toht hetze.«77 Und Friedrich Wilhelm I. hat trotz des Widerwillens, den er gegen gewisse frivole Nuancen während seines Dresden-Besuches am Hofe Augusts des Starken empfand, durchaus Aufgeschlossenheit für Neues bewiesen, wie er dem Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau kurz vor Beginn seiner Reise in die kursächsische Residenz freimütig bekannte: »Ich freue mir in ein ander weldt zu komen weill ich kurieux bin.«78 Als »kurieux« haben die zeitgenössischen Chronisten, aber auch auswärtige Beobachter die Gewohnheit wahrgenommen, dass am Hofe Friedrich Wilhelms I. in Abwesenheit von Damen, also nur unter Männern getanzt wurde. Mochten solcherlei »Vergnügungen« im rustikalen Ambiente des Jagdschlosses Königs Wusterhausen noch halbwegs erklärlich sein79, rief diese Praxis im Potsdamer Stadtschloss mehr Verwunderung hervor. Der sich zu jener Zeit in der preußischen Residenz aufhaltende Jakob Friedrich Freiherr von Bielfeld artikulierte seine Verwunderung über den Verlauf eines im Oktober 1739 ausgerichteten Festmahls im Potsdamer Stadtschloss wie folgt: »Ich wandte meine Augen zu allen Seiten, um zu sehen, wo die Dames herkommen würden: allein ich war erstaunt, als einer von diesen Nachkömmlingen des Enacks, mit einem schwarzbraunen und röthlichen Gesichte, mir die Hand bot, mit ihm den Ball zu eröffnen. … Aber man ließ mir nicht viel Zeit zu Ueberlegungen; ich mußte tanzen, der Herr von O*** tanzte auch, der Regiments-Staab tanzte, und alle Officiers tanzten.«80 Diese offenbar des Öfteren zu beobachtende Gewohnheit wird man indes als weitere Facette des Lebens in einer männerdominierten Subgesellschaft im vorrangig militärischen Milieu anzusehen haben, wie sie uns noch in Gestalt des Tabakskollegiums und der Jagdgesellschaften begegnen werden.
Ebenso darf bei der Nachzeichnung des höfischen Lebens in den preußischen Residenzen nicht außer Acht bleiben, dass Königin Sophie Dorothea ihren eigenen Hofstaat im Schloss Monbijou unterhielt und dort – in einem wesentlich enger gefassten Rahmen als etwa bei der ersten preußischen Königin Sophie Charlotte – andere Schwerpunkte setzen konnte.81 Man hat dabei zu bedenken, dass der König, vor allem nach dem Ende der Revuen im Mai, mehrere Wochen nicht in Berlin bzw. Potsdam weilte, sondern zu den Reisen aufbrach, um Garnisonen und Behörden zu inspizieren. Während dieser sogenannten »toten Jahreszeit« in Berlin stand die Königin nicht unter solcher Kontrolle wie vordem.82 Dies konnte auch politische Aktivitäten einschließen, ohne dass man so weit gehen sollte, hier das Agieren eines »Gegenhofes« walten zu sehen. Dazu fehlten schlicht die Ressourcen, zudem standen dem König genügend Möglichkeiten zur Verfügung, das Treiben seiner Gemahlin und ihres Anhanges zu kontrollieren. Ihr Spielraum engte sich angesichts des notorischen Argwohns ihres Gemahls seit jener kritischen Zeit um 1730, als sie sich aktiv an der Vorbereitung der letztlich gescheiterten englischpreußischen Doppelhochzeit beteiligt hatte, noch weiter ein.83
Bei Besuchen von Fürsten wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen, um keinesfalls den Eindruck zu erwecken, auf diesem Terrain nicht mithalten zu können. Anlässlich des Besuches des britischen Königspaares 1730 wurden die über den üblichen Höchstsatz veranschlagten Mittel für die Küchengelder damit begründet, dass die Schüsseln »gut und stark angerichtet« gewesen seien.84 Gerade weil solche Meinungen über ein vermeintlich karges Ambiente des Berliner Hoflebens verbreitet waren, galt es, den Vorhaltungen nicht noch Vorschub zu leisten. Anlässlich des Besuches des Herzogs Franz Stephan von Lothringen im Jahre 1732 beschied der König die Anfrage seiner Hofbedienten, ob nur so viele Personen eingeladen werden sollten, wie an vier Tafeln Platz hätten, mit den Worten: »so viele als ihr bekommen könnt, wenn es auch 10.000 werden.«85 Die Zweifel des Hofpersonals, die hochrangigen Gäste angemessen bewirten zu können, waren nicht ganz unbegründet, wenn man zum Beispiel die Äußerung des Kronprinzen Friedrich berücksichtigt: Dieser zeigte sich angesichts des bevorstehenden Besuches hinsichtlich dessen sehr besorgt, »was … der gute Herzog und sein Gefolge sagen, wenn sie unsern schäbigen Hof sehen werden«.86 Friedrich ging hier offenbar von der in seinen Augen minderwertigen »Standard«-Ausstattung des preußischen Hofes aus und unterschätzte die Fähigkeit zur Improvisation, um anlassgebunden eine höherwertige Hofkultur vorzuführen. In diesem Sinne wird man das anerkennende Urteil eines Gesandten nach der 1716 in Berlin begangenen Hochzeitsfeier der Markgräfin Henriette Marie von Brandenburg-Schwedt mit dem Erbprinzen Friedrich Ludwig von Württemberg zu interpretieren haben, der offenherzig eingestand, dass das Fest »ebenso prächtig begangen worden [sei], wie es bei anderen Höfen Brauchs wäre, er hätte nichts zu tadeln gefunden und nirgends etwas von der sonstigen Kargheit des Königs bemerkt«.87
Das dahinterstehende Motiv schien auch anlässlich des 1731 in Berlin stattfindenden Fürstentreffens durch, zu dem Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg, Herzog Ferdinand Albrecht von Braunschweig-Bevern samt Gemahlin und Erbprinz Karl erwartet wurden. Um diese von preußischer Seite arrangierte Fürstenbegegnung aufzuwerten, bat Friedrich Wilhelm I. den Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau: »sein sie so guht und Pringen von Ihren Printzen ein Par mit.«88 Eine größere Zahl von Angehörigen reichsfürstlicher Familien musste zwangsläufig den Glanz dieses Treffens unter den Adressaten des reichischen Hochadels erhöhen. Zugleich belegt jene Bitte, dass dem König solche Nuancen kaum gleichgültig waren. Allerdings wurde auch dafür Sorge getragen, dass die Ausgaben nicht in das Uferlose stiegen. Salopp gesprochen handelte man also nach dem Prinzip »Mehr sein als scheinen«. Der König zeigte sich durchaus angetan, wenn er vorab darüber unterrichtet wurde, dass die Besucher woanders zu speisen geruhten und deshalb eine Tafel bei ihm nicht vorgesehen sei. In solchen Fällen versah er diese Information, seine Freude nicht verhehlend, mit einem eigenhändigen »Guht. W.« am Rand.89
Ebenso sind jene Vorstellungen einseitig, die eine drastische Veränderung der materiellen Hofkultur sehen wollen. Dass nun karge Nüchternheit in Gestalt von Holzschemeln oder weiß getünchten Wänden Einzug in die Schlösser gehalten hätte, erweist sich schnell als eine Legende.90 Hier sind mitunter Verallgemeinerungen vorgenommen worden, so etwa dahingehend, dass die freilich spartanischer ausfallende Ausstattung der Jagdschlösser des Königs als genereller Standard für seine Wohnkultur angesehen wurde. Der allfällige Verweis auf Fontane hat dabei natürlich nicht fehlen dürfen, nach dessen Beobachtung etwa die Nachnutzer des Schlosses Kossenblatt die Räume dort »groß, öde und weiß« vorgefunden hätten.91