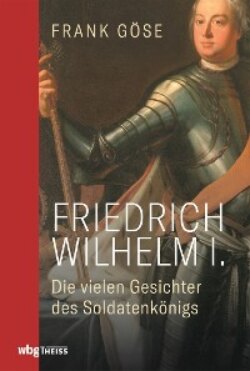Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zwischen Merkantilismus und Kameralismus. Die Wirtschaftspolitik
ОглавлениеDiese Entwicklungen führen vor Augen, dass dem König sehr wohl die engen Zusammenhänge zwischen der Wirtschafts- und der Finanzpolitik bewusst waren. Gerade für diesen Bereich ist der Anteil herrschaftlicher Einflussnahme wesentlich höher angesetzt worden als vordem – und das nicht nur für den preußischen Fall. Zweifellos sprechen viele Belege dafür, dass sich auch auf diesem Terrain Friedrich Wilhelm I. als »Strukturreformer« erwies.20 Ja, es ist sogar zu beobachten, dass Preußen in der älteren wirtschaftshistorischen Forschung zu einer Art Modellfall für eine merkantilistische Wirtschaftspolitik avanciert ist. In herkömmlicher Sichtweise gilt als Hauptkriterium für eine vom »Merkantilismus« geprägte Wirtschaftspraxis – was im Übrigen keine zeitgenössische Bezeichnung darstellte – die Favorisierung des Handels mit dem fast schon kanonischen Charakter einnehmenden Ziel einer positiven Außenhandelsbilanz. Zudem ist der Merkantilismus als das wirtschaftspolitische Pendant zu einer intensivierten, der sogenannten »absolutistischen« Phase des Staatsbildungsprozesses angesehen worden.21 Der steigende Geldbedarf des Staates, vor allem zur Finanzierung von Kriegen, trat dabei als entscheidendes Movens auf den Plan. Auch bei den bekanntesten deutschen Vertretern der merkantilistischen Anschauungen bildeten Landwirtschaft und Handwerk nur »Teilfunktionen des Commerciums; erst durch ihre Verbindung mit dem Commercium werden sie gewinnbringend«.22 Nun hat allerdings die neuere wirtschaftshistorische Forschung deutlich machen können, dass das sich in Überblickswerken niederschlagende Handbuchwissen häufig nicht dem Praxistest standhält und zu wenig differenziert.23 Demnach wäre unter dem Merkantilismus weniger eine stringente Wirtschaftspolitik oder gar eine eigenständige wirtschaftshistorische Epoche zu verstehen, sondern eher ein Bündel verschiedener »Empfehlungen, Handlungsanweisungen, Projekte und Programme«24, das man als handelspolitischen »Diskurs« beschreiben könnte.25 Uns interessiert natürlich auch auf diesem Feld, inwiefern der König selbst hierbei wirksam geworden ist. Dahinter steht die übergreifende Frage nach der »Vermittlung zwischen Theorie und Praxis« – oder mit anderen Worten, »ob brauchbare Vorschläge bei den Adressaten«, also den dafür verantwortlichen Amtsträgern und dem Monarchen selbst, überhaupt »ankamen«.26 Denn in jüngerer Zeit sind zuweilen erhebliche Zweifel daran angemeldet worden, ob die angenommenen staatlichen Interventionen die ihnen unterstellte Durchschlagskraft besaßen.27 Hier sind ähnliche Einschränkungen etwa mit Blick auf kommunikative und infrastrukturelle Rückständigkeiten vorzunehmen, wie sie bereits auf dem Gebiet der Verwaltungsreformen vorgebracht worden sind. Überdies sind die wirtschaftspolitischen Leitvorstellungen Friedrich Wilhelms I. nicht aus systematischen Analysen in ausführlichen Denkschriften, sondern weitgehend »nur aus seinem politischen Handeln heraus und aus dem Bündel der einschlägigen Gesetze und Verordnungen abzulesen«.28 Ungeachtet dessen erwies sich die Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. unbestreitbar als eine Phase intensiver wirtschafts- und finanzpolitischer Innovationen. Allein die nüchternen Zahlen des Staatshaushaltes belegen diese Annahme: Die jährlichen Staatseinnahmen sind während seiner Regierungszeit von 4,8 Millionen bis auf knapp 7 Millionen Taler an seinem Lebensende gestiegen.29
Und auch in diesem Politikbereich begegnet uns wieder die schon in der Verwaltungspraxis Friedrich Wilhelms I. aufscheinende Kleinteiligkeit und Detailbesessenheit seiner Entscheidungen. So hatte er im Sommer 1728 während seiner Anwesenheit in dem unweit Magdeburgs gelegenen Niegripp persönlich Anweisungen zur künftigen Wiesen- und Ackernutzung gegeben und die Hufeneinteilung vorgenommen.30 Im Januar 1731 zeigte sich der König verwundert darüber, dass in den altmärkischen Kleinstädten das Bier noch sechs Groschen koste, obwohl der Gerstenpreis erheblich gefallen sei. Schließlich solle der Preis so »eingetheilet seyn, damit die Soldaten, auch die armen Bürger und andere Leuthe, so keine BrauNahrung haben, doch auch von dem wohlfeilen Preise profitiren«.31 Und im Juli 1735 beschwerte er sich darüber, dass kein Schneider in Minden sei, weshalb man bei der Ausstattung der dort liegenden Regimenter extra Schneider aus Hannover holen müsse.32
Diese mit einer übertriebenen Detailorientierung und einem Überspringen der Hierarchieebenen verbundene Regierungspraxis, vergleichbar etwa mit dem in der jüngeren sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung eingeführten Begriff eines »Mikromanagements«, erwies sich in gewisser Hinsicht als vorteilhaft, führte aber auch zu Redundanzen sowie Misstrauen und einer Einengung des Spielraumes der betroffenen Amtsträger und Unternehmer. Zudem konnte der König nur dann wirksam werden, wenn er von Missständen erfuhr. Kenntnis erhielt er zwar zumeist von Einzelvorgängen, doch aufgrund seines misstrauischen Naturells und seines eher pessimistischen Menschenbildes ging er davon aus, dass es sich bei den aufgedeckten Unregelmäßigkeiten (Versäumnisse in der Berichtspflicht, nachlässige Umsetzung von Verordnungen, Unterschleife etc.) um keine Einzelfälle handelte. So zeigte er sich 1733 irritiert, dass der zuständige Amtsträger in seinem Bericht über die OderSchifffahrt »von dem dortigen Zustande gar nichts meldet und ich gar nichts erfahre, was alda passiret«, und verknüpfte das mit der Aufforderung: »ihr sollet mir also berichten, wie es dort zustehet.«33 Und nach eigenem Bekunden habe er während seiner 1735 unternommenen Reise durch die Halberstädtische Provinz beobachten müssen, dass der Haferpreis bei acht Groschen pro Scheffel lag. Hinterher sei aber bekannt geworden, dass kurz vor seiner Ankunft in derselben Provinz »ein Magazin von Fourage vor die am Oberrhein aus der Campagne gekommene Regimenter Cavallerie« den Hafer für 14 Groschen verkauft habe! Der König vermutete nun noch weitaus mehr solche Unregelmäßigkeiten, auch um ihm bei seinen Inspektionsreisen falsche Tatsachen vorzuführen, und forderte zu prüfen, »ob nicht dergleichen Unrichtigkeit und Unterschleife in andern Fällen überall wehre«.34 Deshalb reagierte er sehr ungehalten, wenn er den Eindruck erhielt, dass ihm Informationen vorenthalten wurden. Er wolle nicht »Carl der 2te König in Spanien seyn«35, gab er dem ostpreußischen Kriegs- und Domänenrat Matthias Christoph von Bredow unwirsch zu verstehen, »denn Ich muß wissen, was In meinem lande passiret; es wundert mich also, daß ihr nicht wollet, daß mir von dem dortigen Zustande rapportiret werde, … denn Ich will meine Sachen in Ordnung haben und die bisherige unordnungen gänzlich abgestellet wissen«.36
Zudem wird man auch für die Analyse der wirtschafts- und finanzpolitischen Entscheidungen des Königs das uns schon bei der Behandlung der Verwaltungsreformen begegnende Strukturmerkmal des Regionalismus zu berücksichtigen haben. So fällt für die Zeit bis 1713 eine starke regionale Differenzierung in der Dichte des Gewerbes und demzufolge in der Steuerschöpfung ins Auge. Der Vorsprung der Berliner Residenzlandschaft war unübersehbar. Wertet man etwa die Höhe der Akzisezahlungen als Gradmesser für die Wirtschaftskraft einer Stadt, dann deutet der Befund, wonach 42 Prozent des gesamten Akziseaufkommens der kurmärkischen Kommunen auf Berlin-Cölln entfielen, in diese Richtung.37 Und in der Tat gehörte das außerordentliche Wachstum der brandenburgisch-preußischen Residenz zu den hervorstechendsten Signaturen der Jahrzehnte nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Das hatte Auswirkungen auch auf die weitab von Berlin liegenden märkischen Teillandschaften. So war es unübersehbar, dass diese Gebiete »in wirtschaftlicher Hinsicht immer stärker auf das Zentrum Berlin-Potsdam hingravitierten«.38 Denn die stetig wachsende Metropole – bis 1710 stieg die Bevölkerungszahl dort von etwa 10.000 auf fast 55.000 Einwohner – benötigte in steigendem Maße landwirtschaftliche Produkte und auch andere Waren aus dem weiteren Umland. Der besseren Anbindung Berlins waren solche infrastrukturellen Maßnahmen geschuldet wie der 1734 begonnene, aber erst kurz nach dem Tode Friedrich Wilhelms I. fertiggestellte Bau des Plauer Kanals. Damit erhielt die Hauptstadt eine bessere Anbindung an die gewerbereichen Wirtschaftslandschaften des Herzogtums Magdeburg.39
Vor allem aber setzten nun unmittelbar nach dem Thronwechsel von 1713 wichtige Veränderungen ein, die nachhaltige Folgen für die wirtschaftliche Struktur der Residenzstädte zeitigten. Diese folgten zunächst aus der anderen Prioritätensetzung der Herrschaftspraxis. Die Reduzierung – nicht Abschaffung! – der höfischen Repräsentation wirkte sich auf das Wirtschaftsleben in der Berlin-Potsdamer Residenzlandschaft aus. Denn nun fielen Aufträge für jene Gewerbezweige weg, die hochwertige Güter für den höfischen Luxuskonsum produziert hatten. Angesichts des befürchteten Rückgangs der Akziseeinnahmen hatte Friedrich Wilhelm von Grumbkow den König unmittelbar nach dessen Regierungsantritt darauf aufmerksam gemacht, dass das Geld »nicht circuliren« könne, »wenn die Quelle, woraus es bishero geflossen, verstopfet ist. Diese Quelle ist bishero gewesen die Depense des Hofes und der Hofbedienten und dann die Manufacturen, durch welche fremdes Geld ins Land gebracht worden«.40 In der Tat führte jene Reduktion zeitweise zu einer Schmälerung der Wirtschaftskraft der Residenzstädte, was sich unter anderem in der bevorzugten Abwanderung von Handwerkern der Luxusgewerbe nach Kursachsen widerspiegelte. Trotz der von seinem Minister geäußerten Bedenken ließ sich der König nicht von seinem Vorhaben abbringen. Vielmehr setzte er andere Prämissen, zugleich in der Hoffnung, dass sich diese rückläufigen Wirtschaftstrends rasch durch neue, insbesondere auf den Heeresbedarf gerichtete Schwerpunktsetzungen kompensieren ließen. Dabei sollten solche Effekte erreicht werden, mit denen zugleich eine gewisse Nachhaltigkeit und eine in das Land hineinwirkende Ausstrahlung erzielt würden. Und in der Tat führten die fast zeitgleich zu den geschilderten Einsparungen erlassenen Anordnungen mittelfristig zu einer wirtschaftlichen Belebung: Speziell mit der Errichtung des Berliner Lagerhauses in der Klosterstraße wurde eine vergleichsweise moderne und effiziente Produktionsstätte geschaffen, die die militärischen, fiskalischen und wirtschaftspolitischen Leitvorstellungen des Königs miteinander verband: Innerhalb von zweieinhalb Jahren gelang es diesem Lagerhaus, die »erste vollständige Heereslieferung« zu gewährleisten.41
Folgte man der reinen merkantilistischen Lehre, hätte der Export im Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik stehen müssen. Dazu fehlten aber in Preußen die entsprechenden Voraussetzungen. Nur in einigen wenigen Bereichen konnten punktuelle Erfolge erzielt werden, wie etwa den sich in den 1720er Jahren intensivierenden Handelsbeziehungen zu Russland.42 Diese Orientierung kam nicht von ungefähr, weil zu jenem Handelspartner das Gefälle nicht so stark ausfiel wie zu west- oder südeuropäischen Regionen.43 Dennoch erscheint es bei allen Bemühungen Friedrich Wilhelms I., eine den sogenannten merkantilistischen Grundsätzen folgende Wirtschafts- und Finanzpolitik umzusetzen, natürlich plausibel, dass die Ressourcenlage Brandenburg-Preußens nur bedingt einen geeigneten Rahmen für eine Wirtschaftslehre bot, die das Allheilmittel in einer positiven Handelsbilanz erblickte. Als der König wahrnehmen musste, dass die Akzise in den ersten beiden Monaten des Jahres 1725 »etliche 1.000 Rtl. weniger als sonst betragen« werde, wollte er von Grumbkow als dem zuständigen Minister die Ursachen für den Rückgang wissen. Dieser machte den »auf den äußersten Grad gehemmten Commercio von ausländischen Waaren« verantwortlich.44
Dagegen berücksichtigte die kameralistische Lehre stärker auch die Produktionssphäre und die Peuplierungspolitik und war demzufolge eher geeignet, Alternativen in solchen immer noch mit den Langzeitfolgen des Dreißigjährigen Krieges belasteten Territorialstaaten wie Brandenburg-Preußen zu bieten. Dabei ist es eher unerheblich, ob man diese Lehre als spezifische Ausprägung des Merkantilismus oder als eine davon klar unterscheidbare Wirtschaftstheorie und -praxis interpretiert. Für die für uns maßgebliche Analyse der Wirtschaftspolitik Friedrich Wilhelms I. erscheint es vor allem relevant, dass die deutsche kameralwissenschaftliche Literatur versuchte, die »reine« merkantilistische Lehre an die Verhältnisse im Reich anzupassen. Ausgangspunkt aller wirtschaftspolitischen Handlungsstrategien kameralistischer Provenienz sind demnach die »Nahrungsgeschäfte«, also die Techniken des Produzierens und Herstellens in Landwirtschaft und Gewerbe. Die Arbeitskraft der Untertanen, der Boden und die beweglichen Güter sind demgemäß die Quellen des Reichtums im Staate, sind dessen »Vermögen«, wie einer der wirkmächtigsten Kameralisten, Johann Heinrich Gottlob von Justi, es genannt hat.45 Der Schwerpunkt wurde überwiegend auf die Schatzung von Geld und Edelmetallen gelegt – eine finanzpolitische Strategie, die auch Friedrich Wilhelm I. übernahm. Damit erhält seine bereits behandelte Motivation zur Hortung eines beeindruckenden Silberschatzes, um das Niveau der materiellen Hofkultur in der preußischen Residenz zu heben und damit ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu kreieren, noch eine weitere Komponente.
Trotz aller Unterschiede, die der Wirtschafts- und Finanzpolitik der europäischen Staaten und deutschen Reichsterritorien innewohnten, gab es dennoch ein Leitmotiv: Im Zuge des Staatsbildungsprozesses, der von einer maßgeblich im Sinne der »Staatsräson«-Lehre beeinflussten staatstheoretischen Diskussion flankiert wurde, sind die Zusammenhänge zwischen dem außenpolitischen Prestige eines Landes einerseits und seiner wirtschaftlich-finanziellen Prosperität andererseits immer deutlicher erkannt und bei den Akteuren verinnerlicht worden – sei es in Denkschriften, politischen Testamenten oder in der Gesetzgebung.46 Und dabei spielte bei den Fürsten jener Reichsterritorien, die sich dies leisten konnten, auch die Fähigkeit zur Rüstung als Voraussetzung, um in der europäischen Mächtekonkurrenz bestehen zu können, eine wichtige Rolle.
Angesichts der in brandenburgisch-preußischen Landen notorischen Ressourcenknappheit lag es nahe, sich auf jene Produktionszweige zu konzentrieren, die zum einen zur Heeresversorgung unverzichtbar erschienen und mit vergleichsweise geringem Aufwand den eigenen Bedarf abzusichern vermochten sowie zum anderen eine größere Zahl von Arbeitskräften beschäftigten, die dadurch wiederum ein stabiles Steueraufkommen sichern konnten. Demzufolge geriet die Tuch- und Wollindustrie in eine Schlüsselstellung innerhalb der preußischen Wirtschaft, ja man kann sie gleichsam als eine Art »Leitgewerbe im preußischen Staat des 18. Jahrhunderts« ansehen.47 Aufgrund dieser außerordentlich großen Bedeutung stand sie auch im Mittelpunkt der landesherrlichen Wirtschaftspolitik und wurde so etwas wie das entscheidende Terrain kameralistischer Praxis.48
Um den Absatz dieses Gewerbezweiges zu fördern, scheute Friedrich Wilhelm I. auch nicht davor zurück, rigide Bekleidungsvorschriften bei seinen Untertanen durchzusetzen. Da ihm zugetragen worden war, dass »Dienst-Mädgens und gantz gemeine Leuthe in denen Städten und auf dem Lande Seidene Camsöhler49, Röcke und Lätze gar häuffig tragen«, brachte er ein entsprechendes Edikt auf den Weg, um dies zu unterbinden. Denn solche Gewohnheit sei »dem Debit der wollenen Waaren … sehr nachtheilig«. Um seinem Ansinnen noch mehr Nachdruck zu verleihen, forderte er: Würde man sechs Wochen nach Publikation des Edikts Leute auf den Straßen antreffen, die solche Sachen trügen, müssten diese ihnen abgenommen werden. Zudem sollten künftig solche seidene Zeuge höher »impostiret werden, damit sie auch um soviel weniger im Stande seyend, selbige zu kauffen und so theuer zu bezahlen«.50
Des Weiteren bemühte sich der König aus nachvollziehbaren Gründen, im Bereich der Rüstung eine größere Unabhängigkeit von Importen zu erreichen. Die Voraussetzungen angesichts einer noch weitgehend einen handwerklichen Zuschnitt aufweisenden »Rüstungsindustrie« waren zunächst wenig verheißungsvoll. Selbige beschränkte sich auf eine Stückgießerei und eine Pulverfabrik in Berlin und auf einige Eisenhüttenwerke in der weiteren Kurmark.51 Um nicht über Gebühr vom Import von Rüstungsgütern abhängig zu bleiben, galt es, eigene Unternehmen zu gründen. Mit der Gründung der Pulvermühle in Berlin und der Gewehrfabrik mit Standorten in Potsdam und Spandau wurde der Anfang gemacht. Diese auf die Etablierung einer eigenständigen Manufakturlandschaft zur Absicherung der Heeresversorgung gerichteten Maßnahmen gingen einher mit protektionistischen Aktivitäten. Rigide Wollausfuhrverbote zählten ebenso dazu wie Importbeschränkungen, um das heimische Gewerbe zu schützen, oder die Zusicherung mehrjähriger Steuerbefreiungen für die Anwerbung von Produzenten, die für die Heeresversorgung erforderlich waren.52 Die gezielte Förderung solcher Unternehmen wie des Königlichen Lagerhauses oder der Firma Splitgerber & Daum, die seit den 1720er Jahren zum bedeutendsten Rüstungsunternehmen in Preußen aufstieg, und das sich damit etablierende persönliche Verhältnis des Königs zu den Kaufleuten erwiesen sich für beide Seiten als äußerst vorteilhaft und »unbezahlbar«.53 Immer wieder ergingen direkte Anweisungen aus dem königlichen Kabinett an die beiden Fabrikanten, neue Gewehre zu liefern.54 Auch bei der Beschaffung von Arbeitskräften zahlte sich dieser enge Kontakt aus, so als Daum 1725 die Genehmigung erhielt, bis zu 60 Kinder aus dem 1722 in Potsdam gegründeten Militärwaisenhaus für sein Unternehmen zu beschäftigen.55 Selbst im Rahmen von Sanierungsarbeiten am Berliner Schloss wurden Splitgerber & Daum 1723 herangezogen, um mit dem entsorgten Material Geld zu erwirtschaften. Für altes Kupfer bezahlte die Firma 108 Taler und für unbrauchbares Eisen 17 Taler.56 Persönliche Gnadenerweise prägten diese Beziehung ebenfalls.57
In einigen Fällen, wie etwa bei dem Bankier, Kaufmann und Unternehmer Johann Andreas Kraut kam es zu einer direkten personellen Verflechtung zwischen Unternehmertum und einer Amtsträgerkarriere.58 Beginnend mit einer subalternen Stelle im Generalkriegskommissariat führte ihn seine Laufbahn über die Generalkriegskasse und die dann unter Friedrich Wilhelm I. eingerichtete Generalrechenkammer bis zur Charge eines Ministers im Generaldirektorium. Hauptsächlich war er aber als Unternehmer tätig: Zunächst trat er 1686 mit der Gründung der Gold-, Silberdraht- und Tressenmanufaktur in Erscheinung, und schon damals verfügte er über ausgezeichnete Beziehungen zum Hof, was sich auch in intensiven Finanzbeziehungen äußerte. Somit nimmt es nicht wunder, dass ausgerechnet er maßgeblich an der Entwicklung eines der wichtigsten Prestigeobjekte des Königs, des »Lagerhauses«, beteiligt wurde.59 Allerdings gilt es einschränkend darauf hinzuweisen, dass sich ungeachtet der prominenten Stellung, die das Lagerhaus in der königlichen Wirtschaftspolitik einnahm, die Bevorzugung seitens des Monarchen in Grenzen hielt. So hatte Friedrich Wilhelm I. im Rahmen der Verhandlungen um die Einrichtung des Lagerhauses betont, dass Kraut »das ganze Werk auf eigenen Kredit und Verlag betreiben sollte«. Denn langjährige Erfahrung habe Friedrich Wilhelm gezeigt, »wenn ein Particuliers auf königliche Rechnung ein Werk betreibe, dass der König dabei immer verliere«.60
Ferner sollte nicht übersehen werden, dass trotz der unbestreitbaren Erfolge, die mit der königlichen Wirtschaftspolitik erzielt wurden, dies letztlich nur eine Annäherung an die vom König eigentlich beabsichtigten Effekte darstellen konnte. Die Neugründungen hatten nicht selten mit großen Problemen bis hin zu finanziellen Verlusten der daran beteiligten Unternehmer zu kämpfen.61 Auch daraus erklären sich seine oftmals galligen Vorhaltungen an die zuständigen Amtsträger. Weder ist die gewünschte Autarkie in dem gewünschten Ausmaß erreicht worden, wovon die sich häufig wiederholenden Edikte künden62, noch hat Friedrich Wilhelm I. die Zollbeschränkungen innerhalb seines Staatswesens aufgehoben.63 Dieses Festhalten an der tradierten Zollverfassung zeigt erstaunliche Parallelen zu der ebenso auf solche Regionalismen Rücksicht nehmenden Gliederung der obersten Verwaltungsbehörde (Verbindung von Fach- und Regionalprinzip in der Departementeinteilung).
Obendrein verhagelten externe Einflüsse wie etwa die in der zweiten Hälfte der 1730er Jahre zu beobachtenden Missernten und Teuerungen die Erfolgsbilanz ebenso wie »hausgemachte« Probleme.64 Denn die Prioritätensetzung auf jene Produktionsbereiche, die der Heeresversorgung dienten, musste zwangsläufig zu gewissen Deformierungen der wirtschaftlichen Entwicklung führen. Auch in anderen Gewerbezweigen wurde zwar eine gezielte »staatliche« Förderpolitik betrieben, wenngleich nicht mit solchem Nachdruck wie in der Woll- und Rüstungsindustrie.65 So gab es im Bereich der Seidenindustrie, jenem dann unter Friedrich dem Großen bedeutend werdenden Wirtschaftszweig, verheißungsvolle Ansätze, die jedoch noch keine langfristigen Erfolge zeitigten. Zwar hatte die Berliner Akademie der Wissenschaften, die vom König mit der Anlage großer Maulbeerbaumplantagen beauftragt wurde, in einer öffentlichkeitswirksamen Aktion im Jahre 1720 viele Setzlinge und Bäume verkauft – besonders in Berlin, Köpenick und Potsdam. »Ganze Scharen von Männern und Frauen« hätten demnach »um die Zuweisung von Stämmen« gewetteifert. Allerdings stand das ganze Unternehmen unter keinem guten Stern. Wetterunbilden, Unerfahrenheit der Gärtner, unsachgemäßer Anbau von Getreide zwischen den Bäumen und Baumaßnahmen des Berliner Magistrats führten dazu, dass es zwölf Jahre nach dem Beginn der Kampagne in den genannten Orten gerade einmal 2000 Maulbeerbäume gab, aus denen lediglich 115 Pfund Rohseide gewonnen werden konnten.66
Ansonsten führte das Wachstum Berlins natürlich auch dazu, dass sich neben oder trotz einer teilweise recht dirigistisch agierenden landesherrlichen Wirtschaftspolitik neue Gewerbebetriebe aus eigener Initiative etablierten. Insbesondere wirkten hierbei die enormen Standortvorteile Berlins förderlich.67 Da sich diese Unternehmer nicht in ähnlicher Weise wie die Heereslieferanten der besonderen Fürsorge des Königs erfreuten und es auch schon mal Konflikte – vor allem wegen der als Konkurrenz empfundenen weitreichenden Privilegien des Lagerhauses – geben konnte, kam es Ende der 1730er Jahre zu Protesten, die »nach jahrelangen Verhandlungen einige Zugeständnisse« für die opponierenden Handels- und Manufakturunternehmer brachten.68
Doch im Gegensatz zu seinen Vorgängern hat Friedrich Wilhelm I. im Rahmen seiner wirtschaftspolitischen Maßnahmen versucht, »die Proportionen zwischen Berlin und den sonstigen Städten« im Auge zu behalten.69 Auch auf diesem Feld scheint im Übrigen die schon oft beobachtete Kleinteiligkeit und anlassbezogene Reaktion des Monarchen und seiner Minister auf. Man reagiert auf Anfragen und Vorschläge und »entscheidet am Einzelfall, ob … die geforderten Maßnahmen angemessen sind«.70 Dessen Detailbesessenheit richtete sich auch in den anderen preußischen Städten nicht nur auf größere, den Berliner Unternehmen vergleichbare Firmen, sondern zugleich auf das Handwerk in seiner Breite.71 Die Sammlung der Kabinettsminüten bietet eine Fülle an Belegen über Interventionen Friedrich Wilhelms I. zu Handwerkerangelegenheiten in den Kommunen. Im März 1728 hatte der König zum Beispiel erfahren, dass für Zimmerarbeiten in den Ämtern Potsdam und Saarmund fremde Zimmerleute aus Berlin genommen wurden, obwohl »hier in Potsdam viel guthe Zimmer Meister, welche alle Bürger Onera tragen müssen«, vorhanden seien. Deshalb befahl er der zuständigen Kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer, dafür zu sorgen, dass daselbst künftig keine anderen Zimmerleute als aus Potsdam beauftragt würden.72 Über die mitunter sehr weit gehenden und von den Betroffenen als lästige Eingriffe wahrgenommenen Reglementierungsabsichten des Königs im städtischen Gewerbe ist bereits gehandelt worden. Eine wichtige, schon von seinen Vorgängern übernommene Agenda in diesem Bereich bestand in Bemühungen, eine wirkungsvolle Handwerkergesetzgebung zu etablieren, und zwar über die preußischen Grenzen hinaus, wozu entsprechende Absprachen auf Reichsebene vonnöten waren.73 Im Besonderen ging es darum, die teilweise sehr selbstbewusst und wirkungsvoll ihre Rechte betonenden Zünfte in die Schranken zu weisen. So wies Friedrich Wilhelm I., um nur eine solche Intervention exemplarisch herauszugreifen, den Berliner Magistrat 1731 an, den Prozess, den das dortige Schneidergewerk gegen den Schneider Deutschländer führte, einzustellen und dafür zu sorgen, dass das Gewerk »denselben in Haltung der zu seiner Arbeit nöthigen Gesellen nicht hinderlich sey«.74 Des Weiteren lag dem König daran, die durch die Zünfte bislang rigide gehandhabte Gewährung von Meisterprivilegien zu lockern, vor allem um eine Ansiedlung von Handwerkern in preußischen Städten attraktiv zu gestalten75; überdies sollte das in den Augen der Magistrate und der landesherrlichen Verwaltung zu eigenmächtig erscheinende Agieren der Gesellenbruderschaften unterbunden werden, die sich infolge ihrer territorienübergreifenden Organisations- und Mobilitätsstrukturen dem Zugriff lange zu entziehen vermocht hatten. Auch aufgrund eigener Erfahrungen in der Residenz forderte der König ein unnachsichtiges Einschreiten. Man solle »die SchusterGesellen, so sich der publicirten HandwerkerOrdnung widersetzen wollen, sämbtlich arretieren lassen … und … die Rädelsführer und Widerspenstigen braf karren lassen, denn dergl. Gesindel nicht anders als mit Ernst und Schärfe zur Raison gebracht, wovon Ich im vorigen Jahre hieselbst ein Exempel mit den Zimmerleuthen gehabt habe«.76 Alles in allem, so lässt sich vor dem Hintergrund solcher Fälle resümieren, »ist unter Friedrich Wilhelm I. im Zunftleben gewiß ein Stück Autonomie abgebaut worden«.77
Auf einem anderen Feld, dem sogenannten »Landhandwerk«, erwies sich die Bilanz als etwas ambivalenter. Friedrich Wilhelm I. hielt, hierin seinen beiden Vorgängern folgend, an der starren steuerpolitischen Teilung zwischen Stadt und Land fest, was zum Beispiel Beschränkungen für die Ansiedlung von Gewerbe auf dem »platten Land« zur Folge hatte. Insbesondere für die Berliner Metropolregion führte dies zu einer »zwischen der Residenz und ihrem Umland … für die damalige Zeit nicht typische[n] Diskrepanz«, was letztlich die Entwicklung einer gewerblichen Großregion erschwerte.78 Dennoch zeigen entsprechende empirische Studien, dass sich trotz der diesbezüglichen Verordnungen, wie etwa der »Principia regulativa« von 171779, auf dem Lande sehr wohl bestimmte Handwerksberufe niedergelassen hatten, hauptsächlich um den zünftischen Beschränkungen in den Kommunen zu entgehen und zugleich billiger leben zu können.80 Die Krone ihrerseits war daran interessiert, den gesteigerten Bedarf im Bereich der Textilproduktion auch über eine Ansiedlung entsprechender Gewerbe auf dem Lande absichern zu helfen. In der Folgezeit versuchte man nun, jene Wünsche und die Bedürfnisse des platten Landes an bestimmten Gewerbezweigen mit den Interessen der städtischen Zünfte, diese Konkurrenz zu unterbinden, in Einklang zu bringen.81 In den Dörfern der Prignitz wurden zum Beispiel im Jahre 1734 neben den offiziell tolerierten Schmieden, Schneidern, Leinewebern und Zimmerleuten auch 90 Müller, elf Schuster und drei Böttcher gezählt.82 Die Abhaltung von Märkten in offenen Flecken und Dörfern hingegen war dem König suspekt. Die ablehnende Haltung resultierte einerseits aus der Befürchtung, dass ihm dadurch die ja nur in den Städten erhobenen Akziseeinnahmen entgehen würden, andererseits argwöhnte er, dass diese Märkte eine probate Möglichkeit für die Flucht junger Männer vor einer Rekrutierung in die Armee darstellten. Auf seine Anordnung hin wurden sie deshalb in einigen kurbrandenburgischen Teillandschaften in die benachbarten Städte verlagert.83
Die Zugeständnisse und das Aufweichen der vor allem von den städtischen Zünften geforderten rigiden Verbote der Ansiedlung des Landhandwerks erklären sich mit anderen Prioritäten, die der König – wie im Übrigen schon ansatzweise seine beiden Vorgänger – gesetzt hatte. Im Interesse einer attraktiver zu gestaltenden Ansiedlung war man bereit, die tradierten Privilegien der Zünfte partiell infrage zu stellen. Mit der Siedlungs- oder auch »Peuplierungs«-Politik gerät nunmehr ein Thema in den Fokus, das abseits apologetischer Überhöhungen unstreitig als eine der vom König am intensivsten bearbeiteten Materien charakterisiert werden darf – und zwar über seine gesamte Regierungszeit hinweg.