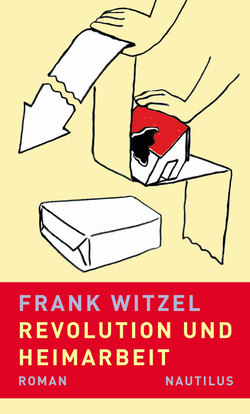Читать книгу Revolution und Heimarbeit - Philipp Felsch, Frank Witzel - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление⇓
Wolle man mit diesem Dokument den Bericht oder die Sendung eröffnen, seinetwegen auch das Feature, so sei es kein Problem, sich entsprechende Bilder zu besorgen. Man müsse gar nicht noch einmal nach Arlington zurückfahren, denn im Grunde sehe Arlington aus wie tausend andere amerikanische Orte auch. Tausendfach liege entsprechendes Bildmaterial in den Archiven, so daß man einfach nur in die Archive hinabsteigen und dieses Material entsprechend zusammensuchen und anschließend zusammenschneiden müsse. Für Fernsehmitarbeiter sei dieses Zusammenschneiden von Material Alltag, und für ihn selbst liege in diesem zusammengeschnittenen Material eine gewisse Befreiung, weil er mit diesem zusammengeschnittenen Material auf seine bescheidene Art das Abgleichen der Bilder verhindere. Natürlich könne man das den Fernsehleuten nicht mit diesen Worten schildern, denn das gehe über deren Horizont, doch wenn man die Sache einigermaßen geschickt verpacke, dann kämen sie schon von selbst auf die Idee und würden in die Archive hinabsteigen, weil sie ohnehin keiner anderen Verrichtung als dem ewigen Zusammenschneiden von Material nachgingen, oder eben dem Nachstellen von Material, wogegen er auch nicht das Geringste einzuwenden habe.
Man solle ruhig zwei Schauspieler nehmen und diese beiden Schauspieler vor einer unverputzten Studiowand auf zwei Sessel plazieren und ihnen auf einem Beistelltisch ein paar Biere und ein Aufnahmegerät hinstellen. Snake könne man von diesem einen jüngeren Typen spielen lassen, dem die Vorderzähne fehlten, der aber dennoch ständig in allen Filmen mitmache. Mit der gut sichtbaren Tätowierung einer Schlange auf dem Arm würde man ihn sofort als Snake erkennen, obwohl Snakes Tätowierung nicht sichtbar gewesen sei, was aber nichts mache, da man im Fernsehen ohnehin alles etwas anders darstellen müsse, um einen realistischen Eindruck zu erzielen. Ihn hingegen könne dieser etwas pockennarbige Schauspieler verkörpern, der auch schon in Amerika Filme gedreht habe und überhaupt recht erfolgreich sei. Vom Alter her käme das einigermaßen hin, auch wenn er keinerlei Ähnlichkeit mit diesem Schauspieler habe, der durchaus eindrucksvoll und bestimmend wirke, was für eine Fernsehadaption nur von Vorteil sein könne.
Um das alles abzudrehen, müsse man nicht extra in die USA fahren, obwohl sich natürlich immer ein Ressortleiter oder Produzent finde, der darauf bestehe, extra in die USA zu fahren, natürlich nur, weil er auf diese Weise noch einmal bequem in die USA kommen würde, und nicht aus Gründen der Authentizität und Stofftreue, von der er hiermit jedermann entbinde. Wenn man dann schon einmal in den USA sei, erschiene einem Arlington einfach zu unbedeutend, denn in Arlington könne man am Ende eines anstrengenden Drehtags nichts unternehmen, weshalb man sich eine Stadt aussuchen würde, die etwas mehr hermache, und zu dieser Stadt würde man dann fahren und dort die entsprechenden Szenen abdrehen.
Man könne auf diese Weise eine ganze Menge aus den Aussagen herausholen, wenn man wolle. Man könne das ganze dokumentarisch aufziehen oder eben gleich zu einem Roadmovie umarbeiten oder zu dem, was eben gerade in Mode sei. Und wenn es Bolivien sein müsse, dann eben Bolivien. Passenderweise könne er in einem der noch folgenden Dokumente sogar mit einem Stück Südamerika dienen, zwar nicht Bolivien, sondern Paraguay, das aber gleich um die Ecke von Bolivien liege, und wenn man schon Arlington durch eine interessantere Stadt ersetzt habe, warum dann nicht ein südamerikanisches Land gegen ein anderes austauschen?
In seinem Dokument gehe es um ein riesiges Stück Land mit Namen Gran Chaco, und dieses Stück Land, das so groß sei wie in Europa ganze Staaten, sei Grund einer Auseinandersetzung zwischen Paraguay, Argentinien und Bolivien gewesen, wobei er sich nicht mehr genau erinnern könne, auf wessen Seite Bolivien gestanden oder welche Rolle Bolivien gespielt habe, aber wenn man schon einmal da unten sei, dann könne man das auch gleich mitrecherchieren, obwohl es letztlich egal sei, denn Südamerika sei nun einmal Südamerika, ob man nun in Paraguay einen Kameraschwenk vom blauen Himmel zu den ausgemergelten Gesichtern mache oder in Bolivien. Selbst Mittelamerika sei für die meisten Südamerika, und man brauche nur die entsprechenden Bilder von Indianern herauszusuchen und den staubigen Straßen und schon habe man das Feature fertig.
Und wenn man das Feature fertig habe, dann könne man auch gleich noch ein paar Worte zur Revolution verlieren und sich und den Lesern, Hörern und Sehern ein gutes Gefühl verschaffen, weil man mit Hilfe eines historischen Bildabgleichs wieder einmal daran erinnert habe, was alles schief gegangen sei, seinerzeit, und warum es immer noch weiter schiefgehe. Allein diese oberflächlich angeritzte Ursachenforschung mit dem entsprechend vollmundig formulierten Resümee verschaffe allen Beteiligten ein befreiendes Hochgefühl, weil man plötzlich ganz anders aus dem Fenster auf die Straße schaue und plötzlich auch wieder mit sich selbst in Kontakt komme, mit dem Proletarier, der damals den Aufstand geprobt habe und der es immer noch bedauere, daß es bei der Probe habe bleiben müssen, obwohl er schon in Kostüm dagestanden habe, in Mantel und Degen, aber dann sei in letzter Sekunde etwas dazwischen gekommen, man wisse selbst nicht mehr genau was, aber irgendetwas sei mit Sicherheit dazwischen gekommen, denn ohne zwingenden Grund habe der Proletarier Mantel und Degen bestimmt nicht wieder abgelegt und in der Mottenkiste auf dem Speicher verstaut. Da oben müßten die Sachen auch noch immer herumliegen, schließlich wisse man nie genau, wofür man sie noch brauche. Und wenn sich die Kinder damit verkleideten …
Dieses Resümee könnte man von diesem einen Synchronsprecher über eindrucksvolle Schwarzweißbilder aus dem Off verlesen lassen, diesem Sprecher mit der rauchigen Stimme, der alle möglichen amerikanischen Stars synchronisiere und sich dadurch im Lauf der Jahre in eine Art Wahn hineingesteigert habe und besoffen geraten sei am Klang der eigenen Stimme, mit der er die Worte immer mehr herauspresse, als würde er mit jedem Satz den Angriff auf Pearl Harbour vermelden, so daß die deutschen Fassungen der amerikanischen Filme noch unerträglicher geworden seien als die Originale. Wenn man es geschickt anstelle, könne man diesen Sprecher bestimmt gewinnen, denn dieser Sprecher sei bestimmt an anspruchsvollen Aufträgen interessiert, um zu beweisen, daß er nicht nur die Stimme von dem oder jenem sei, sondern auch selbstständig etwas sprechen könne, obwohl sich seine Stimme in ihrer Unverwechselbarkeit erst am Vorbild der von ihm synchronisierten Schauspieler herausgebildet habe, die er nun aber schon längst übertrumpfe. Wobei man nicht zurückschrecken solle, sich die Tragik dieser Existenz in der Anwerbung zunutze zu machen, denn nur in der Ahnung der eigenen Tragik gelange man zu Hochleistungen, da man alles tue, um die Erkenntnis der eigenen Tragik abzuwehren, sich also liebend gern in Projekte hineinkniee, von denen man glaube, daß sie einem höheren Zweck dienten, einen also vor der eigenen Erkenntnis bewahren könnten, selbst wenn es nicht halb so viel für diese Projekte gebe wie für den Einsatz der herausgepreßten Synchronstimme, mit der auch auf dem Werbesektor einiges zu machen sei, falls man nicht entsprechende Knebelverträge unterzeichnet habe und nicht mehr frei und nach Belieben über die eigene Stimme verfügen könne. Würde es gelingen, diesen Sprecher zu gewinnen, so wäre einem der Erfolg sicher. Man könne eine Ausschreibung machen und Zahnärzte als Sponsoren gewinnen und darüberhinaus die Filmförderung in die Pflicht nehmen, denn was sei gelungener als ein Dokumentarfilm, bei dem einen doch am Ende die Tränen kämen wie bei einem Hollywoodstreifen. Wenn man dann noch eine entsprechende Musik darunterlege, dann könne sich niemand mehr dieser Kamerafahrt entziehen und man habe das Ding im Sack mit Grimmepreis und allem Pipapo.
Der Witz aber sei, daß man bei entsprechenden Gesprächen in Kultursendungen immer behaupten könne, die Rührung am Schluß werde durch die Tatsache erzeugt, daß man durch eine entsprechende historische Aufbereitung wieder in Kontakt mit den Gefühlen einer Trauer über eine vergebene Chance gekommen sei, und daß dieser Film auch von diesem Bedauern handele und auf eine gewisse Art auch gegen dieses Bedauern ankämpfe. Gleichzeitig handele dieser Film auch von der Wut und von der Verzweiflung, drücke aber doch ein Stück weit Akzeptanz aus und deute Lösungsmöglichkeiten an, oder wie auch immer man es dann im einzelnen formulieren oder in den Mund gelegt bekommen würde. Sprecher und Musik lasse man am besten unerwähnt, denn nur so könne die Kritik das Gefühl des wohligen Ziehens in der Magengegend ertragen, das Gefühl, der Welt für einen Augenblick enthoben und gleichzeitig verbunden zu sein.
Es sei im Grunde nichts anderes, als was andere auf einer Isomatte mit dem inneren Kind anstellen würden. Dieses innere Kind sei auch so eine Spukgestalt. Alle Personen, die durch unsere Psyche und unsere Erinnerung und das, was wir als Geschichte bezeichneten, geisterten, seien Spukgestalten, ob nun inneres Kind oder äußerer Vater. Und mit Spukgestalten sei immer am meisten Geld zu verdienen gewesen. Man könne dann sogenannte Familienaufstellungen dieser Spukgestalten machen und sich ein Leben lang mit Systemen aufhalten, die versuchten, Beziehungen zu Gestalten zu analysieren, die kettenrasselnd und mit einer Kugel am Fuß durch die Gewölbe des Unbewußten geisterten, um dort ausgebleichte Blutflecken mit Filzstift nachzubessern.
Er persönlich würde sich, wie man sehen könne, keiner Verwertung entziehen, denn zu glauben, sich der Verwertung entziehen zu können, das sei auch so eine Illusion, der besonders Leute hinterherhingen, die nichts lieber wollten, als von morgens bis abends verwertet zu werden. Die meisten Leute fühlten sich ohnehin nur dann lebendig, wenn sie verwertet würden. Würden sie einmal nicht verwertet, beginne umgehend das große Lamentieren, daß sie nicht verwertet würden. Sie forderten dann umgehend eine Lobby und wollten, daß man sich um sie kümmere, wobei dieses Kümmern nichts anderes als ein Verwerten sei. Kaum seien die meisten Leute zwei Tage vom allgemeinen Verwertungsprozeß ausgeschlossen, befalle sie schon eine nicht zu überwindende Angst, fühlten sie sich isoliert, allein und leblos. Sie verfielen in eine Art Stupor und dieser Stupor werde dann von entsprechenden Medizinern als Dissoziation diagnostiziert und als schwerwiegend eingestuft. In entsprechenden Selbsthilfegruppen werde den Betroffenen dann wieder auf die Beine geholfen.
Am Anfang falle das den meisten Beteiligten dieser Selbsthilfegruppen schwer, weil sie sich immer noch an alten Bildern der Verwertung orientierten. Diese alten Bilder der Verwertung aber seien längst ihres Kontextes der prophezeiten und immer weiter in die Zukunft hinausgeschobenen Entlohnung verlustig gegangen, weshalb sie dem alltäglichen Abgleich nicht länger zur Verfügung stünden. Eine Tatsache, die den Puls beschleunige, die Atmung gleichzeitig herabsetze, und die Betroffenen schließlich in den schon erwähnten Stupor stürze. Nach entsprechenden Erstversorgungsmaßnahmen, vulgo: dem Legen von Kathetern und Sonden, um den Durchmarsch von Information zu kontrollieren, komme es dann zur chemischen Entgeisterung. Wer in der zweifelhaften Lage sei, diesen Exorzismus zu überstehen, gelange anschließend in eine Reha, denn er müsse wieder vor der Gesellschaft rehabilitiert werden, die nicht jeden X-Beliebigen in ihre Reihen zurücklassen könne, schon gar nicht einen, der sich an dem System gerieben und durch dieses Reiben sein Versagen dokumentiert habe. Durch entsprechende, Anwendungen genannte, Maßnahmen werde das den Patienten eingetrichtert, bis es ihnen wenn schon nicht in Fleisch dann zumindest in Blut übergegangen sei. Gleichzeitig würden neue Bilder der Verwertung gelehrt, mit Hilfe derer die Probanden verstünden, daß man sich nicht nur im Arbeitsprozeß verwerten lassen könne, sondern auch in Selbsthilfegruppen.
Wie gesagt, ihm persönlich sei es egal, welche Form der Verwertung seine Dokumente fänden, denn er selbst mache sich über Verwertung und Entlohnung keinerlei Illusionen. Diese Illusionslosigkeit sei jedoch richtig, nämlich positiv, einzuschätzen, da sie die Zusammenarbeit mit ihm ungemein erleichtere. Ihm gegenüber müsse man nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern könne die Karten auf den Tisch legen und alles beim Namen nennen, selbst das sonst Namenlose, nämlich den Verwertungsprozeß. Wenn er auf den ersten Blick als vielleicht etwas schwerfällig und kompliziert erscheine, so beruhe diese Erscheinung auf einem Mißverständnis, denn tatsächlich könne man leicht mit ihm zusammenarbeiten, da er die Gedanken, die er hier an dieser Stelle erwähne und ausführe, bei einer etwaigen Zusammenarbeit natürlich nicht beständig erwähnen und ausführen würde. Er erwähne diese Gedanken allein, um einfach einige Anhaltspunkte zu geben und die von ihm vorgelegten Dokumente nicht völlig im luftleeren Raum zu belassen. Was aber jemand mit den Dokumenten anfange und wie dieser diese Dokumente verwerte, das sei ihm völlig gleichgültig.