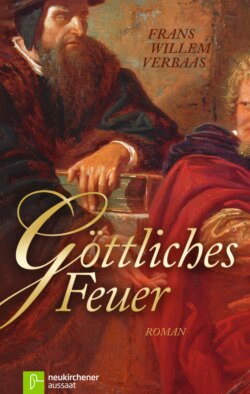Читать книгу Göttliches Feuer - Frans Willem Verbaas - Страница 6
Erstes Kapitel
ОглавлениеDie ehrwürdigen Lehrer unserer Lateinschule hatten uns versichert, der Anblick der mors ignea1 einer Verbrecherbande sei mindestens ebenso lehrreich wie das konzentrierte Lesen der Predigt eines Kirchenvaters. Deshalb bekamen wir im Sommer des Jahres 1527 einen Tag schulfrei, um der Hinrichtung von vier Pestsäern auf dem Marktplatz beiwohnen zu können. Wie jeden Schultag wartete ich auch an jenem Morgen an der Holzbrücke über die Seine auf Gaspard. Er wohnte mit seinem Vater in einem kleinen Schloss auf der anderen Seite des Flusses, anderthalb Meilen von Rouen entfernt. Gaspards Mutter lebte nicht mehr. Es hieß, sie sei ebenso schön wie reich und genauso wohlerzogen wie fromm gewesen. Das hatte sie jedoch nicht davon abgehalten, einen gewöhnlichen Tod im Wochenbett zu sterben. Gaspard zeigte mir in der Kathedrale einmal die Grabplatte, unter der sie beerdigt worden war. Zur Verwunderung der Anwesenden legte er sich flach auf die gemeißelte Steinplatte und sagte, dass er nun auch eine Ebene tiefer neben seiner Mutter läge, wenn er seine Geburt nicht überlebt hätte. Gaspards Mutter hatte ihrem Sohn ihr Leben geschenkt, nicht aber ihre Schönheit. So, wie er dort auf dem kalten Grabstein lag – ein kleiner Kopf, kurzer Rumpf, dürre Beine und das alles in viel zu protzige Kleider gehüllt –, glich er einer dieser lächerlichen Puppen, mit denen Puppenspieler die Jahrmärkte bereisen. Obwohl ich nur der Sohn eines Schneiders war, schämte ich mich oft für meinen adligen Freund. An unserem ersten Schultag war Gaspard auf mich zugekommen und hatte mich gefragt: „Wie heißt du?“
„Henri.“
„Henri, ich erwähle dich zu meinem Freund.“
„Wieso?“
„Weil du der Größte in unserer Klasse bist.“
„Und weshalb sollte ich dein Freund sein wollen?“
„Weil mein Vater Graf Jean de Jumelles ist.“
Meistens war Gaspard recht spät dran, sodass wir rennen mussten, um pünktlich in der Schule zu sein. An jenem Morgen kam er jedoch sehr zeitig über die Brücke. Obwohl es ein glühend heißer Tag zu werden schien, trug er einen kurzen, im italienischen Stil geschnittenen Mantel über seinem Leinenhemd. Er stopfte eine Handvoll Zuckermandeln in meine Hosentasche und sagte: „Falls wir lange warten müssen, bevor das schändliche Fleisch gar ist.“
Am Glockenturm in der Stadt hatte sich eine Volksmenge versammelt, die auf den Tross der Magistraten, Gerichtsdiener, Geistlichen und Verurteilten wartete. Wir bahnten uns einen Weg nach vorn; ich voran und der kleine Gaspard hinterher, wobei er mich ungeduldig in den Rücken stupste. Wir wollten die Gesichter der Missetäter sehen. Darauf mussten wir nicht lange warten.
Zwei Pestsäer – in lange Hemden gehüllt, die einmal weiß gewesen sein mussten – legten den Gang zum Alten Markt zu Fuß zurück. Um den Hals trug jeder von ihnen ein Halseisen mit einer Kette, an der sie von einem Stadtwächter geführt wurden. Ihre Arme hingen reglos am Körper herunter. Sie hatten keine Hände mehr, die hatte man ihnen abgehackt. Ich sah, dass aus einer eitrigen Wunde ein weißes Stück Knochen herausragte. Auf einem Eselskarren lag ein dritter Mann, der sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte; auch ihm fehlten beide Hände. Neben ihm saß eine junge Frau, die von allen noch am besten aussah. Sie hatte die linke Hand noch, und offensichtlich waren ihre Arme nicht ausgerenkt, wie es bei den Männern der Fall war. Als sie an mir vorbeifuhr, trafen sich unsere Blicke. Für einen Moment leuchteten ihre matten Augen, und deutlich hörbar sagte sie: „Guten Tag, Henri.“
Ich zwang mich, nicht wegzuschauen. Natürlich wusste ich, dass Claudine zu den Pestsäern gehörte. Claudine Faré und meine Schwester Anna hatten oft im Atelier unseres Vaters gespielt. Dort hatten sie sich mit den übrig gebliebenen Stoffresten als Prinzessin oder als Bischof verkleidet. Einmal war ich während ihrer Kostümierung ins Atelier gekommen, ohne dass die Mädchen es bemerkt hatten. Ich stand verborgen hinter einem Stapel ungefärbter Wolle und sah sie dort halb entblößt stehen. Annas Körper war noch immer der eines Kindes, aber Claudine hatte schon pralle Brüste. Sie waren rund und weiß wie Milch. Der weiße Busen von Claudine begegnete mir später noch in so manchen Träumen. Nach dem Tod meiner Schwester war sie nie wieder bei uns gewesen.
Lächelte sie mich nun an oder war es die Spannung, die ihre Lippen zittern ließ?
„Hast du deine Mandeln schon aufgegessen?“, fragte Gaspard.
„Noch nicht.“
„Dann gib mir noch welche ab.“
Die Sache mit den Pestsäern hielt Rouen nun schon wochenlang in ihrem Bann. Einer der Verurteilten war der Aufseher des Pesthauses, das vor den Toren der Stadt lag. Die zwei anderen Männer, beide um etliches jünger als der Aufseher, arbeiteten dort als Hauswart und Krankenpfleger. Das Hospital war seit mehreren Jahren nicht mehr in Gebrauch, da die Pest dank der Gnade Gottes ebenso viele Jahre ferngeblieben war. Was allerdings für viele ein Segen war, erwies sich als Fluch für diejenigen, deren Lebensunterhalt von der Pflege der Pestkranken abhing. Zwar erhielten die drei Männer einen festen Lohn, auch in den Jahren, in denen die Pest nicht wütete, aber durch die Gaben verzweifelter Pestkranker und ihrer Angehörigen und vor allem durch die Kostbarkeiten, die sie sich bei den Zwangsräumungen der verseuchten Häuser ungestraft aneignen konnten, waren die Einkünfte des Aufsehers und seiner Bediensteten in Zeiten der Pest um ein Vielfaches höher. Um diese mageren Jahre zu beenden, war der Aufseher in eine deutsche Stadt gereist, wo schon seit geraumer Zeit die Pest herrschte. Dort war es ihm gelungen, den Fuß eines verstorbenen Pestkranken zu entwenden. Er nahm das bereits verwesende Glied mit nach Rouen, wo er und seine Handlanger eine Teufelssalbe daraus zubereiteten. Die Männer beabsichtigten, hier und da in der Stadt die Türpfosten mit dieser Substanz zu bestreichen. Aber bereits auf ihrem ersten nächtlichen Streifzug ertappte ein Stadtwächter einen von ihnen: den Hauswart des Pesthauses. Der Wächter schöpfte Verdacht, weil der Mann an der Seitentür eines der vornehmsten Häuser der Stadt herumschlich. Dessen Erklärung, er habe mit der Schmiere schwergängige Türen und Schlösser behandeln wollen, schenkte der Stadtwächter keinen Glauben. Der Hauswart wurde festgenommen, und der hinzugezogene Scharfrichter erzwang ein Geständnis. Kurz darauf wurden auch der Aufseher und der Pfleger des Pesthauses verhaftet, so wie auch die Verlobte des Hauswarts, Claudine Faré.
Gaspard und ich folgten den Pestsäern in geringer Entfernung, bis der Tross den Alten Markt erreichte. Ein Jahrhundert zuvor war Jeanne d’Arc an dieser Stelle von den Engländern verbrannt worden. Die Asche der Jungfrau von Orléans hatte man in die Seine gestreut, und ihr Name sollte sich schon bald in der ganzen Welt verbreiten. Die vier Pestsäer, die an diesem Tag den Feuertod starben, sollten zwar die Schmerzen, nicht aber den posthumen Ruhm der Jeanne d’Arc teilen.
In der Mitte des Marktplatzes waren vier Scheiterhaufen errichtet. Ihnen gegenüber hatte man eine Holztribüne aufgebaut, die mit bunten Baldachinen und Fahnen geschmückt war. Die Bürgermeister, die kirchlichen Würdenträger, die Räte, die Richter, die Schatzmeister und die Hauptmänner des städtischen Heeres nahmen auf der Tribüne Platz. In der vordersten Reihe saß, neben den Bürgermeistern, der Kanoniker le Lieur in seinem schwarzen Tuchmantel. Ich erkannte den hageren Geistlichen auf Anhieb, denn er war ein guter Kunde meines Vaters, und sein Sohn Pierre war ein Mitschüler von Gaspard und mir.
Die Pestsäer wurden vor die Tribüne geführt. Zwei Gerichtsdiener hielten den besinnungslosen Mann aufrecht, so gut es ging. Mit gesenktem Haupt stand Claudine neben dem Hauswart, ihrem Verlobten, der nie ihr Ehemann werden sollte. Auf einmal regten sich die Lebensgeister des Aufsehers wieder, und er sah die Würdenträger auf der Tribüne starr und unverschämt an. Nachdem einer der Richter das Urteil verlesen hatte, erhob sich le Lieur, um die vier Verurteilten auf den bevorstehenden Tod vorzubereiten. In dem goldenen und mit Edelsteinen besetzten Kreuz, das er an einer ebenfalls goldenen Halskette trug, spiegelte sich das Sonnenlicht. Ich konnte nicht jedes seiner Worte verstehen, aber er sagte ungefähr, die verübten Verbrechen seien derart, dass die vier Verurteilten jedes Recht auf irdisches Glück und ewige Seligkeit verwirkt hätten. Da das heilige Evangelium jedoch ein Evangelium der Gnade sei, erhielten die Verurteilten noch ein letztes Mal die Möglichkeit, ihre Sünden zu bekennen. Wenn sie die Verbrechen, derer sie für schuldig befunden waren, freimütig geständen, könnte das die Strafe mildern: Dann könnte man ihnen die Gnade gewähren, sie erst zu enthaupten, bevor man ihre Körper den Flammen anheimgäbe. Bei der Frage des Kanonikers, was ihre Antwort auf dieses gnädige Angebot eines sanften Todes sei, herrschte auf dem Marktplatz tiefe Stille.
Der Ohnmächtige regte sich nicht. Nach einer kurzen Kopfbewegung des Geistlichen schleiften die Schergen ihn zum Scheiterhaufen.
Der Aufseher des Pesthauses atmete ein paar Mal tief durch und sagte dann mit fester Stimme: „Mach mich ruhig zur lebenden Fackel.“
Le Lieur bedeutete den Schergen, den Mann zum Scheiterhaufen zu bringen, und sagte, jedes Wort bedächtig formend: „Brennen wirst du hier, und brennen wirst du in der Hölle!“
Alle Augen richteten sich nun auf den Hauswart und Claudine. „Ich will das Beil“, rief jener mit matter, zitternder Stimme.
„Du bekennst dich schuldig. Dir wird das Beil gegönnt.“ Die Stimme des Geistlichen klang auf einmal salbungsvoll, so als hielte er vor vornehmer Gesellschaft eine Grabrede. „Und du?“, fragte er und zeigte dabei auf Claudine.
Claudine richtete den Blick zum Himmel, der an diesem grausamen Tag blau und wolkenlos war, und rief dann aus: „Ich will heim.“
„Ist das alles, was du zu sagen hast?“, fragte der Kanoniker.
„Ich will heim“, wiederholte sie.
„Die Hölle wird von nun an dein Heim sein“, sprach er.
Die Leute um mich herum bekreuzigten sich. Ihre Gesichter waren erhitzt und erregt, die Augen leuchteten. Populus vult panem et circenses, hatte ich gerade in der Schule gelernt. Und genau so ist es.
Der Henker stellte sich neben den Holzblock. Ruhig und konzentriert wog er das Beil mit der Hand, wie ein Zimmermann, der sein Werkzeug prüft. Er hatte das riesige Blatt so gründlich poliert, dass es in der Sonne glänzte. Die Gerichtsdiener führten den Hauswart des Pesthauses zum Richtblock und zwangen ihn, sich niederzuknien.
„Ich will mir das nicht länger ansehen“, sagte ich.
„Still“, entgegnete Gaspard und stellte sich auf die Zehenspitzen. „Es beginnt.“
„Ich gehe.“
Gaspard warf mir einen kurzen, ärgerlichen Blick zu. „Nun warte doch, sonst verpasse ich es.“
„Wenn du mich suchst: Ich bin am Fluss.“
„Bleib hier, Dummkopf! Lass mich nicht allein.“
„Du triffst bestimmt andere Bekannte.“
„Warte, sei still!“ Gaspard streckte sich, um zu sehen, ob der Henker mit einem Hieb auskam.
Ich konnte es nicht lassen, Claudine noch einmal anzusehen. Die Schergen waren dabei, die junge Frau auf dem Scheiterhaufen festzubinden. Sie richtete den Blick gen Himmel, als sehnte sie sich danach, schon nicht mehr hier zu sein.
Als ich den Alten Markt verließ, erreichte das Grölen der Menge einen ekstatischen Höhepunkt. Das Lärmen schien geradewegs aus den Tiefen der Erde zu kommen.
Die Straßen um den Marktplatz waren wie ausgestorben. Alle Werkstätten und Läden waren geschlossen. Sogar der Stammplatz des lahmen Bettlers Antoine, an der Ecke Rue de Fer und Rue des Chanoines, war verlassen; jemand musste ihn zum Alten Markt getragen haben. Mir begegneten nur ein paar herumlaufende Schweine und Hunde. Ich vermied den Blick in die Rue des Chanoines, denn ich wusste, dass dort Claudines Elternhaus stand. Wo ihre Eltern wohl waren? Was taten, dachten und fühlten sie in diesem Moment? Die Torwächter sahen mich erstaunt an, als ich an ihnen vorbeiging, ließen mich aber unbehelligt. Einen kurzen Moment zögerte ich und blieb stehen. Ich überlegte, ob ich die Brücke überqueren und durch die Felder streifen sollte oder ob ich lieber auf der Stadtseite des Flusses bleiben und in der Seine schwimmen sollte. Ich entschloss mich zu Letzterem und schlug die Richtung zu unserem kleinen Strand ein.
Auch außerhalb der Stadt herrschte die Stille des nahenden Todes. Keine Frau wusch ihre Wäsche, kein Fischer flickte seine Netze. Aus der Ferne sah ich, dass alle Fensterläden und Türen des Pesthauses geschlossen waren. Nur auf dem Fluss ging das Leben weiter. Die Schiffer, die Wollballen und Weinfässer anlieferten, waren vermutlich die Einzigen, die nicht wussten, welches Spektakel sich innerhalb der Stadtmauern abspielte. Ich ließ die Stadt hinter mir und kam an ein paar schäbigen Hütten vorbei. Auch sie waren verlassen.
Als ich den Strand erreicht hatte, an dem meine Brüder und ich immer mit unseren Freunden badeten, weil der Fluss hier breit und tief war, entkleidete ich mich. Ich ging ins Wasser und ließ mich schnell vornüber in die Fluten fallen. Ich wollte weg von dieser Welt, fort von all den grölenden Menschen. Reglos ließ ich mich sinken und von der Strömung treiben, bis alle Luft aus den Lungen entwichen war und mir der Kopf durch die Beklemmung fast platzte. Ich tauchte wieder auf, schwamm ans Ufer und ging zurück zum Strand. Dort ließ ich mich in der Sonne trocknen und aß die Zuckermandeln, die noch in meiner Hosentasche steckten.
Die letzten Worte von Claudine umschwirrten mich wie unsichtbare Fliegen: „Ich will heim.“ Ich fragte mich, ob sie schon gestorben war. Die Henker schreckten nicht davor zurück, das Feuer klein zu halten, damit sich die Hinrichtung in die Länge zog.
Erst spät, als ich sicher sein konnte, dass der Rummel auf dem Alten Markt vorbei war, kehrte ich in die Stadt zurück. Als ich an der am Fluss gelegenen Tuchmühle vorbeiging, hörte ich ein merkwürdiges Wimmern. Es klang, als wäre jemand in Not. Ich ging um die Tuchmühle herum und erschrak bei dem Anblick, der sich mir auf der Rückseite der Mühle, außerhalb des Blickfeldes der Stadt, bot. Ein mir unbekannter Junge hielt Gaspard fest; er hatte die Arme meines Freundes auf den Rücken gedreht, sodass der sich nicht von der Stelle rühren konnte. Vor Gaspard stand, nur wenige Fuß entfernt, Pierre le Lieur, der Sohn des Kanonikers. Pierre fuchtelte mit einem Stock herum. Daran hing ein schmuddeliges Tuch, das immer wieder ganz nah am Gesicht meines Freundes vorbeiflatterte. Gaspard warf stöhnend den Kopf hin und her, um dem schmutzigen Lappen auszuweichen.
Dieser Pierre war ebenso hager wie sein Vater. Seine Nase war so spitz und dünn wie ein Stück gefaltetes Pergament. Pierre gehörte zu der Sorte von Jünglingen, die keine Freunde haben, wohl aber Anhänger, meist arme Buben, die sie mit Geld und Begünstigungen an sich binden. Er wohnte mit seiner Mutter in einer kleinen Behausung neben dem herrschaftlichen Wohnsitz des Kanonikers, der, wie ganz Rouen wusste, eine Verbindungstür zwischen den Häusern hatte einbauen lassen.
Pierre und der andere Junge waren so in das niederträchtige Spiel mit Gaspard vertieft, dass sie mich nicht bemerkten. Ich hatte mich an die Seitenmauer der Mühle gelehnt und beobachtete sie. Es dauerte eine Weile, bevor ich verstand, was hier vor sich ging. Pierre le Lieur wiederholte mehrfach, dass er das Tuch mit der Pestsalbe beschmutzt habe, die die Stadt in Aufruhr versetzt hatte. Dann hörte ich ihn sagen: „Mein Vater hat einen Topf mit dem lebensgefährlichen Zeug mitgenommen, um es mir zu zeigen. Und da kam ich auf die Idee, einigen Leuten mithilfe der Pestsalbe eine Lektion zu erteilen.“ Der Mund in Pierres schmalem Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. In seinem Gesichtsausdruck mischten sich perverse Lust und tiefer Hass; manchen Menschen bereitet es einfach Vergnügen zu hassen. Langsam und mit Spott in der Stimme fuhr er fort: „Und einer der Ersten, denen ich einen Denkzettel verpassen will, ist ein gewisser junger Graf, dem es beliebt, auf mich herabzublicken.“ Pierre hielt den schmuddeligen Stofffetzen dicht vor das leichenblasse Gesicht meines Freundes. „Gleich wasche ich dir deine Visage mit dieser wunderschönen Pestseife.“ Stoßartig bewegte er die tödliche Fahne immer weiter nach vorn. Mit aller Gewalt versuchte Gaspard, sich aus dem Griff des Jungen zu befreien – vergeblich. Schlagartig verschwand das Grinsen aus Pierres Gesicht. Sein längliches Gesicht war nun straff wie ein Trommelfell. „Ich muss dir deine dreckige Visage gar nicht waschen. Schon der Geruch des Lappens reicht aus, dafür zu sorgen, dass innerhalb von etwa zehn Tagen Beulen durch deine Haut brechen. Bald darauf wird dich ein unerträglicher Juckreiz plagen, danach stellen sich Fieber und heftiges Erbrechen ein, das so lange andauert, bis du deine adlige Seele ad fundum ausgekotzt hast.“
Ich konnte Gaspards Augen sehen: weit aufgerissene und entsetzte graublaue Augen, die blind vor Angst waren. Timor purus. Nichts in der Welt ist so stark wie die Angst, nichts hat so viel Macht und die Kraft, Menschen umzuwerfen. Die Angst ist stärker, viel stärker als die Freude. Unerbittlich reißt sie uns die Masken herunter, hinter denen wir uns verstecken. Die Furcht vermag es, die Menschen vollkommen zu entblößen und sie in ihrer ganzen Nacktheit zu zeigen. Wenn die Angst sie ergriffen hat, bleibt von Edelleuten, Mächtigen, Reichen und Gelehrten nichts übrig als armselige, einsame Menschen. Die Furcht offenbart, wer wir wirklich sind – darin liegt ihre verblüffende Schönheit. Die Angst macht uns alle gleich, und dadurch bietet ausgerecht sie uns die Gelegenheit zur bedingungslosen Liebe und zum uneigennützigen Beistand.
Dann war der Moment da, in dem der pestverseuchte Lappen gleich Gaspards Gesicht berühren würde. Ich zögerte nicht lange und sprang nach vorn, riss dem verdutzten Pierre den Stock mit dem Tuch aus der Hand und warf ihn wie einen Speer in den Fluss, so weit ich konnte. Der Junge, der Gaspard festhielt, war zu überrascht, um etwas tun oder sagen zu können. Blindlings schlug ich ihm mit der Faust auf die Nase. Man hörte es knacken, Blut floss ihm über das Gesicht. Ich drehte mich zu Pierre um, der wieder anfing zu grinsen. Er sagte, alles sei nur ein Scherz; natürlich habe er den Lappen nicht mit der Pestsalbe eingeschmiert. Es war nicht allein Pierres höhnisches Lächeln, das mich in diesem Moment rasend machte. Alle grinsenden und grölenden Gesichter, die ich an diesem Tag in der erhitzten Stadt gesehen hatte, verschmolzen in dem zynischen Lachen von Pierre le Lieur. Ich wollte nur eines: dass das Grinsen aufhörte. Nieder mit der grölenden Bestie! Das würde ich jedoch nur erreichen, wenn ich für einen Augenblick das Tier in mir herausließe. Was dann hinter der Tuchmühle geschah, daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern; ich weiß nur, dass der Schöpfer mir einen großen und kräftigen Körper gegeben hat, und dass Pierre und sein Freund am Ende heulend und blutverschmiert abzogen. Einer von Pierres Armen baumelte genauso schlapp an seiner Schulter wie bei den zum Tode verurteilten Pestsäern.
Gaspard und ich setzten uns ans Ufer des Flusses.
„Geht es?“, fragte ich.
„Ja. Nein. Es geht.“
„Kümmere dich nicht darum. Es war ein schlechter Scherz.“
„Das war kein Scherz. Es war eine restlose Demütigung.“
„Ein Bastard kann einen Grafen nicht erniedrigen. Das ist unmöglich.“
„Ich kann diesem Hurensohn nicht mehr unter die Augen treten“, schrie Gaspard. „Und wenn bekannt wird, was passiert ist, kann ich vielen Leuten in Rouen nicht mehr ins Gesicht sehen.“
Die Ärmel seines Kurzmantels waren mit Blut befleckt. „Was hat euch denn überhaupt hierher verschlagen?“, wollte ich wissen.
„Der Freund, mit dem ich in die Stadt gegangen war, um mir die Hinrichtung anzusehen, hat mich im Stich gelassen. Darum habe ich mich einem Klassenkameraden angeschlossen. Er schlug vor, an den Fluss zu gehen und frische Luft zu schnappen.“
„Du willst doch wohl nicht behaupten, dass alles meine Schuld ist?“
Mit einem Ruck wandte Gaspard sich mir zu. Die Angst in seinen graublauen Augen war in Wut umgeschlagen. „Wenn du bei mir geblieben wärst, wäre mir diese Misere erspart geblieben!“
„Du könntest dich auch bei mir bedanken, weil ich dich aus deiner misslichen Lage befreit habe!“
„Der Sohn des Grafen Jean de Jumelles entscheidet selbst, ob er sich bei jemandem bedankt oder nicht.“
Gaspard stand auf und ging ohne einen Gruß.
* * *
Am übernächsten Tag kamen zwei Gerichtsdiener in die Schule und nahmen mich mit. Meine Mitschüler blieben fassungslos zurück; sie konnten nur ahnen, was hier vor sich ging. Sowohl Gaspard als auch Pierre hatten sich nach der Verbrennung der Pestsäer nicht mehr in der Schule blicken lassen. Und einer meiner Klassenkameraden hatte wenige Stunden nach der Hinrichtung den stark blutenden Pierre in der Stadt gesehen – das alles hatte in unserer Klasse natürlich für viel Gesprächsstoff gesorgt.
Die Gerichtsdiener brachten mich in den gewölbten Kapitelsaal der Kathedrale. Hinter einem schweren Holztisch mit gedrechselten Beinen saßen der Kanoniker le Lieur, der wie immer schwarz gekleidet war und ein großes goldenes Kreuz an einer Halskette trug, und daneben Graf de Jumelles, dessen prächtig besticktes Gewand nicht so recht zu seinem pickeligen Gesicht passte. Es war gut möglich, dass der Edelmann stark an der Franzosenkrankheit litt; es war ein offenes Geheimnis, dass der Graf sich nach dem Tod von Gaspards Mutter mit Frauen aus dem niedersten Stand tröstete. Schräg hinter dem Kanoniker stand mein Vater in seinem Schneiderkittel. In der Hand hielt er seine Mütze, an der er nervös herumfingerte. Hinterher erzählte er mir, dass die Gerichtsdiener auch ihn völlig überraschend in der Werkstatt abgeholt hatten und er nicht einmal die Gelegenheit gehabt hatte, sein Arbeitszeug abzulegen und sich etwas Anständiges anzuziehen. In einer Ecke des Kapitelsaals, unter dem großen Glasmalereifenster mit dem Stadtwappen von Rouen, standen, in einiger Entfernung voneinander, Pierre und Gaspard. Das sonst so bleiche Gesicht von Pierre wies die Folgen meiner Faustschläge auf und war grün und blau. Der rechte Arm hing in einem Leinentuch, das hinter dem Hals verknotet war. Gaspard starrte reglos zu Boden; zumindest blickte er nicht auf, als man mich hereinführte. Der Junge, der Gaspard an der Tuchmühle festgehalten hatte, war nicht da – und er kam auch nicht mehr zur Sprache. An der Tür hinter mir stellten sich die beiden Gerichtsdiener auf.
Der Kanoniker bedeutete mir, an den Tisch vor ihn und den Grafen zu treten. „Vor mir steht Henri de la Mare, fünfzehn Jahre alt, Sohn des François de la Mare, Schneidermeister in der Rue des Tailleurs?“
„Ja“, antwortete ich.
„Pardon?“, erwiderte der Kanoniker mit erhobener Stimme.
„Ja, optime pater.“
Der Geistliche sah mich einen Augenblick lang mit kaltem Blick an, bevor er fortfuhr. „Graf de Jumelles, ich und dein Vater sehen uns gezwungen, unsere täglichen Pflichten zu unterbrechen, weil du dich eines ernsten Vergehens schuldig gemacht hast. Das Ergebnis deines gewalttätigen Handelns siehst du hier in der Ecke des Saals.“ Der Kanoniker zeigte mit dem Arm im schwarzen Tuch auf seinen Sohn Pierre, der mit einer nervösen Kopfbewegung reagierte. „Der Wundarzt war eine geschlagene Stunde damit beschäftigt, die Verletzungen des Opfers zu versorgen. Der Knabe hat höllische Schmerzen erlitten, als der Medikus seine Schulter einrenkte.“ Le Lieur wartete einen Moment und sprach dann mit sich überschlagender Stimme: „Selbst auf der Straße waren die Schmerzensschreie zu hören! Und ganze drei Zähne hat er verloren!“
Die Worte des Geistlichen und die ganze Entourage im Kapitelsaal, deren Mittelpunkt ich war, schüchterten mich dermaßen ein, dass mein Herz wie wild raste. Den Kanoniker und den Grafen wagte ich nicht anzusehen, meinen Vater ebenfalls nicht, und Gaspard wollte ich nicht in die Augen sehen. So richtete ich meinen Blick auf Pierre. Mir diesen Feigling anzuschauen, beruhigte mich irgendwie. Was immer geschehen würde und einerlei, was mir nun bevorstand: Meine Faustschläge hatten einem gerechten Zweck gedient.
„Ich erteile nun dem Opfer das Wort. Pierre, erzähle uns freiheraus, was geschehen ist.“
Pierre tat einen Schritt nach vorn. Die Wunden in seinem Mund bereiteten ihm sichtlich Probleme beim Sprechen; er sprach, als hätte er gerade einen Mundvoll Mehl genommen, den er nicht loswurde. „Nach der Hinrichtung auf dem Marktplatz bin ich zum Fluss spaziert. Ich hatte im Rauch gestanden und spürte das Bedürfnis nach frischer Luft. Nachdem ich mich auf der Höhe der Tuchmühle ans Ufer gesetzt hatte, tauchte Henri plötzlich dort auf. Er kam auf mich zu und wollte Geld von mir. Ich weigerte mich, aber er forderte weiter Geld, sagte, dass ich mehr als genug davon hätte, weil mein Vater einer der reichsten Männer von Rouen sei …“
„Lüge, nichts als Lüge!“, schrie ich.
„Schweig!“, brüllte der Kanoniker.
„Aber optime pater …“
„Schweig, bis ich dir das Wort erteile, du Wicht!“
Stockend fuhr Pierre mit seiner Geschichte fort. „Als ich ihm nichts gab, packte Henri mich am Arm und drehte ihn so lange, bis ich ein fürchterliches Knacken hörte. Ich schrie vor Schmerzen auf. Ich hätte ihm all mein Geld gegeben, um von den Schmerzen befreit zu sein, aber ich hatte wirklich nichts bei mir. Nachdem Henri meinen Arm endlich losgelassen hatte, fing er an, wie wild auf mich einzudreschen. Seht nur …“ Pierre öffnete den Mund, sodass alle die dunklen Lücken sehen konnten, die die ausgeschlagenen Zähne hinterlassen hatten. „Zum Glück kam Gaspard mir zu Hilfe, sonst wäre ich nun wohl tot.“
Der Kanoniker nickte Pierre mit einem warmen, verständnisvollen Blick zu. „Danke für deine mutige Aussage, junger Mann. Dann erteile ich nun unserem zweiten Zeugen das Wort, dem jungen Grafen Gaspard de Jumelles.“
Gaspard trat nach vorn. Er trug einen seiner schönen Kurzmäntel und eine eng geschnittene Hose. Zum ersten Mal während der Anhörung sah er mich an. Auch während seiner Darstellung, die er ganz offensichtlich einstudiert hatte, fixierte er mich mit starrem Blick. „Ehrwürdiger Kanoniker. Ich bestätige all das, was Pierre soeben sagte. Auch ich ging nach der Verbrennung der Missetäter am Fluss entlang, um frische Luft zu schnappen. Da sah ich, wie Henri einen Jungen verprügelte. Durch meine Autorität als junger Adliger – und vielleicht auch durch die freundschaftlichen Bande, die Henri und ich einst unterhielten – konnte ich der Schlägerei ein Ende bereiten. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Ich schwöre bei Gott, dass ich die Wahrheit sage.“
Ich schaffte es, meinen Körper unter Kontrolle zu behalten, denn ich stürzte nicht auf Gaspard los. Aber meine Stimme hatte ich nicht in der Gewalt. Ich schrie, so laut ich konnte: „Du widerlicher Petrus, du dreckiger Lügner!“
Gaspard zwinkerte kurz mit den Augen, aber er schlug sie nicht nieder, sondern blickte mich weiterhin an. Der Geistliche war weniger beherrscht. Er gab den Gerichtsdienern, die in meinem Rücken standen, ein Zeichen. Der gewaltige Hieb, den mir einer der Schergen mit seinem Handschuh versetzte, der mit Eisen beschlagen war, reichte aus, um mich zum Schweigen zu bringen. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten; es fühlte sich an, als wäre mein rechtes Ohr entbrannt.
„Das soll dir eine Lehre sein!“, herrschte der Kanoniker mich an.
Nachdem ich mich einigermaßen von dem Schlag erholt hatte, suchte ich den Blick meines Vaters. Doch der schüttelte nur den Kopf. „Aber“, sprach ich leise, „habe ich denn kein Recht auf Widerrede?“
„Erst, wenn ich es sage“, erwiderte der Kanoniker.
Gaspards Vater wurde ungeduldig. „Lasst das Bürschchen sprechen“, brummte er mit seiner tiefen Stimme. „Ich habe keine Zeit, hier ewig zu sitzen.“
„Nun gut“, sagte der Geistliche mit sichtlichem Widerwillen und gab mir zu verstehen, dass ich nun sprechen könne. „Aber fasse dich kurz!“
„Erlauchter Graf, optime pater“, begann ich, „ich bekenne, dass ich wie Pierre und der junge Graf nach der Hinrichtung der vier Verbrecher am Fluss war. Und in der Tat sind wir an der Tuchmühle aufeinandergetroffen. Jedoch hat sich die Begegnung ganz anders zugetragen, als Pierre und Gaspard sie darstellen! Ich schwöre bei der Heiligen Jungfrau, dass ich die Wahrheit spreche! Was ich sah, war dies: Gaspard wurde von einem Jungen festgehalten, der hier nicht anwesend ist, und Pierre bedrohte ihn mit einem Tuch, das er nach eigener Aussage mit der Pest verseucht hatte. Was hätte ich anderes tun sollen, als den jungen Grafen, den ich bis zum Betreten dieses Saals für meinen besten Freund hielt, aus seiner bedrängten Lage zu befreien? Ich wäre doch ein verachtenswertes Geschöpf, wenn ich es unterlassen hätte?“
Meine Worte beeindruckten weder den Grafen noch den Kanoniker. Gaspard sah mich noch immer mit festem und kaltem Blick an. Ich konnte nicht das geringste Fünkchen Freundschaft darin erkennen. Mir wurde klar, dass ich sagen konnte, was ich wollte. Es war völlig einerlei, denn das Urteil, das über mich gefällt werden würde, stand längst fest. Um es so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, führte ich meine sinnlose Aussage hastig zu Ende.
„Dass ich dann vielleicht etwas zu hart auf die Angreifer meines Freundes eingeschlagen habe, das gebe ich wohl zu. Aber, bei der Heiligen Jungfrau, Gaspards Geschichte ist eine reine Lüge!“
Gaspards Vater räusperte sich geräuschvoll und beförderte eine beachtliche Menge Schleim neben sich auf den Boden. „Ah, dieser Schneidersohn behauptet also, der Spross und Erbe des Grafen de Jumelles sei ein Lügner! Ich habe genug gehört.“
Le Lieur tat, als wäre er sich noch immer nicht ganz sicher. „Und wie sollte Pierre den Lappen verseucht haben?“, fragte er.
„Er erzählte, dass Ihr einen Topf mit der Salbe von den Pestsäern mit nach Hause genommen hättet“, antwortete ich. „Und wie jedermann weiß, seid Ihr und Pierre … gute Nachbarn.“
Der Kanoniker schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. „Barer Unsinn! Zum einen habe ich diese Salbe nie selbst zu Gesicht bekommen, und zum anderen würde ich ein derart todbringendes Zeug niemals mit nach Hause nehmen.“ Abermals hämmerte er mit der flachen Hand auf die Tischplatte. „Es mag sein, dass ich eher ein Kenner der kirchlichen Rechtsprechung bin als der weltlichen, aber ich weiß, dass in beiden Rechtssystemen die gleich lautende Aussage zweier Zeugen – wobei eine der beiden auch noch von adligem Gewicht ist – sehr viel schwerer wiegt als die einzelne Aussage eines Burschen, der die Dreistigkeit besitzt, nicht nur uns schamlos zu belügen, sondern auch …“, der Geistliche senkte die Stimme, „… die Heilige Jungfrau.“ Er bekreuzigte sich und wartete, bis die anderen es ihm gleichtaten. In meiner Verwirrung fiel mir auch nichts Besseres ein, als das heilige Zeichen auf der Brust zu machen. „Der Einzige, der noch nicht gehört wurde, ist der Vater des Beschuldigten. François de la Mare hat das letzte Wort.“
Normalerweise konnte mein Vater seinen Standpunkt kurz und bündig formulieren, aber nun rang er nach Worten, wobei er noch immer ununterbrochen an seiner Mütze fingerte. „Ehrwürdiger Kanoniker, erlauchter Graf! Wenngleich ich den jungen Grafen und den verwundeten jungen Mann nicht persönlich kenne, erkenne ich ihnen den Respekt zu, den sie zweifellos verdienen. Und obwohl ich für die Glaubwürdigkeit meines Sohnes eigentlich die Hand ins Feuer legen würde, muss ich gestehen, dass sich die soeben gehörten Zeugenaussagen in erheblichem Maße widersprechen. Auch wenn wir nie genau erfahren werden, was sich an der Tuchmühle am Fluss abgespielt hat, so muss selbstverständlich doch eine Lösung gefunden werden, so viel steht fest …“
„Ach so ist das, Vater! Mein Wort ist nichts wert, weil ich nicht von Adel bin, sondern nur der Sohn eines … weil ich nur Euer Sohn bin?“
„Schweig, du Teufel!“, überschrie der Kanoniker meine Worte. „Oder willst du noch eine Ohrfeige mit dem Handschuh des Gerichtsdieners?“
„Es erscheint mir am vernünftigsten“, fuhr mein Vater fort, „wenn wir es so machen, wie der Graf, der Kanoniker und ich schon vor diesem Verhör vereinbart haben. Ich bin bereit, dem Opfer eine Wiedergutmachung zu zahlen, und ich werde Sorge dafür tragen, dass mein Sohn die Stadt binnen drei Tagen verlässt. Für immer …“
Ungläubig schüttelte ich den Kopf. Die ganze Verhandlung war tatsächlich eine Farce gewesen, das Urteil stand von vornherein fest. Ich ließ den Kopf hängen und sah niemanden mehr an, auch meinen Vater nicht.
„Ergo, die Sache ist völlig eindeutig“, sagte le Lieur. „Ich stelle fest, dass Henri de la Mare für schuldig befunden wird, einen unschuldigen Mitbürger schwer misshandelt und ihm bleibende körperliche Schäden zugefügt zu haben. Deshalb verurteile ich die Familie des Schuldigen zur Zahlung eines Sühnegelds in Höhe von einem Falken je verlorenem Zahn, wie seit Jahrhunderten üblich, oder zur Zahlung des entsprechenden Gegenwertes in Goldfranken. Darüber hinaus wird Henri de la Mare für immer aus dieser Stadt verbannt. Hiermit ist die Sitzung beendet.“
Es geschah so abrupt und alles war so absurd, dass ich das Gefühl hatte, nicht wirklich anwesend zu sein. Selbst mein pochendes Herz und mein brennendes Ohr schienen nicht mir zu gehören. Beim Verlassen des Kapitelsaals blieb der Kanoniker dicht vor mir stehen. Der säuerliche Schweißgeruch, den er verbreitete, holte mich wieder zurück in die Wirklichkeit. „Sei froh, dass wir diese Sache nicht vor den zuständigen Richter gebracht haben“, fauchte er mir ins Gesicht. „Dann wärst du Leuten ausgeliefert gewesen, die bei der Vernehmung nicht so freundlich sind wie wir.“
„Ihr seid zu gütig …“, murmelte ich. Vermutlich verstand le Lieur es nicht, denn er schenkte mir keine Beachtung mehr.
Der Graf war bereits entschwunden; Pierre ging mit gesenktem Blick an mir vorbei – Gaspard hatte zumindest noch den Anstand, mich beim Hinausgehen anzusehen. Es war das letzte Mal, dass ich in die graublauen Augen meines Freundes sah. Ich konnte in seinem Blick keinen Funken Freundschaft mehr erkennen und auch keine Angst, sondern nur noch kalten Stolz.
* * *
Als wir auf dem Nachhauseweg am Glockenturm vorbeikamen, fragte ich meinen Vater, ob er zornig auf mich sei.
Er blieb stehen und sagte: „Ich bin furchtbar wütend. Aber nicht auf dich.“
„Wieso habt Ihr dann nicht auf meiner Seite gestanden?“
„Das habe ich doch getan! In der vorangehenden Unterredung mit dem Kanoniker und dem Grafen habe ich dich nach Kräften verteidigt! Aber gegen die beiden hatte ich einfach keine Chance.“
„Und Gaspard … Wie konnte dieser räudige Hund mich so verraten?“ Ärgerlich trat ich einen Hund, der gerade vor meinen Füßen lief. Jaulend rannte das Tier weg.
Mein Vater legte eine Hand auf meine Schulter. „Gaspard ist ein Adliger. Ehre ist ihm heiliger als Freundschaft. Ich wette, dass der alte de Jumelles seinem Filius nachher, hinter geschlossenen Türen, ordentlich das Fell über die Ohren zieht. Es würde mich nicht wundern, wenn auch Gaspard Rouen innerhalb kürzester Zeit verlässt.“
„Und dann der Kanoniker le Lieur … Habt Ihr jemals einen solchen Teufel im Priestergewand gesehen?“
„Man weiß nie, weshalb die Menschen so sind, wie sie sind. Vielleicht ist seine Hartherzigkeit die Kehrseite der Liebe zu seinem unehelichen Sohn.“
Der nüchternen Weisheit meines Vaters hatte ich noch nie das Wasser reichen können. Wäre in diesem Moment wieder ein Hund in meiner Nähe gewesen, hätte ich noch viel härter nach ihm getreten.
„Was geschieht nun mit mir?“, fragte ich.
„Du gehst nach Paris.“
„Und was mache ich dort?“
„Du studierst.“
„Und was?“
„Der älteste Bruder deiner Mutter ist Benediktiner in Paris. Er hat schon einmal angeboten, dir zu helfen, Geistlicher zu werden. Du bist klug, und eine Laufbahn in der Kirche eröffnet dir viele Möglichkeiten.“
„Und wenn ich nun andere Pläne mit meinem Leben habe?“
„Die Alternative ist … oder besser gesagt war …, dass du bei mir in die Werkstatt eintrittst. Aber könntest du dir wirklich vorstellen, dein Leben lang Stoff abzumessen?“
Mein Vater hatte recht. Es hatte mich nie gereizt, sein Nachfolger im Tuchhandel zu werden. Die überraschende Aussicht auf ein Leben in Paris linderte die Schmerzen der soeben erlittenen Demütigung wie eine starke, schnell wirkende Arznei. Ich war noch nie in Paris gewesen. Aber ich kannte diese Stadt, die Menschen aus aller Welt anzog, aus den unzähligen Berichten der Händler, die meinem Vater Tuche und Seide verkauften. Sie erzählten von Straßen, die sogar nachts voller Leben waren, von Märkten, die das ganze Jahr hindurch abgehalten wurden, von prächtigen Kirchen und einer Vielzahl von Theatern … Die Vorstellung, dass ich dies alles nun bald selbst zu Gesicht bekommen sollte, erfüllte mich mit einem prickelnden Gefühl der Erregung. Aber die Wirkung des Heilmittels „Paris“ war ebenso kurz wie stark. Wir gingen durch das Stadttor am Fluss, und im Vorbeigehen sah ich das Wasser der Seine in der Sonne glitzern. Mit einem Mal sah ich die vertrauten, schmalen Gassen von Rouen, die Fachwerkhäuser, die unordentlichen Plätze und die imposante Kathedrale mit anderen Augen – bald würden sie nur noch Erinnerungen sein. Bekannte, die natürlich nicht wussten, dass ich nur noch für drei Tage Einwohner meiner Heimatstadt sein würde, grüßten uns freundlich. Ich konnte mich nicht dazu aufraffen, ihren Gruß zu erwidern.
Meine Mutter sank fast zu Boden, als wir es ihr erzählten. Sie nahm mich in die weichen Arme und hörte nicht auf, mein Gesicht mit ihren harten Arbeitshänden zu streicheln. „Muss ich denn zwei Kinder in einem Jahr verlieren? Erst Anna und nun Henri?“, weinte sie.
„Henri stirbt nicht. Er geht nach Paris“, tröstete mein Vater sie.
Meistens konnte mein Vater meine Mutter schnell beruhigen. Aber diesmal nicht. Jammernd lief sie durch das Haus: „Was soll ich nur tun, was soll ich nur tun?“
„Was hältst du davon, wenn du einen Honigkuchen für Henri backst?“, schlug mein Vater vor. „Dann mache ich mich daran, die Garderobe zu schneidern, die er braucht. Ich werde einen richtigen Studentenmantel für ihn nähen!“
So saßen wir an jenem Abend mit der ganzen Familie um einen großen und noch warmen Honigkuchen herum. François und Pierre, meine jüngeren Brüder, verstanden nicht, weshalb sie auf einmal so viel Kuchen essen durften, wie sie wollten. Auf einer Schiefertafel notierte mein Vater all das, was ich nach Paris mitnehmen musste. Während meine Mutter den Honigkuchen backte, gewann sie allmählich ihre Fassung wieder. „Schließlich bist du mit deinen fünfzehn Jahren schon so gut wie erwachsen“, sagte sie.
Mit der Zunge rieb ich Kuchenreste weg, die an der Innenseite der Zähne klebten. „Zum Glück habe ich sie noch alle“, sagte ich.
„Was?“, fragte meine Mutter.
„Meine Zähne.“
Zwei Tage später, am Abend vor meiner Abreise, nahm mein Vater mich mit auf einen Spaziergang am Fluss. Schweigend gingen wir an der Tuchmühle vorbei und an unserem Badestrand entlang. An der Biegung, die die Seine auf der Höhe des Pesthauses macht, setzten wir uns ans Wasser. Die Strahlen der tief stehenden Sonne sprangen wie Kieselsteine über die kleinen Wellen der Seine.
„Ich werde den Fluss vermissen“, sagte ich.
„Ich werde dich vermissen.“
„Ich werde euch vermissen.“
Mein Vater legte einen Arm um meine Schultern. „Du bist schon ein Mann. Ich bin stolz auf dich.“
„Ihr habt in den letzten Tagen aber nicht viel Freude an mir gehabt.“
„Was immer geschehen ist, und was auch in Zukunft geschehen wird: In diesem Moment sitze ich mit meinem Ältesten am Fluss, und das macht mich glücklich.“
Ich musste auf einmal mit den Tränen kämpfen.
„Du musst mir etwas versprechen“, sagte mein Vater.
„Was denn?“
„Wir Menschen haben unser Leben nie ganz in der Hand. Und mitunter zweifle ich sogar daran, dass Gott unser Leben in der Hand hat. Aber du musst mir versprechen, so zu leben, dass ein anderer niemals einen Grund hat, dich so zu erniedrigen, wie es dir vorgestern widerfahren ist.“
„Das verspreche ich nicht, das schwöre ich dir!“, sagte ich ohne zu zögern.
„Versprechen ist genug.“
„Nein, ich schwöre es. Bei Gott und allen Heiligen.“
„Du klingst schon ganz wie ein Geistlicher“, sagte mein Vater lächelnd.
1 Im Anhang findet sich ein alphabetisches Verzeichnis mit der Übersetzung der lateinischen Wörter, Redewendungen und Zitate.