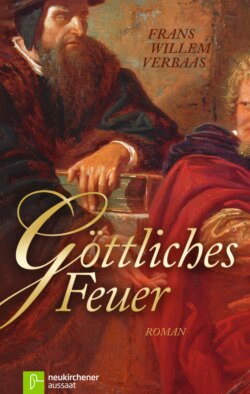Читать книгу Göttliches Feuer - Frans Willem Verbaas - Страница 7
Zweites Kapitel
ОглавлениеZur ersten Begegnung mit Jacques Bernard kam es im Jahr 1531 in einem Wirtshaus an der Rue Saint-Jacques am Rande des Quartier Latin, dem Studentenviertel von Paris. Nachdem ich den ganzen Tag studiert hatte, verließ ich den Lesesaal des Collège, um mir die kalten und steif gewordenen Beine zu vertreten. Ich kam am Wirtshaus La Croix vorbei, einem bekannten Studentenlokal, und trat ein, um zu sehen, ob dort etwas los war. Am größten Tisch hatte sich eine lärmende Gesellschaft von Priesterstudenten aus Burgund versammelt. Auf meine Frage, ob ich mich dazusetzen dürfe, herrschte Stille. Einer der Burgunder – ein Großcousin des Herzogs von Orléans, der wiederum der Sohn keines Geringeren als des Königs war, wie ich wusste – unterbrach das Schweigen mit einem lang gezogenen Rülpser. „Pardon. Nenne mir einen Grund, weshalb wir uns bei unseren ausgelassenen Gesprächen von einem Gildeknecht stören lassen sollten.“
Die Burgunder sahen mich mit der Herzlichkeit einer Meute hungriger Wachhunde an, und ich bemühte mich, mir die Kränkung nicht anmerken zu lassen. „Ah, ich verstehe. Meine Brüder, die sich ebenso wie ich darauf vorbereiten, Gott zu dienen, sind nicht willens, mich in ihren Kreis aufzunehmen.“
Der Großcousin des Herzogs, dessen vornehme Kleidung einen früh gekrümmten Körper umhüllte, nahm einen Schluck Wein und stieß erneut auf. „Für eine einfache Seele hast du einen klaren Verstand. Wir bleiben in der Tat lieber inter pares.“
Ich versuchte nun nicht mehr, mich zu beherrschen. „Ich seid eine Schande für die Heilige Römische Kirche!“, schnaubte ich.
„Eigens für Habenichtse wie dich hat die Heilige Römische Kirche in ihrer Barmherzigkeit gepflegte Spitäler am Rande der Stadt errichtet. Ich bin mir sicher, dass du dich dort sehr viel wohler fühlen wirst als bei uns. Ich schlage dir einen Handel vor: Wenn du dich nun in einem Spital meldest, gehen wir nach Beendigung unseres colloquium zur Kathedrale Notre-Dame und werfen ein paar Sous in den Opferstock für die Armen.“ Der Großcousin des Königs warf seinen Tischgenossen reihum einen triumphierenden Blick zu. Wie auf Befehl fingen die künftigen Vertreter Christi auf Erden abwechselnd an zu johlen und Würgelaute zu machen.
Ich ballte die Fäuste. Aber noch bevor ich meine Chancen richtig einschätzen konnte, erhob sich schräg hinter mir eine tiefe, ruhige Stimme. „Ich halte es für wahrscheinlicher, dass ihr in Notre-Dame eine der vielen Huren auflest, die die Kathedrale zu ihrem Jagdrevier erkoren haben.“
Alle blickten zu dem kräftig gebauten Mann empor, der etwa zehn Jahre älter war als die meisten von uns. Er trug eine braune Kutte, an der mir sofort mehrere Löcher und Risse auffielen. Das Kopfhaar war zu einer Tonsur geschoren, das Gesicht war keinesfalls schmal und er hatte leuchtende, graue Augen. Der Großcousin des Herzogs wusste so schnell nicht, was er erwidern sollte, woraufhin einer seiner Kumpanen für ihn einsprang: „Du bist offenbar gut informiert, Minderbruder!“
„Und du scheinst nicht zu wissen, dass es ungehörig ist, einen geweihten Priester und Doktor der Theologie zu duzen.“
Der adlige Großcousin fand die Sprache wieder. Er erhob sich vom Tisch, stellte sich vor den Mönch und bohrte seinen dünnen Zeigefinger in dessen Brust. „Weißt du eigentlich, wen du vor dir hast?“
„Einen unfreundlichen, unhöflichen und vermutlich gottlosen Sterblichen.“
„Du sprichst mit einem Mann, dem durch seine Geburt das Amt des Bischofs von Beaune zukommt.“
„Dann ist es dir, Hochwürden, bestens gelungen, deine exzellente Stellung hinter einem unverschämten und vor allem unchristlichen Benehmen zu verbergen.“
Der zukünftige Bischof rang nach Luft; abermals fehlten ihm die Worte.
„Glaube nicht, dass ich keine Achtung vor dem Adel habe“, erwiderte der Ordensbruder. „Ich zolle jenen Edelleuten den allerhöchsten Respekt, die ihre Abstammung nicht nur als Privileg, sondern auch als Verpflichtung betrachten.“ Die letzten Worte unterstrich er mit einem spöttischen Lächeln.
Schweigend standen sie sich Auge in Auge gegenüber, der ärmlich gekleidete Mönch und der adlige Student in kostbarem Tuch, bis der Student den Franziskaner schließlich zur Seite schob und wutentbrannt aus dem Wirtshaus stürmte.
„Die hohen Stände haben arg zu leiden“, seufzte der Ordensbruder. Ohne die anderen Priesterstudenten eines Blickes zu würdigen, nahm er mich am Arm und führte mich zu einem freien Tisch im hinteren Teil des Gasthauses. „Ich möchte dich zu einem Becher Wein einladen.“
Und so hielt ich wenig später einen Becher Wein in der Hand und starrte auf die fleischige Nase, die roten Wangen und die grauen Augen des Minderbruders. Der Mann sprach ein merkwürdiges Französisch. Er mengte die Worte wie ein Koch, der verschiedene Zutaten miteinander verrührt. Heraus kam eine Suppe aus Klängen, die mitunter schwer zu unterscheiden waren.
„Du willst zu gern.“
„Was meint Ihr?“
„Du willst zu gern zu diesen Burschen da gehören.“
„Wieso sollte ich nicht zu meinen Studienkollegen gehören wollen?“
„Nicht umsonst heißt es bei dem Psalmisten: Nolite confidere in principibus.“
„Diese Edlen sind Studenten der Theologie wie ich, und auch sie müssen sich auf dem Abort den Allerwertesten abwischen.“
„Weshalb willst du zu Männern gehören, die du aus tiefstem Herzen verachtest?“
„Ihr tut so, als könntet Ihr in mein Herz hineinschauen.“
„Das Herz eines jungen Mannes, wie du einer bist, ist wie ein aufgeschlagenes Buch.“
„Nur eine Hexe oder ein Hexenmeister kann in das Herz eines Menschen blicken. Ich könnte Euch nun ohne Weiteres bei den Inquisitoren denunzieren.“
Der Mönch beugte sich vor und befühlte den Stoff meiner Jacke. „Nicht schlecht. Deutscher Samt, elegant geschnitten“, murmelte er.
„Angefertigt von meinem Vater, der Schneider ist.“ Zu meinem eigenen Erstaunen schwang Stolz in meinen Worten mit.
Der Franziskaner leerte seinen Becher und behielt den Schluck mit sichtbarem Vergnügen einen Moment lang auf der Zunge, bevor er sich den Mund am Ärmel abwischte. „Wein – die gemeinsame Erfindung Gottes und des Teufels! Lass uns auch etwas essen.“ Er rief dem Wirt zu, dass er gekochte Eier, eine Schale Brot und noch mehr Wein wünschte.
„Ich habe mich noch nicht vorgestellt“, sagte ich. „Mein Name ist Henri de la Mare, aus Rouen gebürtig und Student am Collège de Montaigu.“
„Angenehm. Und ich bin Jacques Bernard, Priester und Franziskaner aus Genf.“
„Stimmt es, was Ihr über die Huren in Notre-Dame sagtet?“
„Nun, im Chor der Kathedrale wimmelt es in letzter Zeit tatsächlich von Dirnen, die sich unter den Fremden, die das Gotteshaus besichtigen, ihre Kunden suchen.“
„Und das lässt man zu?“
Der Mönch lächelte. „Die ehrwürdigen Kanoniker von Notre-Dame sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie sich nicht um derartige Trivialitäten kümmern können. Vor nicht allzu langer Zeit kam es beim Begräbnis eines hohen Prälaten zu einer Prügelei mit den Kollegen von Saint-Germain-l’Auxerrois, weil sie sich gegenseitig die besten Plätze im Trauergefolge streitig machten. Aufgebracht, blutend, zerschrammt und mit zerrissenen Kaseln gingen sie dann schließlich nebeneinander im Trauerzug, der übrigens fast eine halbe Meile lang war. Noch wochenlang erhitzte dieser Vorfall die Gemüter. Über solche Dinge regen die Kanoniker von Notre-Dame sich auf – nicht über ein paar öffentliche Weiber, die die Kathedrale zum Bordell machen. Wie weit bist du mit deinem Studium?“
„Ich habe die artes liberales abgeschlossen und arbeite nun an meinem Lizenziat der Theologie.“
„Gibt es ein Gebiet der Theologie, das dich besonders interessiert?“
Ich zuckte mit den Schultern. „Ich nehme brav die zähe Kost zu mir, die die Professoren mir vorsetzen: viele Kirchenväter und noch mehr scholastische Theologie.“
„Wie steht es mit deinem Latein?“
„Das Lesen bereitet mir keine Schwierigkeiten, aber mein gesprochenes Latein riecht nach normannischem Käse – meint zumindest Professor Bédier, dessen Vorlesungen über Patristik ich besuche.“
„Ach, und mein Latein ist gebackenes Patois.“
„Patois?“
„So nennen wir den Dialekt, den wir daheim in Genf sprechen.“
„Ich habe noch nie von einem Doktor der Theologie gehört, der nur mangelhaft Latein beherrscht.“
„Ich bin auch kein Doktor.“
„Aber vorhin sagtet Ihr doch …“
„Ich habe mir den Titel kurzerhand ausgeliehen, um den rülpsenden Flegel zurechtzustutzen.“
Saß da nun ein Wohltäter oder ein Lügner vor mir? Ich wusste es nicht. „Wie lange seid Ihr schon in Paris?“, fragte ich, nur um irgendetwas zu sagen.
„Seit fast drei Jahren. Ich würde es sehr schätzen, wenn du mich mit ‚du‘ anredetest.“
„Wenn Ihr es wünscht … wenn du es wünschst …, werde ich es versuchen.“
Nachdem er mit prüfendem Blick an den Eiern gerochen hatte, pellte er sie und forderte mich auf, es ihm gleichzutun.
* * *
Mein Oheim, der Benediktiner, hatte mir nach meiner Ankunft in Paris auf die Sprünge geholfen. Er hatte mir ein Bett in seinem Konvent besorgt und einen Platz im Collège de la Marche, wo ich mich auf die Zulassungsprüfungen für die Universität vorbereitete. Nachdem ich mich eingelebt hatte, kümmerte er sich aber kaum noch um mich; er war vollauf damit beschäftitgt, den Knaben einer Schule in einem Pariser Armenviertel die Grundzüge des Lateinischen beizubringen. Innerhalb eines Jahres absolvierte ich die vorbereitenden Examina und immatrikulierte mich am berühmten Collège de Montaigu. Am Collège, das auf dem Hügel der Sainte-Geneviève lag, waren mir schon einige große Namen vorausgegangen, darunter Desiderius Erasmus, der allerdings in späteren Jahren kein gutes Wort für Montaigu übrig hatte.
Von meinem Vater erhielt ich eine Zuwendung, mit der ich mich leidlich über Wasser halten und mir sogar die Anschaffung einiger Bücher erlauben konnte. Aber an eine eigene Stube im Studentenviertel war nicht zu denken. Ich musste mich mit einem halben Bett im Schlafsaal des Collège begnügen, der für minderbemittelte Studenten vorgesehen war. Auf der anderen Betthälfte schlief Nico, ein Müllersohn aus Flandern mit einem kaum auszusprechenden Familiennamen: Ghyssaerd. Nico Ghyssaerd war ein kluger Kopf, der fehlerlos lateinische Gedichte schreiben konnte. Dass ich lernte, mich einigermaßen fließend auf Lateinisch zu unterhalten, verdanke ich hauptsächlich den vielen nächtlichen Bettgesprächen, die wir flüsternd in der Gelehrtensprache führten.
Schon bald vertraute Nico mir an, dass er heimlich Vorlesungen am Collège Royal besuchte, dem großen Konkurrenten des Collège de Montaigu. Nach dem Vorbild der humanistischen Gelehrten, die die klassischen griechischen und lateinischen Autoren wiederentdeckt hatten, hielten die Professoren des Collège Royal ihre Studenten dazu an, die Heilige Schrift in den Quellsprachen zu lesen. „Ich lerne nun auch Hebräisch und Griechisch“, erzählte er mir, „damit ich die reine Stimme Gottes hören kann, die nicht durch daran haftende Scholastik verfälscht ist.“
„Hüte dich, dass es hier keiner merkt“, warnte ich ihn. „Professor Bédier will nichts von diesen neuen Tönen wissen, und der Schotte, Professor Mair, schon gar nicht. Sie werden nicht zögern, dich sofort hinauszuwerfen.“
„Als ob das so schlimm wäre.“ Nico drehte sich auf die Seite, mit dem Rücken zu mir. „Übrigens“, flüsterte er, „wusstest du, dass es im Deutschen Reich humanistische Theologen gibt, geweihte Priester, die sich nicht an den Zölibat halten und geheiratet haben, in aller Öffentlichkeit?“
„Unmöglich!“
„Doch, es ist wahr.“
Ich versuchte das Stroh zurückzustopfen, das aus einem Loch unserer Matratze herausragte und mich in die Schulter stach, und seufzte: „Ich schlafe jetzt.“ Aber in dieser Nacht fand ich erst sehr spät in den Schlaf. Die verheirateten deutschen Priester hielten mich wach. Und die Erinnerung an den weißen Busen von Claudine.
Ach, wenn ich mein Bett doch einzig und allein mit Nico und seinen Geschichten hätte teilen dürfen! Leider boten wir auch einem unbesiegbaren Heer von Flöhen und Läusen Unterkunft. Es ist ein Wunder, dass von meiner Haut noch etwas übrig geblieben ist – so oft und heftig habe ich mich im Schlaf gekratzt. Die meisten von uns waren ununterbrochen krank, denn im Winter machten uns Kälte und Feuchtigkeit zu schaffen, und im Sommer plagten uns Hitze und Gestank. Dieser entsetzliche Geruch aus dem Abort, der sich unmittelbar neben unserem Schlafsaal befand! Es ist mir immer noch schleierhaft, wie es mir gelang, jede Nacht einzuschlafen. Mit den Neuankömmlingen erlaubten wir uns einen Spaß und legten ihnen eine Scheibe Schimmel, den wir von den Wänden schneiden konnten, auf den Teller. Nicht, dass es ein großer Unterschied zum Essen gewesen wäre, das man uns vorsetzte: Das meiste war verdorben. Wenn ich etwas in meiner Studentenzeit gut gelernt habe, so ist es das Fasten. Fleisch stand sowieso nicht auf dem Speisezettel. Und ich weigerte mich die Eier zu essen, die man uns auftischte, denn sie waren so verfault, dass man ebenso gut einen Mundvoll reines Gift hätte nehmen können. Das Personal des Collège war nicht viel besser als die Gebäude und die Verpflegung. Von dem Prinzipal, der die Aufsicht über die internen Studenten hatte, sagten wir, er sei eher ein Stück Fleisch denn ein Mensch. Die kurze Peitsche hantierte er mit der lässigen Geschicklichkeit eines Zimmermanns, der den Hammer schwingt. Der Aufseher hatte eindeutig seine Berufung als Henker verfehlt. Seine erbarmungslose Knute konnte aber auch nicht verhindern, dass viele meiner Mitstreiter unverbesserliche Nachtschwärmer waren, die am Ende des Studiums mehr über guten Wein und schlechte Frauen wussten als über die Kirchenväter und die Scholastik.
Es gab Tage, an denen ich meine Eltern vermisste und auch meine Brüder François und Pierre, die Gassen von Rouen, die Seine, die viel breiter und munterer durch meine Heimatstadt floss als durch das dicht bevölkerte Paris. Erinnerungen lassen sich nun einmal nicht ablegen und wegwerfen wie verschlissene Gamaschen. Dennoch war ich auf dem Collège de Montaigu nicht unglücklich. Dank meiner guten Konstitution überstand ich die körperlichen Entbehrungen recht unbeschadet. Und – mindestens genauso wichtig – ich blickte vertrauensvoll in die Zukunft. Zwar konnte ich keine edle Herkunft oder Reichtümer vorweisen, die mich mühelos in ein hohes Amt in der Kirche befördert hätten, und ebenso fehlte mir die Genialität eines Erasmus, aber immerhin studierte ich an der Universität der größten Stadt Europas. Ich war der festen Überzeugung, dass es mir mit einem Lizenziat vom Collège de Montaigu gelingen müsse, eine ordentliche Position innerhalb der Kirche oder eines Ordens oder auch an einer kleinen Universität zu erlangen, die mir materielle Sicherheit und Ansehen verschaffen würde. Freiwillig übertraf ich als Student den Schwur, den ich als Schüler geleistet hatte, als ich am Abend vor meiner Abreise aus Rouen zusammen mit meinem Vater an der Seine gesessen und er den Arm um meine Schultern gelegt hatte. Ich strebte nicht nur ein Leben ohne Kränkungen an, sondern vielmehr ein Leben, auf das mein Vater stolz sein konnte!
* * *
Jacques und ich hatten ein erneutes Treffen verabredet: im Le Mouton, einem Gasthaus, das ebenfalls an der Rue Saint-Jacques, aber außerhalb des Universitätsviertels lag. Le Mouton war volkstümlicher als La Croix und gemütlicher. Dieses Wirtshaus sollte unser fester Treffpunkt werden.
Bei unserer zweiten Begegnung erzählte Jacques, was ihn nach Paris verschlagen hatte. Er entstammte einer alteingesessenen Genfer Familie. Nach dem Tod des Vaters hatte sein ältester Bruder die Holzhandlung der Familie übernommen; der zweitälteste Bruder war Pastor in Saint-Pierre, der bedeutendsten Kirche in Genf. Er selbst war in den Franziskanerorden eingetreten, da ein Ordensmitglied mehr Freiheit hatte als der Priester einer Gemeinde. Als Minderbruder konnte er von einem Konvent zum anderen reisen, um hier und dort zu studieren und etwas von der Welt zu sehen. Die Franziskaner in Genf hatten Jacques auf seinen eigenen Wunsch hin nach Paris entsandt. Hier konnte er sich über die theologischen Dispute informieren, die Europa überschwemmten, nachdem der deutsche Theologieprofessor Martin Luther die Tür der alten römischen Kirche mit großer Wortgewalt eingetreten hatte. In einem der Franziskaner-Klöster in Paris hatte Jacques Unterkunft gefunden. Er besuchte Vorlesungen an den verschiedenen Fakultäten, las die neuesten Bücher, sprach mit den Kapiteln der bedeutendsten Kirchen und hörte sich um. „Meine Brüder in Genf haben mich als Spion nach Paris geschickt, so wie Josua einst Kundschafter nach Kanaan sandte.“
„Und? Gleicht Paris dem Gelobten Land?“, wollte ich wissen.
„Zweifellos! Paris ist eine Stadt, in der Versprechen nicht nur gegeben, sondern auch erfüllt werden. Besser noch: Wenn sich irgendwo in der Welt Neuerungen anbahnen, sind sie in Paris meist schon etabliert. Die Zeit vergeht nun einmal nicht überall gleich schnell.“
„Und was wirst du deinen Mitbrüdern in Genf über den heutigen Stand der Dinge in der Theologie berichten?“
Jacques kniff seine grauen Augen zu, sodass nur noch ein schwarzer Spalt zu sehen war. „Ich werde meinen Mitbrüdern sagen, dass die Zeiten im Begriff sind, sich unwiderruflich zu ändern. Der redegewandte Luther und viele andere Gelehrte und mutige Männer mit ihm, haben ein Tor aufgestoßen, das kein Mensch auf Erden wieder schließen kann, selbst der Bischof von Rom nicht.“
„Warum nicht?“
„Man kann einer Katze nicht das Bellen beibringen oder einem Hund das Miauen. So ist es auch nicht möglich, die alte römische Kirche dazu zu bringen, auf die ehrlichen Wünsche der Männer und Frauen aus dem einfachen Volk zu hören. Der tragische Fehler Luthers ist, dass er sich das nicht klargemacht hat.“
„Und folglich?“
„Folglich warten spannende Zeiten auf uns. Niemand wird sich diesen Spannungen entziehen können. Auch du nicht.“
„Wie meinst du das?“
„Das wirst du noch merken. Was ist, möchtest du noch einen Becher Wein?“
„Ja, gern.“
„Du siehst mich an, als hättest du noch nie von diesen Dingen gehört.“
„Einer meiner Kommilitonen, ein Flame, besucht heimlich die Vorlesungen von Professoren des Collège Royal. Er erzählte mir, einer dieser Gelehrten behaupte, die scholastische Theologie sei ein morsches Schiff und die Kirche müsse auf neuere Schiffe überwechseln, wenn sie nicht mit dem alten und brüchigen Kahn untergehen will.“
Jacques grinste: „Unverkennbar Professor Lefèvre, eine der klarsten und kühnsten Stimmen am Collège Royal. Er hat ohne Genehmigung eine französische Übersetzung des Neuen Testaments veröffentlicht und sich damit eine Verurteilung des Bischofs eingebrockt. Kurz nach Lefèvres Verurteilung hat der angesehene Erasmus einen Lehrstuhl am Collège Royal abgelehnt, aus Angst vor der Einschränkung seiner geistigen Freiheit.“ Jacques nahm einen Schluck Wein und sah mich nachdenklich an. „Wie stehst du eigentlich dazu, Henri? Du machst nicht den Eindruck, als würde dich das theologische Erdbeben, das überall um uns herum anschwillt, sehr beschäftigen.“
Ein wenig beschämt schüttelte ich den Kopf. „Wenn ich meine tägliche Portion an Studien verschlungen habe, unternehme ich in meiner Freizeit lieber Streifzüge durch das alte und neue Paris als Erkundungszüge durch die alte und neue Theologie.“
„Oder wagst du es nicht?“
„Wieso?“
„Hast du Angst vor deinen Lehrmeistern am Collège de Montaigu?“
Ich drehte den Weinbecher langsam in den Händen.
„Mein Schicksal liegt weitgehend in ihren Händen.“
„Ich verstehe“, nickte Jacques. „Aber durch deine Angst entgeht dir vieles.“
„Was denn?“
„Etwa die Erkenntnis, dass Theologie mehr ist als eine akademische Beschäftigung für Männer, die sich zu fein sind für weltliche Arbeit. Und dass es in der Theologie auch, nein, vor allem um Fragen gehen muss, die ganz gewöhnliche Minderbrüder wie mich oder einfache Schneidersöhne wie dich umtreiben.“
„Welche zum Beispiel?“
„Sollte die Kirche ein Spiegel der irdischen Königreiche mit ihren Ständen sein oder des Königreichs Gottes? Ist die alte Kirche das Eingangstor zum Evangelium, oder ist sie durch die vielen Missstände eher zu einem Hindernis geworden, das den Weg zum Evangelium versperrt? Oder: Wenn Gott durch die Bibel zu allen Menschen spricht, warum wird sie dann nicht in einer Sprache gelesen, die allen verständlich ist? Oder: Wenn Gott ein gnädiger Gott ist, weshalb ist die alte Kirche dann so versessen darauf, dass die Menschen sich ihr Heil selbst verdienen müssen?“
„Das reicht!“, unterbrach ich Jacques und warf einen Blick nach hinten, um zu sehen, ob uns jemand hören konnte.
„Lass uns ein Stück gehen“, schlug Jacques vor, „dann reden wir unter freiem Himmel weiter.“
Auf diesem Spaziergang – und auf den vielen weiteren gemeinsamen Gängen, die noch folgen sollten – erläuterte er mir, was er über den neuen Glauben wusste, was ihn daran faszinierte und was ihm missfiel. Auch wenn Jacques kein Doktor der Theologie war, so habe ich von keinem Professor so viel gelernt wie von ihm. Weil er mir nichts aufzwang. Und weil seine Lehrstunden nie zu lang waren. Wenn er merkte, dass ich ihm nicht mehr folgen konnte oder wollte, wechselte er einfach das Thema. Und meistens ging es bei diesen Gesprächen in irgendeiner Weise um Essen oder Wein. Jacques beschloss seine theologischen Vorträge selten mit einem energischen „Amen!“. Lieber endete er mit der Frage: „Was meinst du, sollen wir etwas essen gehen?“
„Für einen Anhänger des heiligen Franziskus, der sich für den Weg der Armut entschieden hat, führst du aber einen recht angenehmen Lebenswandel“, bemerkte ich, nachdem eine Ausführung über die Missstände in der alten Kirche wieder einmal übergangslos in den Vorschlag mündete, ein Wirtshaus aufzusuchen.
Jacques lachte und entblößte dabei die gelblichen, aber kräftigen Zähne. „Ich liebe die Armen, aber Armut ist nichts für mich. Außerdem halte ich es für eine grobe Sünde, die Köstlichkeiten, mit denen Gott die Schöpfung gesegnet hat, nicht in Dankbarkeit anzunehmen. Und heute will ich meine Dankbarkeit durch den Genuss einer Schüssel Eier zum Ausdruck bringen. Frische Eier, versteht sich. Ich weiß, wo es die gibt.“
Als wir kurze Zeit später die Eier pellten, kamen wir auf Genf zu sprechen. Jacques erzählte mir, dass Genf an einem großen See liege, dem Genfer See, umgeben von Bergen, deren Gipfel das ganze Jahr hindurch mit Schnee bedeckt seien. Und er sprach von seinem verstorbenen Vater, dem Holzhändler, und seinen Brüdern Claude und Louis.
„Dein ältester Bruder heißt Claude“, sagte ich. „Ich kannte in Rouen ein Mädchen, das Claudine hieß. Eine Freundin meiner Schwester.“
„Ein hübsches Mädchen?“, fragte Jacques.
„Sie war um einiges älter als ich.“
Jacques hob den Zeigefinger und bewegte ihn hin und her, wie ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt. „Du warst in sie verliebt. Ich sehe es dir an.“
„Gar nicht wahr“, lachte ich.
„Wieso errötest du dann?“
„Weil ich an jenen Abend denken muss, als ich in die Werkstatt meines Vaters kam und Claudine und meine Schwester sich gerade verkleideten.“
Jacques pfiff durch die Zähne. „Du hast sie gesehen!“
„Nicht alles.“
„Nun, was denn?“
„Ihren Oberkörper.“
„Ihren Busen?“
Ich nickte.
„Und?“
Ich hielt das Ei hoch, das ich gerade gepellt hatte. „Weiß, rund und fest.“
Mit einer Mischung aus Wonne und Qual in den Augen starrte Jacques auf das Ei in meinen Händen. „Ja, der Schöpfer hat einen Blick dafür. Und was dann? Hast du ihr den Hof gemacht?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Warum nicht?“
„Ich sagte doch, dass sie viel älter war.“
„Na und?“
„Lass uns über etwas anderes reden. Sie ist tot.“
„Durch Krankheit?“
„Durch das Feuer, den Scheiterhaufen.“
„Den Scheiterhaufen …“, wiederholte Jacques. Gerade wollte er in das gepellte Ei beißen, aber nun zögerte er. Ich bemerkte, dass seine Unerschütterlichkeit zum ersten Mal wankte. „Erzähl lieber nicht weiter“, sagte er. „Geschichten dieser Art mag ich nicht.“
Er legte das Ei wieder in die Schüssel zurück. Ich legte meines dazu. Sie waren zu weiß, zu rund und zu fest.
* * *
Der Sommer des Jahres 1532 war stickig heiß. Über den Straßen von Paris lag ein schwerer, betäubender Geruch von Fäulnis. In der ganzen Stadt litten die Menschen plötzlich an Durchfall und hohem Fieber. Nico Ghyssaerd erkrankte so schwer, dass wir ihn in den Krankensaal von Montaigu bringen mussten. Nach einigen Wochen kehrte er stark abgemagert in unseren Schlafsaal zurück.
„Womöglich war mein Krankenlager eine Warnung“, sagte er, als wir zum ersten Mal wieder Rücken an Rücken im Bett lagen. „Vielleicht hat der Herr mich mit Krankheit gestraft, weil ich mich mit der neuen Theologie befasse.“ Er kratzte sich unterm Arm; auch die Flöhe freuten sich, dass Nico wieder da war.
„Oder deine Gesundung ist ein Zeichen des Himmels, dass du den Weg des neuen Glaubens weitergehen musst“, entgegnete ich.
„Quid est veritas?“, murmelte Nico. Er stupste mich mit dem Ellbogen in die Seite, um mir eine gute Nacht zu wünschen. „Auf jeden Fall danke ich Gott, dass ich wieder in meinem eigenen Bett schlafen kann.“
An einem der kirchlichen Feiertage, an denen keine Vorlesungen stattfanden, beschlossen Jacques und ich, die kühlen Ufer der Seine aufzusuchen. Wir verließen die Stadt in östlicher Richtung und folgten dem Treidelpfad. Auf unserem Weg genossen wir nicht nur die frische Brise, sondern auch den Blick auf die Weingärten, die sich südlich erstreckten, und die vielen Windmühlen, in denen die Bauern ihr Getreide mahlen ließen. Wenn wir uns umwandten, konnten wir das große Benediktinerkloster auf dem Hügel des Montmartre sehen. In einem Weiler liehen wir uns ein Boot. Jacques erwies sich als guter Ruderer. „In Genf rudern wir an freien Tagen immer auf dem See, wenn es nicht zu kalt ist“, erzählte er.
„In Rouen bade ich mit meinen Freunden an freien Tagen immer in der Seine, bei jeder Temperatur“, sagte ich. Weil das Wasser unwiderstehlich lockte, aber auch, um zu zeigen, dass ich wirklich schwimmen konnte, entkleidete ich mich und sprang ohne zu zögern über Bord. Solange ich konnte, schwamm ich unter Wasser, vom Boot weg. Erst als meine protestierende Lunge es nicht mehr aushielt, tauchte ich wieder auf. Jacques ruderte inzwischen ans Ufer und legte bei einer Gruppe schattiger Platanen an. Träge ließ ich mich von der Strömung treiben, bis ich die Stelle erreichte, wo Jacques sich inzwischen im Schatten der Bäume niedergelassen hatte. Ich zog meine Hose wieder an und legte mich neben ihn.
Er spielte mit den ausgetrockneten Knochen eines Nagetiers: eines Kaninchens oder einer großen Ratte. „Ich habe eine Idee“, sagte er. „Wir beteiligen uns am Geschäft mit den Reliquien. Damit lässt sich viel Geld verdienen.“ Er hielt einen kurzen, geraden Knochen hoch. „Das ist der Finger, mit dem der Apostel Thomas die Wundmale Jesu berührt hat. Darum herum bauen wir eine Kirche und daneben ein Kloster mit reichlich Gästezimmern – und ein geruhsamer Lebensabend ist uns gewiss.“
„Du vergisst, dass Thomas’ Finger schon im Kloster Saint-Denis aufbewahrt wird, nicht weit von hier. Er ist vergoldet und mit einem kostbaren Ring geschmückt. Den Rest der Hand des Apostels haben sie dort übrigens auch. Das können wir nicht überbieten.“
„Ach, nichts leichter als das. Wir sagen einfach, unser Finger sei der echte. Wir lassen ein oder zwei Kranke kommen, die nach der Berührung des Fingers auf wundersame Weise mir nichts, dir nichts geheilt sind. Dann sollst du mal sehen, wie gut die Geschäfte gehen!“
„Geht Eure Spottlust heute wieder mit Euch durch, optime pater?“
„Unterschätze die heilsame und reinigende Wirkung des Spottes nicht, mein Sohn.“ Er kratzte sich am Schädel, den er seit Längerem nicht mehr rasiert hatte, wie die nachgewachsenen Stoppeln verrieten. „Wusstest du, dass im Kloster von Saint-Denis auch ein Zahn Johannes des Täufers gehütet wird, sowie ein Stück der Dornenkrone und ein paar Haare des Erlösers? Und nicht zu vergessen: die dreißig Silberlinge, die Judas für seinen Verrat erhielt. Unbegreiflich, dass die Menschen diesen Unsinn noch ernst nehmen.“
„Jeder halbwegs vernünftige Mensch weiß, dass dieser ganze Firlefanz auf Bauernfängerei beruht. Auf der anderen Seite sind Reliquien ein Heil für das einfache Volk; sie machen den Glauben konkret und sichtbar.“
„Welcher Scholastiker hat dir das nun wieder weisgemacht? Irgendwo am Pilgerweg nach Santiago de Compostela sitzt ein frommer Händler mit einem ledernen Eimer voller Milchzähne des Jesuskindes. Wenn du ihn fragst, wie es angehen kann – so viele Zähne eines Kindes? –, antwortet er, dass er es sich auch nicht erklären könne, aber jede Nacht würden sich die Zähne auf wundersame Weise vermehren.“
„Gut, wir schaffen diesen ganzen Rummel ab. Und dann?“
Jacques seufzte. „Das ist die Frage. Was wäre die Alternative?“
„Eine andere Möglichkeit wäre, dass vernünftige Leute wie du und ich möglichst viel Unkraut jäten, damit der Garten der alten Kirche einigermaßen vorzeigbar bleibt“, erwiderte ich.
Jacques kratzte sich erneut die Stoppeln der Tonsur. „Ich habe schon genug mit dem Unkraut auf meinem Kopf zu tun. Vom Ungeziefer einmal ganz zu schweigen.“
„Ich versuche nur, realistisch zu sein.“
„Ein Realist muss mitunter radikal sein, sonst ist er kein Realist“, entgegnete Jacques.
Ich richtete mich auf, nahm den trockenen Schädel des Nagetiers und warf ihn, so weit ich konnte, in den Fluss. „Du weißt genauso gut wie ich, dass die Kirche auf jede ernsthafte Reformbestrebung mit Kerker, Daumenschrauben, Zange, Strick oder mit dem Scheiterhaufen antwortet.“
„Wenn ein Haus zu sehr verfallen ist, gibt es nur eine Lösung: abreißen und neu aufbauen.“
Trotz der Hitze erschauerte ich. „Ist das die Botschaft, die du deinen Brüdern in Genf überbringst?“
„Wenn ich den Mut dazu habe.“
Als wir dann später mit dem Boot zum Weiler zurückruderten, fragte ich Jacques: „Ist es wahr, was man sich erzählt: dass Martin Luther das Mönchsgewand abgelegt und geheiratet hat?“
„Er hat inzwischen sogar schon ein halbes Dutzend Kinder mit seiner Frau gezeugt.“
Ich tauchte meine Hand ins Wasser und bewegte sie sanft hin und her. „Kannst du dir vorstellen …, dass du dein Keuschheitsgelübde brichst?“
„Das habe ich schon oft getan.“
„Wie meinst du das?“
Jacques rollte ein paarmal vergnügt mit den Augen. „Viele Male im Geiste, einige Male im Fleische.“
Ich wandte den Blick von ihm ab. Zwar wusste ich, dass der Kanoniker von Rouen und viele andere Geistliche Beziehungen zu Weibern unterhielten, aber aus irgendeinem Grund hatte ich es von Jacques nicht erwartet.
„Qui sine peccato est vestrum, primus lapidem mittat“, stimmte er einen gregorianischen Gesang an. „Was würdest du tun, wenn du jetzt Claudine begegnetest und sie dich genauso ansähe, wie du sie in der Werkstatt deines Vaters angesehen hast?“
Ich blickte in die Ferne, wo Paris in der sengenden Sonne lag. Wenn ich nun nicht mit Jacques, sondern mit Claudine eine Ruderpartie machte … Ja, was würde ich dann tun?
Dann sagte Jacques, und diesmal schwang nicht der leiseste Spott mit: „Wie die Reliquienverehrung sollten sie auch den Zölibat der Geistlichen abschaffen. Dann wären wir von dieser ganzen nutzlosen Scheinheiligkeit erlöst. Und glaube ja nicht, dass ich der Einzige bin, der so denkt! Ich werde dich bald einmal zu einer Gruppe Gleichgesinnter mitnehmen.“
Ich nahm Jacques die Riemen ab und ruderte weiter. Mitten auf dem Fluss stand ich plötzlich auf, sodass das Boot bedrohlich schaukelte, und schrie so laut ich konnte: „Es gelüstet mich nach zwei gekochten Eiern, mit einem schönen Weib daran!“
* * *
Das Konventikel fand in dem Haus einer Adelsfamilie statt, das rechts der Seine in einem der vornehmsten Pariser Viertel hinter der Kirche Saint-Jacques-de-la-Boucherie gelegen war. Den Namen der Familie kenne ich bis heute nicht. Man war in jener Zeit äußerst vorsichtig – und das mit gutem Grund. Wir betraten das Haus durch eine angelehnte Seitentür. Jacques kannte den Weg und ging voraus. Über einen Innenhof und durch einen Korridor gelangten wir zu einem großen, einfach ausgestatteten Raum. Drei Wände waren weiß gekalkt, die vierte Wand hatte eine Täfelung aus Eiche. Vor dieser Holzwand stand ein Tisch, auf dem eine weiße Decke lag. Darauf befanden sich eine Schale Brot, ein Becher und eine Bibel. In dem Raum waren etwa zwanzig Sitzplätze. Jacques und ich nahmen Platz auf einer Bank, die vor einer der gekalkten Wände stand. Zwei junge Männer, die etwas älter waren als ich, setzten sich zu uns. Der eine – mit glattem, rosigem Gesicht wie ein Säugling – war kostbar und elegant gekleidet. Er grüßte mich wohlwollend. Der andere hatte seine hagere Gestalt in einen einfachen, langen Mantel gehüllt. Sein abgezehrtes, spitzes Gesicht erinnerte mich an Vater und Sohn le Lieur aus Rouen. Durch den dünnen Spitzbart wirkte das Gesicht noch länger, als es ohnehin war. Auf den anderen Sitzgelegenheiten nahmen Leute verschiedensten Schlages Platz: adlige Männer und Frauen, Studenten, Handwerker und Frauen aus dem Volk. Jacques war unter den Anwesenden der Einzige, der als Kleriker zu erkennen war. Mir fiel auf, dass die Frauen in der Mehrzahl waren und dass untereinander kaum gesprochen wurde. Ein etwas älterer Herr stellte sich hinter den Tisch und eröffnete das Konventikel mit einem langen Gebet. Er hatte ein unbestimmtes Äußeres; ich kann mir sein Gesicht nicht mehr vergegenwärtigen. Wohl aber erinnere ich mich an seine Stimme und ihren warmen Klang. Auf Französisch las er aus dem Neuen Testament das Kapitel über die wundersame Speisung. Anschließend erläuterte er den Bibeltext kurz und übertrug die Geschichte auf die schwierigen und zugleich hoffnungsvollen Zeiten, in denen wir lebten. Der Ton seiner Homilie war warm und herzlich – einen Priester hatte ich nie so von der Kanzel predigen gehört. Nach einem weiteren Gebet forderte er uns zum Friedensgruß auf. Daraufhin erhoben sich alle und liefen ruhig durcheinander, um sich die Hand zu geben. Die adlige Dame, die einfache Frau, der Jüngling mit dem glatten, rosigen Gesicht und sein sehniger Kamerad – sie alle ließen mir nicht nur den Friedensgruß zukommen, sie sahen mich auch an. Ich meine: Sie sahen mir wirklich ins Gesicht und lächelten mich an, als wären wir enge Verwandte oder alte Bekannte. Auch Jacques’ ausgestreckte Hand wurde von einem Lächeln begleitet. Es war ein Lächeln, das ich noch nicht oft bei ihm gesehen hatte: Das Spöttische war völlig daraus gewichen. Erst als dann eine Schale mit kleinen Brotstücken herumgereicht wurde, begriff ich, was wir taten: Wir feierten die heilige Kommunion. Aber ohne Priester, ohne geweihte Hostie, ohne die festen eucharistischen Gebete, ja, selbst ohne Konsekration – es war die reinste Ketzerei! Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich niemals an dieser illegitimen Kommunionfeier teilgenommen; ich hätte es nicht gewollt und auch nicht gewagt. Als das Konventikel beendet war und wir den Ort der Zusammenkunft verlassen hatten, machte ich meiner Verwirrung Luft. „Weshalb hast du mir nicht gesagt, dass wir auf illegitime Weise die Eucharistie feiern?“
„Es war keine Eucharistiefeier – die wurde in der neuen Lehre abgeschafft. Wir haben das heilige Mahl gefeiert, und zwar genau so, wie Jesus es nach biblischer Erzählung mit seinen Jüngern tat.“
„Das hättest du mir vorher sagen müssen!“
„Wärst du mitgegangen, wenn ich es dir gesagt hätte?“
„Nein, natürlich nicht!“
„Siehst du? Deshalb habe ich den Mund gehalten.“
Schweigend gingen wir zurück ins Universitätsviertel. Auf dem Pont au Change, der auf beiden Seiten dicht an dicht mit Holzhäusern und Läden bebaut war, fragte Jacques mich, wie es mir denn gefallen habe.
„Ich bin noch nie irgendwo gewesen, wo alle gleich sind“, sagte ich.
„Du fängst an zu verstehen“, sagte Jacques.
Mitten auf der Brücke blieb ich unvermittelt stehen und legte die Hände auf Jacques’ Schultern. Es war meine Art, mich bei ihm zu bedanken: ohne Worte, nur mit einer Geste. Jacques hatte nicht nur mein persönliches Interesse für das Studium geweckt, mit dem ich mich nun schon jahrelang beschäftigte. Dank Jacques machte ich außerdem die Erfahrung, dass Religion, die ich bis dahin immer als hart und kalt empfunden hatte, auch herzlich und warm sein konnte.
* * *
In meinem letzten Jahr an der Universität widmete ich mich so viel wie möglich dem Studium des Griechischen und Hebräischen. Ich verkaufte die scholastischen Handbücher, die ich am wenigsten benutzte, und schaffte mir von dem Erlös eine griechische und eine hebräische Grammatik an. Und ich erwarb die von Erasmus veröffentlichte griechische Ausgabe des Neuen Testaments. Ich muss gestehen, dass mir die Finessen dieser Edition meist entgingen, aber die Beschäftigung mit ihr förderte zweifellos mein Wissen über das Evangelium. Endlich fing ich an, ernsthaft zu studieren – in den Augen meiner Lehrmeister allerdings nicht in den richtigen Büchern. Die Prüfung für das Lizenziat, die ich im Frühherbst des Jahres 1533 ablegte, war eine mühsame Angelegenheit. Einen ganzen Vormittag lang wurde ich dazu befragt, wodurch sich nach Auffassung der Kirchenväter die wahre Kirche auszeichnete. Bei der Beantwortung der Fragen, mit denen die Professoren mich überschütteten, nützten mir meine neu erworbenen Kenntnisse des Hebräischen und Griechischen wenig. Im Gegenteil – als ich durchblicken ließ, dass ich mich für die Quellsprachen der Heiligen Schrift interessierte, reagierten Professor Bédier und auch der alte schottische Scholastik-Professor Mair, der jeden Reformeifer erbittert bekämpfte, geradezu gereizt.
„Glaubt Ihr wirklich, Henri de la Mare, dass Ihr den Auslegungen der Heiligen Schrift, die uns die heiligen Kirchenväter und Lehrmeister der Kirche hinterlassen haben, etwas hinzuzufügen habt?“, fragte Mair unterkühlt. „Oder dass Ihr sie zu verbessern vermögt?“
„Wenn es Gott gefallen hat, seinen Geschöpfen die Heilige Schrift zu schenken, wird es Ihm auch gefallen, wenn seine Geschöpfe seine Worte immer wieder aufs Neue so lauter wie möglich lesen und überdenken“, erwiderte ich.
„Die Lesung der Heiligen Schrift ohne die bewährte Führung der Kirche ist wie eine Wanderung durch den Sumpf ohne einen zuverlässigen Führer.“
„Bei allem Respekt, optime pater, aber mir entgeht der Zusammenhang zwischen der Heiligen Schrift und einem Sumpf.“
Professor Mair warf seinem Kollegen Bédier neben ihm einen Blick zu und brummte: „Ich habe keine Fragen mehr.“
Trotzdem bestand ich die Prüfung: sine laude aber cum ermahnendem Hinweis, man sei voller Vertrauen, dass meine unter Beweis gestellten Kenntnisse der heiligen Gotteslehre ausreichten, um meine allzu persönlichen Auffassungen einzudämmen. Durch die angespannte Atmosphäre in der Prüfung wollte mir meine so sorgfältig vorbereitete Dankesrede nicht gelingen. Erleichtert ließ ich mir anschließend die dunkle Gelehrtenrobe von Professor Bédier über die Schultern streifen. Danach verlieh er mir das Recht, den Magistertitel zu führen. Ich konnte es nicht lassen, den Rest des Tages in meinem neuen Gewand durch das Studentenviertel zu stolzieren.
Einige Wochen später fand in der Kirche Saint-Mathurin, unweit des Collège de Montaigu, die Abschlusszeremonie statt, in der allen Graduierten dieses Semesters das Diplom überreicht wurde. Auch Jacques war da. Nach dem Festakt kam Professor Bédier auf uns zu. Er grüßte meinen Freund mit einer knappen Verbeugung und fragte mich nach meinen Plänen.
„Am liebsten würde ich nun erst das Doktorbarett erwerben.“
„Ist deine Familie vermögend?“
„Mein Vater ist Schneider. Wir sind weder arm noch reich.“
„Jungen Graduierten wie dir rate ich: Lass dich so schnell wie möglich zum Priester weihen, damit du dir eine Stelle als stellvertretender Pastor oder stellvertretender Kanoniker suchen kannst. Dann hast du ein Dach über dem Kopf und ein Einkommen.“
Ich verstand genau, was er meinte. Überall in der alten Kirche erwarben adlige oder wohlhabende Geistliche eine Pfarrei oder ein Kapitel und strichen die Abgaben der Gläubigen ein, während sie für die eigentliche Pfarrarbeit einen mittellosen Vikar anstellten. Für mich war diese zweifellos vernünftige Empfehlung von Professor Bédier wie ein Schlag ins Gesicht, und ich ballte die Fäuste in den weiten Ärmeln meiner Robe. „Ich danke Euch für Euren Rat, Professor, aber ich glaube nicht, dass ich ihn befolgen werde.“
Professor Bédier legte den Arm um meine Schulter, drehte sich mit dem Rücken zu Jacques und blickte mir tief in die Augen – dazu hatte er sich bisher noch nie herabgelassen. Im Flüsterton, damit Jacques ihn nicht hörte, sagte er: „Ich weiß, dass junge Burschen wie du empfänglich sind für die neuen Ideen, die momentan wie Schwalben durch die Lüfte schwirren. Lass dich nicht verführen von Leuten wie diesem Franziskaner, die meinen, sie wüssten es besser als die jahrhundertealte Kirche. Nimm dir ein Beispiel an Erasmus von Rotterdam und an dem alten Professor Lefèvre, die trotz ihrer neuen Ansichten an der alten Kirche und der sancta successio apostolorum festhalten, weil sie wissen, dass ein Bruch nur zu einer Katastrophe führen kann.“
Aus nächster Nähe sah ich dem Gelehrten in die wässrig blauen Augen und roch seinen üblen, säuerlichen Atem. Ich fragte mich, ob es mir irgendwie anzusehen war, dass ich im vergangenen Jahr regelmäßig die Konventikel hinter Saint-Jacques-de-la-Boucherie besucht hatte. Und ich entgegnete ihm: „Ich bin keine Schwalbe, die gedankenlos in alle Richtungen fliegt, Professor. Aber ich bin auch kein Esel, der sich damit begnügt, sein Leben lang im Kreis einer Tretmühle zu gehen.“
Professor Bédier bekreuzigte sich verärgert und ging weg, ohne etwas zu sagen.
„Hat er dich vor mir gewarnt?“, erriet Jacques.
„So könnte man es nennen. Kennst du ihn?“
„Ich weiß, wer er ist. Und er weiß sicherlich ganz genau, was ich hier in Paris mache. Leuten dieser Art entgeht fast nichts.“
„Er will, dass ich ein braver und gehorsamer Pfarrer werde.“
„Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden“, sagte Jacques. „Die Frage ist nur: in welcher Kirche?“
* * *
„Heute wird es spannend“, sagte Jacques, während er mich durch mehrere Gänge des Franziskanerklosters, in dem er untergebracht war, bis zur Kirche lotste. Es war Allerheiligen, der Tag, an dem der Rektor der Pariser Universität das neue akademische Jahr traditionell mit einer Rede eröffnete. Die Kirche der Franziskaner war bereits gefüllt mit einer gemischten Hörerschaft aus kirchlichen Würdenträgern, Professoren und Studenten. Für die ältesten und ranghöchsten Gäste hatte man eine Reihe Stühle aufgestellt, die übrigen Anwesenden versammelten sich stehend in einem weiten Kreis um die Kanzel. Jacques und ich suchten uns hinten zwischen den Studenten einen Stehplatz. Jacques hatte seine Tonsur ordentlich rasieren lassen. Ich winkte kurz Nico Ghyssaerd zu, der bei ein paar Kameraden aus unserem Schlafsaal stand.
„Der alte Herr dort ist Professor Lefèvre“, flüsterte Jacques, „und hinter ihm siehst du eine Gruppe von Männern, die der neuen Theologie anhängen, genau wie er. Aber die meisten von ihnen werden der alten Kirche wohl am Ende treu bleiben.“ Er zeigte auf eine andere Runde, in der die Professoren Bédier und Mair das große Wort führten. „Und da haben wir die Wachhunde der altkirchlichen Lehrgewalt. Alles, was nach Erneuerung oder Reformation riecht, muss sich auf ihre beißwütigen Mäuler gefasst machen. Übrigens, hast du gesehen, dass unsere Freunde vom Konventikel schräg hinter uns stehen?“
Als ich mich umdrehte, sah ich zwei junge Männer, die an einem Pfeiler standen. Ich hatte sie schon ein paarmal auf den geschlossenen Versammlungen im feudalen Haus hinter Saint-Jacques-de-la-Boucherie gesehen. Gesprochen hatte ich sie allerdings noch nicht.
„Der Vornehme heißt Michel Cop. Er ist der Sohn des königlichen Leibarztes. Und der jüngere Bruder von Nicolas, dem Rektor, der gleich die Jahresansprache halten wird. Sein nicht ganz so edler Freund hört auf den Namen Jean Calvin. Er stammt wie du aus dem Norden, aus Noyon. Er hat ebenfalls am Collège de Montaigu studiert.“
„Ich habe seinen Namen dort nie gehört.“
„Er hat Montaigu ohne Erlangung des Lizenziats verlassen. Danach studierte er dann irgendwo außerhalb von Paris Rechtswissenschaften. Nach Abschluss des Studiums kehrte er hierher zurück. Es heißt, sein Herz schlage noch immer für die Theologie. Und er soll eine wandelnde Bibliothek sein: Was er einmal gelesen hat, vergisst er nicht mehr. Sein Verstand scheint noch schärfer zu sein als seine Nase. Nun denn, Jean Calvin geht im Hause Cop ein und aus …“ Unter Jacques’ Nase, die alles andere als scharf war, bildete sich ein Lächeln. „… Und aus diesem Grund erwarten etliche Leute mit Spannung die Rede von Nicolas Cop. Manch einer vermutet, dass Jean Calvin dem Rektor beim Verfassen der Rede unter die Arme gegriffen hat. Vermutlich hören wir gleich eine professorale Rede, die direkt oder indirekt aus der Feder unseres Freundes aus Noyon geflossen ist. Sollte das tatsächlich der Fall sein, erwartet uns etwas ganz Besonderes.“
Die großen Eingangstüren der Kirche öffneten sich, die Gespräche verstummten. Der Rektor betrat den Kirchenraum, ihm voran schritten die Pedelle der Universität. Professor Nicolas Cop trug einen schwarzen Talar und ein Birett. Über seinen Schultern hing eine goldbestickte Stola als Symbol seiner Amtswürde. Er war von breiter, kräftiger Statur, aber bei Weitem nicht so beleibt wie sein Bruder Michel. Er bestieg die Kanzel und hob ohne Umschweife an zu reden. Er begann seine Ansprache mit einer der Seligpreisungen aus dem Evangelium: Selig sind, die da geistig arm sind. Als er dann etwa eine Stunde später von der Kanzel herabstieg und die Kirche in Begleitung der Pedelle verließ, gelang es kaum einem der ehrwürdigen und gelehrten Zuhörer, seine Fassungslosigkeit zu verbergen. Lediglich die fromme Anrufung der Heiligen Jungfrau am Anfang der Rede hatte keinen Anstoß erregt – alles, was Nicolas Cop dann folgen ließ, war unleugbar ein äußerst unfrommes Urteil über die Kirchenlehre. Es war ein klares und schnörkelloses Plädoyer kontra Geschwätz der scholastischen Sophisten und pro reinigender Kraft der neuen evangelischen Lehre. Im Verlauf des Vortrags schaute ich immer wieder nach hinten, um das Gesicht von Jean Calvin zu sehen. Aber seine Miene verriet nichts. Während Professor Cop es wagte, die etablierte Theologie als Ketzerei zu bezeichnen und – umgekehrt – das, was als Ketzerei galt, zum wahren Glauben zu erklären, kämmte Jean Calvin unbeirrt seinen flachsartigen Bart mit der Hand. Nur einmal meinte ich, ein zustimmendes Nicken zu sehen. Hörte er da einen Satz von seiner Hand?
„Was habe ich dir gesagt?“, grinste Jacques, als der Tumult in der Kirche anschwoll. „Hatte ich dir etwas Besonderes versprochen oder nicht? Professor Cop hat soeben den Hals in die Schlinge der Kirche gesteckt.“
In diesem Moment stand mir nicht der Sinn nach den spöttischen Witzeleien meines Freundes. Deshalb ließ ich ihn stehen und lief durch die Kirche, auf der Suche nach Michel Cop und Jean Calvin. Ich wollte sehen, wie sie auf die entstandene Verwirrung reagierten, welche Haltung sie einnahmen, wie sie dreinblickten. Im Vorbeigehen fing ich entrüstete und wütende Gesprächsfetzen der heftig debattierenden Professoren und Prälaten auf: Nicolas Cop sei ein Judas, ein Abgesandter der Bestie aus dem Abgrund, der Teufel höchstpersönlich … Professor Bédier beugte sich zu seinem sitzenden Kollegen Lefèvre vor und redete beschwörend auf ihn ein. Der alte Lefèvre hörte ihm kopfschüttelnd zu und machte beschwichtigende Handbewegungen. Einige Franziskanermönche liefen mit erhitzten Gesichtern umher und riefen lauthals, es sei eine Schande, dass die lutherische Irrlehre im Herzen der Pariser Universität verkündigt worden war. Ich ging weiter umher – aber Michel Cop und Jean Calvin waren nirgends zu sehen. Sie hatten die Kirche bereits verlassen.
Inzwischen hatte Jacques mich wiedergefunden. Er ging mit mir nach draußen und nahm mich mit ins Wirtshaus Le Mouton, wo wir bis spätabends über all das redeten, was an diesem Tag in der Kirche der Franziskaner geschehen war.
* * *
Wenige Tage später erhielt Professor Cop die Aufforderung, vor dem höchsten Pariser Gericht, dem Parlement, zu erscheinen; einige Franziskaner hatten den Rektor angezeigt. In vollem akademischem Ornat begab er sich zu der Sitzung. Kurz bevor er jedoch das Gerichtsgebäude erreichte, kam ein Unbekannter auf ihn zu und warnte ihn, dass er von der Inquisition verhaftet werden würde. Professor Cop überlegte nicht lange, verschwand in einer Seitenstraße und konnte noch am selben Tag unbemerkt aus der Stadt fliehen. Das Gericht war außer sich und ersuchte König Franz, der sich in Lyon aufhielt, um weitere Weisungen. Die ergingen postwendend und ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Die verfluchte lutherische Sekte, die sich wie die Pest über das ganze Königreich auszubreiten drohe, solle ausgerottet werden. Gegen diese Ketzer müsse man rücksichtslos vorgehen. Auf den Kopf des geflohenen Rektors wurde ein Preis von dreihundert Silberfranken ausgesetzt.
Jacques suchte mich im Collège de Montaigu auf, um mich über die jüngsten Entwicklungen zu unterrichten. „Nicolas Cop hat bewiesen, dass er ein mutiger Mann ist“, beschloss er seinen Bericht. Er blickte sich im Schlafsaal um, wo wir auf meinem Bett saßen. „Es stinkt hier zum Himmel. Wie lange willst du noch in hoc inferno bleiben?“
„Ich habe noch für ein paar Monate bezahlt. Sobald ich eine Entscheidung hinsichtlich meiner Zukunft getroffen habe, gehe ich.“
„Ich reise in wenigen Tagen ab. Mir reicht es hier in Paris. Zudem haben meine Brüder mir kürzlich mitgeteilt, dass sich in Genf sowohl politisch als auch kirchlich viel bewegt. Kurzum: Es ist Zeit zurückzukehren.“
Jacques griff sich einen Apfel vom Tisch und warf damit nach ein paar Mäusen, die an den verschlissenen Stiefeln eines meiner Kommilitonen knabberten. Der Apfel verfehlte die Nager und zerbarst an der Wand. „Warum kommst du nicht mit mir mit?“, fragte Jacques.
Das Angebot meines Freundes erstaunte mich, aber die Verwunderung wich schon bald einem kribbelnden Gefühl der Aufregung. Mit Jacques nach Genf zu gehen, das bedeutete ein doppeltes Abenteuer. Und aus dem Doktorbarett in Paris würde ohnehin nichts werden.
„Und was soll ich in Genf machen?“, wollte ich wissen.
„Vorläufig stelle ich dich als meinen Sekretär ein; du kannst in unserem Kloster wohnen. Wenn du möchtest, kann ich dir bei der Suche nach einer Pfarrei helfen, in der du dich nicht einkaufen musst. In der Genfer Gegend wimmelt es von Dörfern, und ich kenne dort genug Leute.“
„Wie steht es in Genf mit der Kirche und dem neuen Glauben?“
„Meine Mitbrüder schreiben mir – recht verzweifelt, übrigens –, dass die neue Lehre in der Stadt schnell an Boden gewinnt.“
„Und was bedeutet das für meine Chancen, eine Pfarrei zu finden?“
„Damit hast du gute Aussichten, eine evangelische Pfarrgemeinde zu finden.“
„Und was ist, wenn Genf den neuen Glauben tatsächlich annimmt? Was wird dann aus deinem Kloster?“
„Das verschwindet, und ich werde mich nach einer evangelischen Kirchengemeinde umsehen, in Genf oder der näheren Umgebung. Vielleicht werden wir sogar Nachbarn!“
„Aber wäre es nicht schlimm für dich, wenn dein Kloster einginge?“
Jacques kratzte sich ausgiebig den Schädel. „Die römische Kirche, zu der mein Orden gehört, ist eine alte, kranke Mutter, aber ich liebe sie immer noch. Und die reformatorische Lehre ist ein neugeborenes Kind, das mich rührt. Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden. Manchmal kann man nichts anderes tun als abzuwarten, bis einem die Entscheidung abgenommen wird. Ich kann verstehen, wenn du noch etwas Zeit brauchst, um über mein Angebot nachzudenken.“
Aber ich nahm seine Einladung auf der Stelle an. „Ich komme mit. Gern, sehr gern. Aufs Geratewohl! Unter einer Bedingung: Ich möchte erst meine Eltern und meine Brüder in Rouen besuchen. Würdest du mich dorthin begleiten? Wir könnten per Schiff reisen, auf der Seine.“
„Du darfst dich in Rouen doch nicht mehr blicken lassen.“
„Ach, das ist lange her … Ich habe mich in den letzten Jahren oft gefragt, ob meine Verbannung wirklich offiziell ist. Der ganze Prozess mit diesem Kanoniker und dem Grafen … War das überhaupt ein richtiger Prozess, oder war es schlicht und einfach ein Fall von Machtmissbrauch und Einschüchterung? Ich könnte diesen Jean Calvin fragen, er ist doch Jurist, nicht wahr? Aber wenn er klug ist, hat er Paris schon längst verlassen. Wie auch immer – für ein Wiedersehen mit meiner Familie bin ich gewillt, einiges zu riskieren.“
Jacques puffte mich kräftig gegen die Schulter. „Du weißt, es ist ein lang gehegter Wunsch von mir, deine Familie kennenzulernen.“
* * *
Am Morgen meiner Abreise aus Paris klopfte ich an die Tür von Professor Bédier. Als ich das Zimmer betrat, saß der Gelehrte an seinem Schreibtisch und las in einem aufgeschlagenen Folianten. Ein schwerer, säuerlicher Geruch erfüllte den Raum.
„Ich möchte gern beichten.“
„Komm ein andermal wieder, ich habe jetzt keine Zeit“, murmelte Bédier.
„Ein Priester darf einer Seele in Not das Sakrament der Beichte nicht verweigern.“
Mit einem Seufzer schob Bédier den Folianten von sich weg. „Nun gut, dann komm.“
Ein letztes Mal ging ich durch die Flure des Collège de Montaigu. Im knarrenden Beichtstuhl der kleinen dunklen Kapelle des Collège nahmen wir einander gegenüber Platz: Er saß, ich kniete.
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti“, begann Bédier. „Sag mir, was dein Herz bedrückt, de la Mare.“
Es war zu dunkel im Beichtstuhl, um durch das Holzgitter zu sehen, das mich von Bédier trennte. Ich schloss die Augen und sprach: „Ich … wie soll ich sagen … ich verspüre … einen starken Wunsch, optime pater.“
„Welchen Wunsch?“
„Vor vielen Jahren, lange bevor ich nach Paris ging, um hier zu studieren, habe ich vor meinem Vater einen Eid abgelegt. Ich habe ihm geschworen so zu leben, dass ich niemanden Anlass dazu gebe, mich zu demütigen. Als Student habe ich den Schwur schon einmal bekräftigt, aber nicht vor Zeugen. Nun, am Ende meines Studiums, ist es mein Wunsch, diesen Eid erneut abzulegen. Und ich möchte, dass Ihr, optime pater, mein Zeuge seid. Hört also gut zu. Ich schwöre noch einmal, dass ich mich nie wieder erniedrigen lasse: nicht von Edlen, nicht von den Mächtigen, den Reichen, den Unverschämten und auch nicht von den Dienern der alten Kirche.“
„Das ist keine Beichte, de la Mare. Das ist eine Provokation!“
„Ich sehne mich nach einem Leben, in dem ich meines Benehmens, meiner Eigenschaften und auch meiner Frömmigkeit wegen geschätzt werde, und nicht aufgrund der Reichtümer meines Vater oder weil ich mich darauf verstehe, gewissen Personen nach dem Munde zu reden. Ich wünsche mir …“
„Schweig, de la Mare!“
An jenem letzten Tag im Collège ließ ich mir den Mund nicht mehr verbieten, und so fuhr ich fort: „Ich wünsche mir eine Welt, in der alle Menschen gleich sind. Ich wünsche mir eine Kirche, die nicht mehr von der Macht der Herkunft oder des Geldes regiert wird, sondern von der Liebe und der Gerechtigkeit Christi.“
Professor Bédier hämmerte wütend an das Gitter. „Anstatt mich um Absolution für deine Sünden zu bitten, wirfst du mir die infamsten Unverschämtheiten und Ketzereien an den Kopf!“
„Dies ist mein starker Wunsch, den ich Euch beichten wollte, optime pater.“
„Ist dir klar, dass du mit deinem Leben spielst?“, schrie Bédier.
„Ihr beabsichtigt doch nicht etwa, das Beichtgeheimnis zu brechen?“
Das plötzliche Gepolter auf der anderen Seite des Gitters verriet mir, dass Bédier Anstalten machte, den engen Beichtstuhl zu verlassen. Aber ich war schneller als der schwerfällige Theologe. Ich sprang aus dem Beichtstuhl, verließ die Kapelle mit großen Schritten und rannte dann schnell durch die Flure von Montaigu nach draußen auf die Gasse, wo Jacques wie vereinbart mit dem Gepäck auf mich wartete.
* * *
Jacques’ Kutte und mein akademisches Gewand sorgten dafür, dass wir auf dem Segelkahn, der uns nach Rouen bringen sollte, die besten Plätze erhielten. Schon bald kamen wir mit einigen Mitreisenden ins Gespräch. Neben mir saßen eine Frau und ihre Tochter, ein Mädchen von etwa fünfzehn oder sechzehn Jahren. Sie hatte dunkle Haare, die sie unter einer gehäkelten Haube zusammenhielt, und auffallend helle, braune Augen. Ihre Mutter erzählte mir, dass ihr aus Paris gebürtiger Mann vor Kurzem verstorben sei und sie beschlossen habe, in ihre Heimatstadt Rouen zurückzukehren. Als sich herausstellte, dass wir gemeinsame Bekannte hatten, wurde die Unterhaltung immer angeregter. Nach dem ersten Halt, einige Stunden hinter Paris, setzte ihre Tochter sich zu mir. Maria, so war ihr Name, löcherte mich mit Fragen über mein Studium und meine Zukunftspläne.
„Werdet Ihr Priester in Genf?“
„Das auf keinen Fall.“
„Warum nicht?“
„Weil die Kirche in Genf im Moment unruhige Zeiten erlebt.“
„Was macht Ihr dann im fernen Genf?“
„Ich weiß es noch nicht genau.“
Maria hielt ihren Blick fragend auf mich gerichtet. Es schien, als wären ihre Augen mit einer klaren, funkelnden Flüssigkeit gefüllt. „Weshalb bleibt Ihr nicht in Rouen? Dort könnt Ihr doch Priester werden?“
Ich wandte den Blick von ihr ab und sah zum Ufer der Seine mit gemächlich grasenden Rindern. Meine Beichte bei Professor Bédier hatte mein Bedürfnis nach Offenheit vorerst befriedigt. Aber selbst wenn ich sie nicht anschaute, sah ich die durchscheinenden Augen des Mädchens deutlich vor mir. „Du stellst aber viele Fragen! Stehst du womöglich in Diensten der Inquisition?“
Sie erschrak über meine Reaktion. „Entschuldigt, wenn ich unverschämt zu Euch war – das war nicht meine Absicht …“
„Das war nur ein Scherz“, sagte ich schnell. „Ich bin es nicht gewohnt, dass ein Mädchen mir so energisch auf den Zahn fühlt.“
„Als angehender Geistlicher sprecht Ihr natürlich nicht oft mit Frauen.“
„Doch, doch. Die Hälfte der Menschheit besteht nun einmal aus Frauen.“
„Aber Ihr konzentriert Euch lieber auf wichtigere Dinge, geistliche Dinge.“
Ich musste über ihre Worte lachen. „Ein gewöhnliches Gespräch, wie wir es jetzt führen, kann auch sehr wichtig sein.“
Sie runzelte die Stirn. „Wie meint Ihr das?“
„Ein gutes Gespräch bringt meistens mehr als die Lektüre eines Buches, und sei es noch so umfangreich und gelehrt.“
„Und was bringt unser Gespräch?“
Ich sah sie an, zwang mich, die Augen nicht mehr niederzuschlagen. Kein Maler, nicht einmal der begnadetste seiner Zunft, würde es je vermögen, das Geheimnis dieser durchscheinenden Augen in Farbe einzufangen. „Gedanken, die ich nie zuvor hatte. Gefühle, die ich nicht gleich in Worte zu fassen vermag …“
„Ihr treibt Euren Spott mit mir.“
„Aber nein, ganz im Gegenteil! Es ist mein völliger Ernst.“
Maria fühlte, ob ihre Haube noch gut saß. „Wenn Ihr so ernsthaft seid, dann sprecht doch von einem der Bücher, mit dem Ihr Euch jüngst beschäftigt habt.“
„Wenn du es gern möchtest.“ Ich überlegte kurz und sagte dann: „Ich werde dir etwas über das wichtigste Buch erzählen, das es gibt, wenngleich nur wenige darin lesen. Ich meine die Bibel. Ich selbst habe erst am Ende meines Studiums dazu gefunden, mich eingehender mit ihr zu befassen. Eigentlich ist die Bibel eine Bibliothek aus mehreren Büchern, wusstest du das?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Ich will dir von einem der Bücher der Bibel erzählen, dem Buch Ester. Ester war eine ebenso schöne wie kluge junge Frau. Sie hatte gewisse Ähnlichkeit mit dir. Hör nur …“
Am dritten und letzten Abend unserer Reise machten Maria und ich vor dem Schlafengehen einen Spaziergang am Ufer der Seine. Auf einmal brachte sie die Rede wieder auf Genf.
„Ihr habt mir noch immer nicht erklärt, weshalb Ihr die lange und gefährliche Reise nach Genf machen wollt.“
Ich drehte mich zu ihr um und wünschte, ich hätte den Mut, ihre Hände zu nehmen und sie langsam an mich zu ziehen. „Ich werde dir die Wahrheit sagen: Ich hoffe sehr wohl, Geistlicher in Genf zu werden. Aber nicht in der alten Kirche.“
„Dann seid Ihr ein Anhänger der Reformatoren“, sagte sie ohne zu überlegen.
„Demnach weißt du von der Reformbewegung … Ich habe mich absichtlich bedeckt gehalten, denn aus Sicht der alten Kirche bin ich ein Ketzer, und Ketzer müssen nun einmal vorsichtig sein.“
„So etwas habe ich schon vermutet“, sagte Maria leise. Wir gingen weiter. „In Paris wurde oft über die Reformatoren gesprochen, aber ich habe noch nie mit einem von ihnen gesprochen.“
„Dann bin ich der Erste. Interessiert dich das Thema? Möchtest du, dass ich dir etwas darüber erzähle?“
„Ja, gern.“
Daraufhin schilderte ich Maria meine Gründe, mich auf die Seite der Reformatoren zu schlagen. Ich sprach von den vielen Missständen in der alten römischen Kirche und von dem Wunsch, die alte, verschmutzte Kirche zu säubern. Sie hörte mir zu und stellte hin und wieder eine kluge Frage. Unser Spaziergang wurde viel ausgedehnter als geplant. Zum Schluss erklärte ich ihr auch, warum die meisten Reformatoren den Zölibat ablehnten.
„Habt Ihr vor, zu heiraten?“, wollte sie wissen.
„Das weiß ich noch nicht. Ich habe mich erst vor Kurzem für die Reformation entschieden – und ich war schon so lange auf ein Leben im Zölibat eingestellt, dass der Gedanke an eine Ehe für mich noch ganz ungewohnt ist. Aber wenn ich mir ein Mädchen wie dich anschaue … Nun, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, irgendwann zu heiraten.“
Sie warf mir einen kurzen, verständnislosen Blick zu. „Das ist alles sehr neu für mich. Aber ich werde über Eure Worte nachdenken, denn sie klingen sehr vernünftig.“
„Folge dem Rat des heiligen Paulus: Prüfe alles und behalte das Gute“, sagte ich.
Ja, tu es doch, herrschte ich mich innerlich an. Erforsche sie, nimm ihre Hand, liebkose ihr Gesicht und schau, was geschieht, wenn du dich anschickst, sie zu küssen! Aber anstatt Paulus’ guten Rat zu befolgen, sagte ich nur: „Lass uns zum Schiff zurückkehren, es wird schon dunkel.“
Jeden Abend spannten der Schiffer und sein Schiffsjunge ein großes braunes Segel über den umgelegten Giekbaum. Auf den Deckplanken unter dem Segeltuch lagen die Passagiere unter ihren Mänteln oder mitgebrachten Decken und wärmten sich gegenseitig. Meinen festen Schlafplatz neben Jacques hatte an diesem letzten Abend schon jemand anders eingenommen. Der einzige freie Platz war der neben Maria und ihrer Mutter. Als ich mitten in der Nacht erwachte, merkte ich, dass Maria im Schlaf dicht an mich herangerückt war. Ich spürte ihren ruhigen Atem im Nacken. Nachdem alle Versuche, wieder einzuschlafen, fehlgeschlagen waren, drehte ich mich vorsichtig um. Nun spürte ich ihren Atem in meinem Gesicht. Ich küsste sie, obwohl ich gar nicht wusste, ob sie überhaupt wach war. Erst waren ihre Lippen trocken, aber schon bald wurden sie weich und saftig wie eine reife Frucht. Durch den Mantel hindurch fühlte sich ihr Körper zart und zugleich fest an. Ich verspürte am ganzen Körper ein Prickeln, so, als wäre ich in der Gluthitze eines Sommertages in die kühlen Fluten eines Flusses gesprungen.
Am nächsten Morgen setzte Maria sich nicht neben mich, und sie wich meinem Blick aus. Als wir in Rouen von Bord gingen, sah ich zu, dass ich direkt hinter ihr stand, damit ich ihr mit der Reisetasche behilflich sein konnte.
„Lass es dir gut gehen, Maria.“
Zum ersten Mal an diesem Tag sah sie mich an. Auf ihren Lippen lag ein Lächeln, aber in ihren durchscheinenden braunen Augen hatte sie Tränen.
„Ich werde es nie vergessen“, sagte ich.
„Wirst du es nicht vergessen oder mich nicht?“
„Ich werde dich nie vergessen.“
„Ich dich auch nicht … Ich wünsche dir viel Glück in Genf, Herr Reformator.“
Ich bedeutete ihr, nicht so laut zu reden. Dann reichte ich ihr die Tasche und sagte noch einmal: „Lass es dir gut gehen, Maria.“
Ohne noch etwas zu sagen, nahm sie ihre Tasche entgegen, drehte sich um und ging zu ihrer wartenden Mutter. Ich unterdrückte den Drang, ihr nachzulaufen. Denn was hätte ich ihr noch sagen können, was hätte ich tun können?
Nur wenige Fuß entfernt stand Jacques und beobachtete den Abschied mit einem spöttischen Lächeln. „Freust du dich, wieder in Rouen zu sein, Henri?“ Als ich nichts erwiderte, fuhr er fort: „Keine Sorge. In Genf wohnen auch Mädchen mit schönen Augen und sanften Lippen.“
„Halt doch den Mund, du Ochse!“, herrschte ich ihn an.
* * *
Meine Mutter konnte die Finger gar nicht von mir und meiner akademischen Robe lassen; unaufhörlich strich sie mit ihren harten Händen über meinen Samtkragen. Meine Brüder François und Pierre überragten mich inzwischen; sie arbeiteten beide in der väterlichen Werkstatt. Mein Vater erkundigte sich bei Jacques, welche Kleidung man in Genf trug, und beauftragte seine Gesellen mit der Anfertigung einer entsprechenden Garderobe für seinen gelehrten Sohn. Ich erfuhr, dass der Kanoniker le Lieur noch immer dem Kapitel vorstand. Seinen Bastard hatte er zum Studium der Rechtswissenschaften nach Orléans geschickt. „Dann wartet auf Pierre eine glänzende Karriere als Inquisitor“, dachte ich sofort. Dass meinen ehemaligen Busenfreund Gaspard die Schwindsucht dahingerafft hatte, war mir schon in Paris zu Ohren gekommen. So war er denn doch noch unter der Grabplatte in der Kathedrale von Rouen mit seiner schönen, frommen, reichen und früh verstorbenen Mutter vereinigt worden. Als ich dann allerdings hörte, dass sich Gaspards Vater, Graf de Jumelles, nach dem Tod seines Sohnes den Anhängern des neuen Glaubens angeschlossen hatte, war ich bass erstaunt. Ganz Rouen wusste, dass er in seinem Schloss evangelische Konventikel abhielt.
Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest nahm mein Vater mich zur Seite. Er sagte mir, dass ich durch die finanzielle Unterstützung im Laufe meines gut sechsjährigen Studiums meinen ganzen Erbteil inzwischen erhalten habe. Da er mich aber nicht mit leeren Händen gehen lassen wollte, bot er mir an, ein gutes Pferd für mich zu kaufen, um mir die lange Reise nach Genf zu erleichtern. Dort angekommen, könne ich es wieder verkaufen und von dem Erlös einstweilen meinen Lebensunterhalt bestreiten, bis ich eine feste Einnahmequelle gefunden habe. Ich dankte meinem Vater mit einer stillen Umarmung. Wie ich wusste, hatte Jacques ebenfalls die Absicht, sich ein Pferd anzuschaffen, und so stand einer glücklichen Reise nichts mehr im Weg.
„Ich möchte Euch noch etwas sagen, Vater. Bislang habe ich dieses Thema vermieden, aber …“
„Du hast dich für die neue Lehre entschieden.“
„Ich … Woher wisst Ihr das?“
„Deine Mutter und ich merken es an allem, Henri. Daran, dass du missbilligend über das Collège und deine Professoren sprichst. Daran, dass du die Heilige Messe nicht besuchst, das Kreuz nicht mehr schlägst und hartnäckig über deine Priesterweihe schweigst.“
Es dauerte einen Moment, bevor ich weitersprechen konnte. „Ich hoffe, Ihr habt Verständnis für meinen Entschluss …“
„Nun, deine Mutter findet es entsetzlich, dass ihr gelehrter Sohn sich von der alten Kirche abwendet. Was mich angeht: Wenn ich jung wäre und in deiner Haut steckte, würde ich der alten Kirche wohl auch den Rücken kehren.“ Mein Vater sprach bedächtig, als hätte er lange über dieses Thema nachgedacht. „Aber ich will deiner Mutter keinen Kummer bereiten und deine Brüder nicht in Gefahr bringen.“
„Wenn ich Mutter und Euch doch nur nach Genf mitnehmen könnte“, sagte ich. Mein Vater lächelte. „Deine Mutter und ich können uns nicht mehr vorstellen, woanders als in Rouen zu leben. Aber du bist an nichts und niemanden gebunden, dir steht die ganze Welt offen!“ Er legte seine kräftige Schneiderhand auf meine Schulter. „Möge es dir gut gehen, Henri, wo immer du dich niederlässt, was auch immer du machst.“
Nach Weihnachten kauften Jacques und ich zwei Stuten, die noch nicht gar so alt waren. Da wir beide nicht viel Erfahrung mit Pferden hatten, baten wir einen Bauern, der jahrelang in den Ställen von Graf de Jumelles gearbeitet hatte, uns innerhalb einiger Wochen mit der Pflege der Pferde und der Reitkunst vertraut zu machen. Ich schlug vor, das Ende des Winters in Rouen abzuwarten, aber Jacques hatte es immer eiliger. „In Genf kündigen sich wichtige Ereignisse an, da möchte ich dabei sein.“ Ende Januar im Jahr 1534, als die schlimmste Kälte vorüber war, bepackten wir unsere Pferde. Der Abschied von meiner Familie war herzlich. Alle wünschten uns eine gesegnete Zukunft in Genf. Meine Mutter drückte mich als Letzte und sagte, sie liebe mich und werde jeden Tag für mich beten.