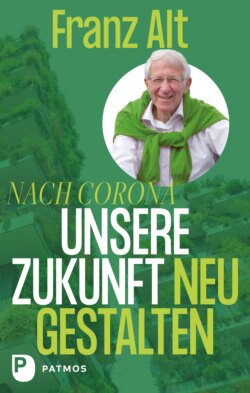Читать книгу Nach Corona – Unsere Zukunft neu gestalten - Franz Alt - Страница 3
Оглавление
Was die Zukunft betrifft, so ist unsere Aufgabe nicht,
sie vorauszusehen, sondern sie zu ermöglichen.
Antoine de Saint-Exupéry
I. Neu Denken
1. Katastrophen sind Lernhelferinnen
Vor einigen Jahren war ich in Taiwan auf einer Vortragsreise zur chinesischen Ausgabe meines Buches »Die Sonne schickt uns keine Rechnung«. Dabei war ich zu einer Geburtstagsfeier des großen chinesischen Philosophen Konfuzius eingeladen, und ich lernte, dass Konfuzius vor 2500 Jahren drei Wege nannte, auf denen wir Menschen klug handeln können:
Erstens: durch Nachdenken, dies sei der edelste.
Zweitens: durch Nachahmen, dies sei der leichteste,
und drittens: durch Erfahrung, dies sei der bitterste.
Wir Heutigen werden wohl erst durch Katastrophen, also durch schlechte Erfahrungen, klug. Wir brauchen offensichtlich Katastrophen als Lernhelferinnen. Erst nach zwei Weltkriegen sind wir Europäer klug geworden und haben in der Europäischen Union zur Zusammenarbeit gefunden. Oder: Der deutsche Atomausstieg 2011 war erst möglich nach Fukushima, obwohl die Gefahr eines großen Unfalls schon lange zuvor bekannt war. Was heißt das für die heute wohl größten Krisen der Menschheit, für die Klimaerhitzung, das große Massensterben oder für die Gefahr eines Atomkriegs, an dem wir bisher nur durch Glück vorbeigeschrammt sind?
Es gibt auch Menschen, die sich damit trösten, dass an den Knöpfen für die Atomraketen nicht Verrückte und Ruchlose sitzen, sondern nur weise und erfahrene alte Männer, die genau wissen, dass sie ihre Waffen nur dazu verwenden dürfen, Kriege zu verhindern. Hoffentlich sind das auch immer durch und durch logisch denkende Menschen.
Ob aber allein deren Logik uns retten wird? Schon mehrmals wäre es mit dieser Logik beinahe schiefgegangen. Wie oft wollen wir nur noch Glück haben? Mehr Glück als Verstand? Ist dieses Denken und Handeln wirklich logisch?
UNO-Berechnungen sagen für den Fall, dass wir einfach so weitermachen wie heute, für das Ende des 21. Jahrhunderts folgende Szenarien voraus:
Erstens: Wir müssen mit einer globalen Erwärmung von bis zu fünf Grad rechnen – gemessen an der vorindustriellen Zeit. Die Klimaziele des Pariser Abkommens, zu dem sich alle Regierungen der Welt verpflichtet haben, werden damit grandios verfehlt.
Zweitens: Unsere Nachkommen werden einen Verlust der Tropenwälder bis zu 80 Prozent erleben.
Drittens: Die Wüstengebiete werden sich um bis zu 23 Prozent ausbreiten.
Viertens: Die Zahl der Klimaflüchtlinge wird auf circa 280 Millionen steigen.
Fünftens: Die Hitzewellen werden sich in Europa mindestens vervierfachen.
Sechstens: Die Corona-Pandemie ist nur ein weiterer Aspekt der größeren ökologischen Krise und kann weitere Pandemien zur Folge haben.
Und das alles, wenn wir nicht schon vorher in einem atomaren Inferno den Untergang unserer Zivilisation organisieren.
Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass eine ganze Zivilisation verschwindet. Das Mauerwerk der »Verbotenen Stadt« in Peking, die himmelhohen Säulen des »Forum Romanum« in Rom, die gigantischen Steinskulpturen auf den Osterinseln oder auch die majestätischen Kuppeln des Taj Mahal in Agra stehen heute wie stumme Zeugen einst blühender Kulturen und Zivilisationen, bestaunt von Touristen.
Historisch gehören Umweltveränderungen und Erschöpfung von Ressourcen nach den Erkenntnissen der »Kollapsologen« – so nennen sich die Untergangsforscher – zu den wichtigsten Ursachen des Untergangs. Auf den Osterinseln lief der Untergang ungefähr so ab: Die Wälder wurden abgeholzt, weil Holz gebraucht wurde zum Bau von Kanus und zum Transport der vielen Steinskulpturen. Als die letzten Wälder gerodet waren, erodierten die Böden und die Moai hatten sich ihrer Lebensgrundlage beraubt. Erinnert Sie diese Entwicklung nicht an unsere heutige Situation, liebe Leserin und lieber Leser? Eine Gesellschaft geht dann unter – so die Übereinstimmung der »Kollapsologen« –, wenn sie keine Antwort auf notwendige Veränderungen findet. Was hat wohl jener Bewohner der Osterinsel gedacht, der den letzten Baum fällte? Wahrscheinlich so viel wie heute ein SUV-Fahrer – nichts.
Was wir vor allem brauchen? Lust auf Zukunft. Mit Angst und Gleichgültigkeit schaffen wir die Wende nicht. Aber vor allem benötigen wir den Dreiklang aus neuem Denken, neuem Fühlen und vor allem neuem Handeln.
Die größten Gefahren des 20. Jahrhunderts waren Männer in Kriegslaune, Faschismus und Kommunismus, dreckige Industrien und gefährliche Technologien. Und jetzt? Ist es die Fledermaus, oder sind es wir Menschen, die dem Tier keinen Raum mehr lassen?
2021 ermittelte eine Studie des Entwicklungsprogramms der UNO (UNDP), dass sich zwei Drittel der Menschheit für mehr Klimaschutz ausspricht. Mehr als 1,2 Millionen Menschen in 50 Ländern nahmen an dieser Umfrage teil.
In acht von den zehn Ländern mit den höchsten Emissionen aus dem Energiesektor trat der Großteil für mehr erneuerbare Energien ein. In vier von den fünf Ländern mit den höchsten Emissionen aus Landnutzungsänderungen gab es eine überwiegende Unterstützung für die Erhaltung von Wäldern und Land. In neun von den zehn Ländern mit der am stärksten verstädterten Bevölkerung traten die Studienteilnehmer für einen stärkeren Einsatz von Elektroautos, Bussen oder Fahrrädern ein. UNDP-Chef Achim Steiner sagt dazu: »Diese Zustimmung reicht über Nationalitäten, Alter, Geschlecht, Herkunft und Bildungsgrad hinweg. Die Umfrage zeigt auch, wie sich die Menschen von den Entscheidungsträgern eine Veränderung wünschen. Damit haben die Menschen im Umgang mit dem Klimawandel auch eine Stimme.«
Die Zeiger der symbolischen Weltuntergangsuhr, der sogenannten Doomsday-Clock, stehen laut Wissenschaftlern im Jahr 2021 auf 100 Sekunden vor zwölf. Die Gefahr, dass sich die Menschheit durch die Klimaerhitzung, das massenhafte Artensterben oder durch einen Atomkrieg selbst auslöscht, ist demnach so groß wie noch nie seit Erfindung der Uhr im Jahr 1947.
Schon 2005 hat die UNO den Report »Millennium Ecosystem Assessment« veröffentlicht. Über 1000 Wissenschaftler haben fünf Jahre lang zu allen Bereichen der Nachhaltigkeit auf dem Globus geforscht. Ergebnis: Alle wesentlichen Entwicklungen verliefen in die falsche Richtung, das weitere Wachstum der Weltbevölkerung, die steigenden Treibhausgasemissionen, der Verbrauch von Ressourcen und Energie, der Zustand der Ozeane sowie die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich. Ist diese Fahrt in den Abgrund noch zu stoppen?
»Wenn wir die Geschichte der Erde mit einem Kalenderjahr vergleichen, dann haben wir ein Drittel der natürlichen Ressourcen in den letzten 0,2 Sekunden aufgebraucht, und jetzt schlägt die Natur zurück«, sagt UNO-Generalsekretär Guterres.
Die Covid-19-Pandemie könnte uns eine Warnung sein. Sie ist die Stunde der Wahrheit, die uns auf die Folgen der Klimaerhitzung, des globalen Waldsterbens und der industrialisierten Landwirtschaft aufmerksam macht. Zugleich kann die Corona-Krise ein Anreiz für eine große, schon lange fällige Transformation sein. Restauration oder Transformation? Was wollen wir?
Eine Krise ist vor allem keine Zeit, um die Nerven zu verlieren. Und erst recht keine Zeit für Verschwörungstheorien. Das politisch scheinbar Unmögliche kann jetzt das politisch Unausweichliche werden. Die Geschichte muss sich nicht wiederholen – wir können ja auch daraus lernen. Tun wir das? Wollen wir das? Schaffen wir das? Dies sind die Fragen aller Fragen.
Im Angesicht der Corona-Pandemie hat Papst Franziskus seine dritte Enzyklika »Fratelli Tutti – Über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft« veröffentlicht. Er fordert darin nichts anderes als eine neue Gesellschaftsordnung, die die Menschen und ihre unveräußerliche Würde in den Mittelpunkt allen politischen und wirtschaftlichen Handelns stellt. Wir seien »eine weltweite Gemeinschaft in einem Boot, wo das Übel eines Insassen allen zum Schaden gereicht«. Die Pandemie zwinge die Menschheit dazu, wieder an alle Menschen zu denken statt an den Nutzen einiger. Der Papst erinnert an das biblische Gleichnis vom barmherzigen Samariter und fordert, dass Nächstenliebe zum Prinzip der Politik werden müsse. Franziskus kritisiert Nationalismus, Abschottung und die »soziale Aggressivität, die im Internet Raum findet … Gottes Liebe gilt für jeden Menschen gleich, unabhängig von seiner Religion.«
Diese Enzyklika ist ein Weckruf und ein Hoffnungsruf für eine Neugestaltung der Zukunft. Der Papst verweist auch auf den »Irrglauben« des Neoliberalismus, dass es den Armen immer besser gehe, wenn die Reichen immer reicher würden. Das politische Grundgesetz für die Weltwirtschaft müsse heißen: Jede ökonomische Theorie und jedes ökonomische Handeln unterliege der »politischen Liebe«. Ist Papst Franziskus ein Fantast?
Seine ganz realistische Antwort: »Die Zerbrechlichkeit der weltweiten Systeme angesichts der Pandemie hat gezeigt, dass nicht alles durch den freien Markt gelöst werden kann und dass – über die Rehabilitierung einer gesunden Politik hinaus, die nicht dem Diktat der Finanzwelt unterworfen ist – wir die Menschenwürde wieder in den Mittelpunkt stellen müssen. Auf diesem Grundpfeiler müssen die sozialen Alternativen erbaut sein, die wir brauchen.«
Die Alternativen, welche der Papst meint: Flüchtlingsretter, die Klimaaktivist*innen um Greta Thunberg, die friedlichen Bürgerrechtler um Swetlana Tichanowskaja in Weißrussland oder um Alexej Nawalny in Russland sowie die weltweite Friedensbewegung, die für eine atomwaffenfreie Welt kämpft, und alle Streiter für Gerechtigkeit. Er nennt sie »soziale Poeten«, die kreativ eine ganzheitliche menschliche Entwicklung vorantreiben. Sie sind die Vorkämpfer für die Neugestaltung unserer Zukunft.
Und ihre Arbeit ist das neue Grundgesetz für eine bessere Welt.
Norbert Blüm sagte es so: »Solidarität ist kein Luxus, sondern Existenzbedingung menschlichen Lebens.«