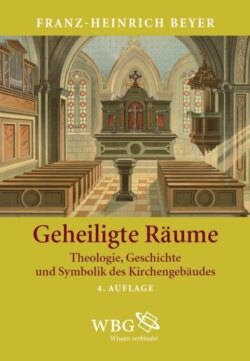Читать книгу Geheiligte Räume - Franz-Heinrich Beyer - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Kirchengebäude und Atmosphären
ОглавлениеDie Lateranbasilika ist das früheste Beispiel eines Sakralbaus, dessen Bedeutung und Wirkung allein in der repräsentativen Darstellung der christlichen Religion im öffentlichen Raum zu sehen ist, gleichsam als Ausdrucksgestalt. Das Kirchengebäude als Ausdrucksgestalt anzusehen, ermöglicht, es zuerst und allein als Ergebnis ästhetischer Arbeit zu betrachten. Ästhetische Arbeit besteht darin, Dingen und Umgebungen solche Eigenschaften zu geben, die von ihnen etwas ausgehen lassen. Die Rede von der Atmosphäre, die Kirchengebäude ausstrahlen oder die Kirchenräume haben, legt sich hier nahe.
Der Phänomenologe G. Böhme betont – in Anknüpfung an H. Schmitz – die Abhängigkeit der Atmosphären sowohl von den Dingen, die sie produzieren (Umgebungsqualitäten), als auch von dem anwesenden Menschen, seiner Selbstwahrnehmung (Befindlichkeiten). „Atmosphäre ist die gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen. Sie ist die Wirklichkeit des Wahrgenommenen als Sphäre seiner Anwesenheit und die Wirklichkeit des Wahrnehmenden, insofern er, die Atmosphäre spürend, in bestimmter Weise leiblich anwesend ist.“28 Es geht um das spannungsvolle Verhältnis etwa eines Kirchenraums und seiner Atmosphären und der eigenen, körperlichen Anwesenheit darin. „Für das Spüren der Erhabenheit – hier des kirchlichen Raums – ist gerade der Kontrast notwendig, nämlich, daß es zugleich das Spüren der eigenen Anwesenheit im Raum, nämlich der verlorenen, gewissermaßen haltlosen Anwesenheit im übergroßen Raum ist.“29 Böhme macht darauf aufmerksam, dass es „der profane Gebrauch ‚ist‘, der es heute nötig macht, aber der es auch ermöglicht, von der Atmosphäre kirchlicher Räume zu sprechen“30.
Dass Kirchengebäude bzw. Kirchenräume anwesenden Menschen mannigfache Atmosphären wahrnehmbar werden lassen, kann durch Beobachtung belegt werden. Diese Atmosphären gründen nicht in einer gesonderten religiösen „Heiligkeit“ des Gebäudes bzw. des Raums; sie sind keine Eigenschaft des Bauwerks. Trotzdem kann davon gesprochen werden, dass bestimmte Raumgestalten andere Anmutungsqualitäten als andere entwickeln. Böhme weist auf romanische und gotische Kirchen hin, in denen Stein und Raum in eine besondere Beziehung treten.31 Atmosphären werden durch die Anmutungsqualität architekturaler Formen erzeugt, z.B. Bewegungssuggestionen, Licht und Dämmerung, akustische Qualitäten, Farben u.a.m. Durch die Zusammenarbeit, die Persönlichkeiten der Kirche im Verlauf der Kirchengeschichte mit „ästhetischen Arbeitern“, also mit Architekten und Künstlern, pflegten, haben diese selbst zur Herausbildung solcher Atmosphären beigetragen. Die Wirkung solcher Atmosphären lässt sich aber weder dogmatisch kanalisieren noch auf den Bereich des Gottesdienstes beschränken. Die affektive Betroffenheit von etwas, was den Menschen von außen her anmutet, diese Betroffenheit kann von Menschen mit und ohne religiöse Bindung gleichermaßen empfunden oder auch gleichermaßen nicht zugelassen werden. Folgt man den von G. Böhme vorgetragenen Überlegungen, so ist es jedoch notwendig, „dass dem kirchlichen Raum seine Abgeschlossenheit gegenüber dem weltlichen Betrieb bleibt: er wird als ein besonderer Ort benutzt und erfahren“.32
Zwei Konsequenzen ergeben sich aus einer solchen Beschreibung des Kirchengebäudes als Ausdrucksgestalt: Zum einen ist die optimale Zugänglichkeit zu ermöglichen: die Öffnung der Kirchengebäude für Besucher. Zum anderen geht es um die genaue Prüfung von Nutzungsmöglichkeiten; Veranstaltungen, die dem Charakter des Raums als Ausdrucksgestalt entgegenwirken würden, wären sehr kritisch zu prüfen.
Die Beschreibung des Kirchengebäudes als Ausdrucksgestalt trägt sowohl der Anerkennung des ästhetischen Bedürfnisses als eines Grundbedürfnisses des Menschen Rechnung wie auch der Erkenntnis, dass Sich-Zeigen, Aus-sich-Heraustreten ein Grundzug jedes Phänomens ist, also auch der christlichen Religion.