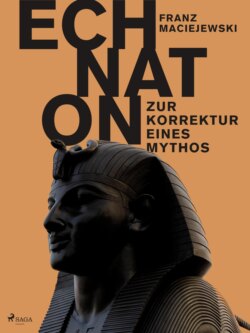Читать книгу Echnaton oder Die Erfindung des Monotheismus: Zur Korrektur eines Mythos - Franz Maciejewski - Страница 5
Einleitung Out of Amarna
ОглавлениеTell el-Amarna oder kurz Amarna – dieser karge, auf halbem Wege zwischen Kairo und Theben am Ostufer des Nil gelegene Streifen Land – gilt heute als eine der berühmtesten Stätten des Altertums. Der Name ist ein Artefakt. Einigen arabischen Dörfern der Gegend abgewonnen, bezeichnet er für uns eine der spektakulärsten Epochen des Alten Ägypten gegen Mitte des 14. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Amarna, das ist die aus dem Boden gestampfte Neue Hauptstadt des geheimnisumwitterten Pharaos Amenophis IV.-Echnaton, die (wenngleich nur für kurze Zeit) zum schillernden Zentrum der damaligen Welt aufstieg, um ebenso jäh wieder unterzugehen. Amarna, so heißt der Geburtsort des nicht minder legendären Kindkönigs Tutanchamun sowie der Standort jener Bildhauerwerkstatt, in der die »bunte Büste« der Nofretete modelliert wurde. Die klangvollen Namen aus dem Sonnengeschlecht von Amarna evozieren auf unwiderstehliche Weise den Dreiklang von Geistigkeit, Reichtum und Schönheit: die prophetische Stimme eines frühen Gottkünders, das blendende Gold eines unermesslichen Grabschatzes, die strahlende Gestalt eines zeitlosen Eros – also genau jenen Stoff, aus dem sich Mythen bilden. Aber es ist ohne Zweifel Echnaton, der die Aura des Ortes bestimmt, nicht Nofret, die (noch weithin unverstandene) Schöne an seiner Seite, nicht die sich gut verkaufende Pop-Ikone Tut, dessen wieder und wieder zur Schau gestellte Schätze verlorenen Perlen ähneln, denen die Kette kulturellen Sinns abhanden gekommen ist. Die dem sogenannten »Ketzerkönig« zugeschriebene Tat, die erste monotheistische Religion der Weltgeschichte gestiftet zu haben, ist der Grund, warum die Amarna-Zeit heute zu den Sternstunden der Menschheit gezählt wird. Zumindest in der westlich dominierten Welt, die den Monotheismus als eine kulturelle Errungenschaft ersten Ranges begreift, ist Amarna zu einem besonders erinnerungswürdigen Weltkulturerbe avanciert. Die Stadt steht für den Großen Anfang. Echnaton führt die Reihe der Religionsstifter an, in der Moses, Jesus und Mohammed ihm nachfolgen.
Diese Einschätzung galt nicht von Anbeginn. Ganz im Gegenteil. Die ersten Ägyptologen unter den Entdeckern sahen in Echnaton keinen heiligen Mann, der eine neue Weltformel gefunden hatte, sondern eher einen merkwürdigen Freak, der – durch die Launen der Thronfolge an die Macht gelangt – einem obskuren Sonnenkult huldigte und das Land politisch an den Rand der Katastrophe führte. Die lapidare Beschreibung von Champollion, der auf seiner ersten und einzigen Ägyptenreise (1828) auch die Ruinen von Amarna sah, lässt Art und Ausmaß der Geringschätzung deutlich erkennen. »Le Roi très gras, gros, ventru. Formes féminines (...) grande morbidezza«. Ein missgestaltiger König war aus dem Dunkel der Geschichte ins Relief getreten, so rätselhaft wie abstoßend, dessen Erscheinung Champollion peinlich berührte und seine Kollegen und Nachfolger wahlweise an einen Eunuchen oder Transvestiten denken ließ. Ein Fremdkörper in der Ahnengalerie der großen Thutmosiden. Dieser erste Eindruck verdankte sich der Wirkung der Bildwerke, etwa den Abbildungen auf den zahlreichen Grenzstelen Echnatons, welche den heiligen Bezirk der neuen Residenz Achetaton (»Horizont des Aton«) markierten. Mehr als hundert Jahre zuvor (1714) war der französische Jesuitenpater Claude Sicard bei Tuna-el-Gebel als erster Europäer auf eine der äußersten, rive gauche gelegenen Stelen des antiken Amarna gestoßen.
Abb. 2: Die Grenzstele von Tuna-el-Gebel
Er meinte ein hoch in die Wand eingelassenes Felsenheiligtum vor sich zu haben, dessen dargestellte Szene er als Opferritual von Sonnenpriestern deutete. Ironischerweise hatte auch Champollion einen eher flüchtigen Blick auf dieses Bildnis (das inzwischen mehrfach kopiert worden war) geworfen, während er doch in Wahrheit auf der Suche nach Sprachdenkmälern war, um seine bahnbrechende Entzifferung der Hieroglyphen überprüfen und abschließen zu können. Erst auf der Grundlage dieser Arbeiten öffnete sich nach und nach das Fenster der Textinterpretation, und tatsächlich war es die Veröffentlichung der jetzt zugänglichen Inschriften der Amarna-Zeit, die eine Wende in der Beurteilung dieses so ungewöhnlichen Pharaos einleitete.
Der Umschlag vollzog sich mit der Übersetzung aufgefundener Hymnen. Der grundlegende Text war der sogenannte Große Sonnenhymnus, der sich in einem der Beamtengräber von Amarna erhalten hatte und die westlichen Intellektuellen sofort nach seiner Publizierung in Erstaunen, ja Verzückung versetzte. Den Anfang machte der junge amerikanische Ägyptologe James Henry Breasted (1895). Er deutete diesen Text als Ausdruck eines monotheistischen Gottesverständnisses reinster Prägung und damit als (Wieder-)Entdeckung eines überraschenden Vorläufers des biblischen Monotheismus. Dem König, den er für den »gottberauschten Schöpfer« des Hymnus an Aton, die alleinverehrte Sonnenscheibe, hielt, attestierte er eine unzeitgemäße, aber folgenreiche Modernität: »Unter den Hebräern, sieben- oder achthundert Jahre später, sind uns solche Männer nicht weiter auffällig; diesen Mann aber, der in einer so fernen Zeit und unter so widrigen Bedingungen der erste Idealist und die erste Persönlichkeit in der Weltgeschichte wurde, muss die moderne Welt erst noch seinem Werte entsprechend würdigen.« Im Aton-Glauben Echnatons mit seiner Absage an Mythos und Vielgötterei nahm, so Breasted, die Idee einer rationalen Weltreligion zum ersten Mal Gestalt an.
Breasteds Interpretation vom »revolutionären Monotheismus Echnatons« schlug ungeheuer nachhaltig in die geistige Landschaft der Jahrhundertwende ein. Ein Vorgang, wie er in der Wissenschaftsgeschichte nicht eben selten ist. Eine große Idee erobert plötzlich alle Aufmerksamkeit und steht so hoch im Kurs, dass alle wachen und aktiven Köpfe (zunehmend auch aus den Nachbardisziplinen) sich mit ihr beschäftigen und das neue Paradigma durch Zusatzhypothesen bekräftigen. Der begriffliche Mittelpunkt (hier: »Erster Monotheismus«) wächst sich so schnell zu einer attraktiven Sprachregelung aus, die durch häufiges Zitieren zirkuliert und fortlaufend bestätigt wird, während kritische Töne es schwer haben, noch Gehör zu finden. Breasted hat seine frühe Deutung in seinem vielgelesenen Buch History of Egypt (1906) noch mit eigener Hand ergänzt und verfeinert. Jetzt galt ihm der Große Hymnus nicht nur als ein solitärer »Sonnengesang des Echnaton«, sondern als größtes Überbleibsel »eines auf Papyrus niedergeschriebenen offiziellen Katechismus seiner Lehren« (den die Gegner des Königs natürlich zerstört hatten). Damit rückte der neue Monotheismus unversehens in die Nähe einer Buchreligion. Die Bühne war bereitet für die Aufführung des Fortsetzungsstücks »Gott kam aus Ägypten«, der Prospekt ausgerollt für die Darbietung der wildesten Spekulationen über die offenen und geheimen Verbindungen zwischen dem ägyptischen Ur-Monotheismus und seinen jüdischen und christlichen Nachfolgern.
Breasted ist bei der offensichtlichen Überbewertung von Text und Schriftgedächtnis nicht stehen geblieben; auf sehr einfache Weise hat er den Wert des älteren Bildgedächtnisses herabgesetzt, indem er »die seltsame Behandlung der unteren Körperteile des Königs durch die Künstler« – also jene Darstellung eines dickbäuchigen Mannes mit geschwollenen Gliedmaßen und femininen Zügen, die den befremdlichen Eindruck nervöser Dekadenz und sexueller Anomalie hervorgerufen hatte – zu einem unlösbaren Problem erklärte. Wie können wir je wissen, wie es wirklich war? Das Geheimnis von Missbildung und Krankheit, von Leiblichkeit und Sexualität (einschließlich der offenen Frage nach Abstammung und Verwandtschaft innerhalb der königlichen Familie) wurde durch dieses Diktum versiegelt. Mit dem entschiedenen Blickwechsel auf die obere Körperhälfte des Königs, d.h. vor allem auf das Schrift gewordene Wort Echnatons, gelang Breasted das Kunststück, den überdrehten Freak der frühen Jahre der Ägyptologie in eine Lichtgestalt zu verwandeln. Vom Makel »der ungesunden Symptome« befreit, wechselte die Imago des Königs von der abstoßenden in die anziehende Sphäre des Außerordentlichen.
Es war dem britischen Ägyptologen Arthur Weigall vorbehalten, diese neue Erinnerungsspur zu erweitern und zu popularisieren. In The Life and Time of Akhnaton (1910), dem ersten biographischen Versuch über Echnaton, folgt er Breasted in der Auffassung, dass der Große Hymnus als eine Art von global prayer die erste monotheistische Religionsstiftung bezeuge, die nicht ohne Einfluss auf den biblischen Monotheismus geblieben ist. Doch Weigall bringt den Aton-Glauben und die Bibel in eine noch weit engere Verbindung, als dies Breasted getan hat. Passagenweise zieht er verblüffende Parallelen zwischen dem »wunderbaren Hymnus« und Psalm 104, wobei er keinen Zweifel aufkommen lässt, was als Original und was als Nachdichtung zu gelten hat. Es ist, als hätte der von Aton beseelte Echnaton mit seinen Strahlenhänden über die Jahrhunderte hinweg die Hände der Schreiber der Bibel berührt – und auch und vor allem auf den Seiten des Neuen Testaments seine Spuren hinterlassen. Weigall ist nämlich überzeugt, »dass in der Religion des Echnaton ein viel engerer Zusammenhang mit den Lehren von Christus besteht als in der von Abraham, Isaak und Jakob«. Das ist eine bemerkenswerte Einlassung. Verdankt sich Breasteds bahnbrechende Entdeckung noch dem Déjà-vu des Hebraisten (der er auch war), dem die wohlvertrauten Töne des Alten Testaments plötzlich wie ein Echo aus der kühlen Gruft der ägyptischen Vorzeit nachhallen, so sieht Weigall in der Lehre Echnatons das Urbild der christlichen Botschaft. In den Gleichnisreden Jesu, aber auch im Sonnengesang eines Franz von Assisi entdeckt er Wahlverwandtschaften zum Geist von Amarna, welche die Parallelen zum hebräischen Psalm weit übertreffen. Aton nennt er einen »Herrn der Liebe«, Echnaton, der in der Sonnenscheibe seinen göttlichen Vater anruft, eine frühe Christusfigur.
Die Wirkung, die Weigalls Buch auf seine Zeitgenossen und die nachfolgende Generation ausgeübt hat, lässt sich kaum überschätzen. Mit der Stilisierung des Aton als eines »allliebenden Wesens« nach christlicher Provenienz vollzieht Weigall eine überraschende Vergegenwärtigung des alten Glaubens, der für ihn nicht abgelebt ist: »Aton ist Gott beinahe so, wie wir ihn auffassen.« Der Gott der Liebe und Echnaton, sein Prophet, bewegen sich nicht länger (nur) in den Kulissen des Einst, sie sind vielmehr von brennender Aktualität. Weigall sprengt die monotheistische Epoche des Alten Ägypten endgültig aus dem Kontinuum der Zeit heraus und macht Amarna im Benjaminschen Sinne zu einer mit »Jetztzeit« aufgeladenen Vergangenheit. Breasted hatte den Ketzerkönig als »erste Persönlichkeit der Weltgeschichte« bezeichnet, Weigall nennt ihn ergänzend und weiterführend »unseren Bruder, ja fast unseren Zeitgenossen«. Die Ununterscheidbarkeit von Vergangenheit und Gegenwart, die sich in diesen Worten ausspricht, erhellt die besondere Attraktivität der Forschungen über Amarna. Diese verdankt sich nicht allein der Wiederkehr des Vertrauten. Erforscht wird alles Mögliche, aber zum Faszinosum wird nur, was auf die eine oder andere Weise gebraucht wird. Es spricht vieles dafür, dass die Brauchbarkeit Echnatons für eine Rolle im Hier und Jetzt (sagen wir probeweise: in der sich zuspitzenden Krise des Abendlandes am Vorabend der Katastrophe des Ersten Weltkrieges) mitverantwortlich war dafür, dass die Berichte über seine kulturelle Revolution so schnell zum Allgemeinbesitz der intellektuellen Elite geworden sind. Die Amarnafunde hatten ohne Zweifel einen Nerv der Zeit getroffen. Sie brachten das Gewünschte. »Echnatons Monotheismus« fühlte sich an wie eine Zeltplane in den Zeiten einer zunehmenden transzendentalen Obdachlosigkeit – und war zugleich eine intellektuelle Herausforderung. Mit dieser Idee konnte man arbeiten, weiterdenken, Lücken füllen.
Einer der Intellektuellen, die sich von der Geschichte anstecken ließen und bereit waren, den Faden weiterzuspinnen, war kein Geringerer als Thomas Mann. Beginnend im Jahre 1926, vor dem Frregungshintergrund einer regelrechten Ägyptomanie – 1912 wurde die Büste der Nofretete gefunden, 1922 war das Große Jubeljahr der Entdeckung des Grabes Tutanchamuns, 1925/26 gelang in Karnak der Fund der ungewöhnlichen Kolosse Echnatons –, begab sich Mann in die Brunnentiefe der Zeit, um den Mythos des biblischen Joseph neu zu beleben. Als ein Meister kultureller Bricolage wob er in die fiktionale Welt der nachfolgenden Josephsromane mit großer Kennerschaft die Sachwelt des ausgegrabenen Ägypten, darunter die Welt von Amarna. »Den Sonnenmonotheismus des Echnaton mit dem hebräischen Monotheismus in Beziehung setzen zu können«, wurde zu einem der leitenden Motive von Manns Arbeit an Gedächtnis und Geschichte. Und nach und nach entwickelte sich daraus die Lieblingsidee, Josef den Ägypter als Zeitgenossen Echnatons auftreten zu lassen. Mit dem feinen Gespür für das Besondere der Konfrontation eines Mannes der Geschichte mit der Figur eines Mythos lässt der ägyptologisch beratene Dichter1 die beiden am Hofe des Pharao zusammentreffen. Als Traumdeuter gerufen, erfährt Joseph die Einweisung in die Lehre Echnatons und zieht diesen seinerseits in ein Gespräch über den Gott Abrahams. Mann imaginiert keinen Disput über die Religion, eher ein schweifendes Zwiegespräch über die letzten Dinge, in dem beide Kontrahenten eine gute Figur machen – Brüder im Geiste. Wenn er dennoch einen Vorbehalt gegen Echnaton äußert, dann nicht wegen der gefallenen Worte, sondern des Fleisches wegen, das sie aussprach. Anders als etwa beim leibesschwachen Rilke, den Echnatons »hinblühend, mildvergängliches Gesicht« zu hochfahrenden Versen inspiriert hat, bleibt Manns physiognomischer Blick nüchtern. »Bei der Beschreibung seines Gesichts«, so lesen wir bei ihm, »dürfen die Jahrtausende uns nicht von dem zutreffenden Gleichnis abschrecken, dass es aussah wie das eines jungen vornehmen Engländers von etwas ausgeblühtem Geschlecht; langgezogen, hochmütig und müde (...) mit tief träumerisch verhängten Augen, von denen er die Lider nie ganz aufzuheben vermochte, und deren Mattigkeit in bestürzendem Gegensatz stand zu der nicht etwa aufgeschminkten, sondern von Natur krankhaft blühenden Röte der sehr vollen Lippen. So war eine Mischung schmerzlich verwickelter Geistigkeit und Sinnlichkeit in diesem Gesicht.« Nach dieser Sichtweise war Echnaton wohl »auf dem rechten Weg, aber der Rechte nicht für den Weg«. Die romanhafte Anverwandlung des ägyptologischen Themas eines solaren Monotheismus endet unversehens bei der Abneigung des ersten Blicks, den wir bei Champollion kennengelernt haben. Dem hinfälligen Körper des Abkömmlings einer dekadenten Dynastie hat Thomas Mann den Fortschritt in der Geistigkeit nicht wirklich abgenommen.
Wenn Mann den Verfall des Hauses der Thutmosiden als morbide Spätkultur versteht, dann überträgt er auf diese Epoche die Erfahrung seiner Zeit: den unaufhaltsamen Untergang des europäischen Bürgertums, den er in Werken wie Buddenbrooks oder Der Zauberberg so meisterlich nachgezeichnet hat. Aber anders als Weigall holt er die Epochenfigur Echnaton nicht hinüber in die Jetztzeit. Für ihn ist der König kein salvator mundi. Im Kampf gegen das heraufziehende Unheil des Nationalsozialismus beschwört Mann den jüdisch-christlichen Humanismus, an dem Echnaton seiner Einschätzung nach keinen Anteil hat. Deshalb bleibt auch das »verwickelte Verhältnis von Geistigkeit und Sinnlichkeit«, das er so treffend diagnostiziert, unanalysiert.
Einer, der wie kein anderer über alle analytischen Mittel verfügte, gerade diesen Knoten zu lösen, war Sigmund Freud. Spätestens mit der 1912 erschienen Studie von Karl Abraham über Amenophis IV. (Echnaton) war das Thema des monotheistischen Aton-Kultes Teil des psychoanalytischen Diskurses geworden. Doch von Beginn an begegnete der Gründervater der Psychoanalyse der wissenschaftlichen Neugier, das Seelenleben Echnatons zu ergründen, mit Reserve. Auf das von Abraham nicht ohne Stolz mitgeteilte Ergebnis der Studie (»Der Ödipus-Komplex, Sublimierung, Reaktionsbildungen – alles wie bei einem Neurotiker von heute«) antwortete Freud kühl, er trage Bedenken, »den König so scharf als Neurotiker hinzustellen«. Tatsächlich hat er sich zeitlebens geweigert, Echnaton auf die Couch zu legen; er hatte anderes mit ihm vor. Mit Breasted und Weigall begriff Freud den Ketzerkönig als eine weltgeschichtliche Persönlichkeit, deren einzigartige Leistung, den »vielleicht reinsten Fall einer monotheistischen Religion in der Menschheitsgeschichte« hervorgebracht zu haben, er nicht durch den Nachweis einer neurotischen Symptomatik geschmälert sehen wollte. Eine befremdliche Beschneidung der eigenen Profession, die dazu führte, dass der Herold sexueller Ätiologie die Fragen nach Triebausstattung und Libidoentwicklung des Pharao mit Stillschweigen überging. So blieb die Dialektik von Sinn und Sinnlichkeit, die sich den ersten Ausgräbern in der irritierenden Gegensätzlichkeit von Schrift- und Körpergedächtnis offenbart hatte und dann von Thomas Mann auf den Begriff gebracht wurde, ein weiteres Mal unaufgeklärt.
Eine Inkubationszeit von einem Vierteljahrhundert musste vergehen, ehe sich Freud in der Lage sah, seine eigene weit ausholende Argumentation vorzustellen, zunächst »in einer Art von historischem Roman«, der dann in überarbeiteter Form Teil des Spätwerks Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1939) wurde. Der Titel verrät, dass nicht Echnaton selbst, sondern – ähnlich wie bei Thomas Mann – eine biblische Figur die Gedankenführung zusammenhielt: Moses, den Freud freilich nicht als mythische Figur wie Joseph, sondern als geschichtliche Gestalt verstanden wissen wollte – mit ägyptischer Vorgeschichte: »Moses war kein Jude, (vielmehr) ein vornehmer Ägypter, hoher Beamter, Priester, vielleicht ein Prinz der königlichen Dynastie, ein eifriger Anhänger des monotheistischen Glaubens, den der Pharao Amenophis IV. so um 1350 v. Chr. zur herrschenden Religion gemacht hatte. Als nach dem Tode des Pharao die neue Religion zusammenbrach und die 18te Dynastie erlosch, hatte der hochstrebende Ehrgeizige all seine Hoffnungen verloren, beschloss, das Vaterland zu verlassen, sich ein neues Volk zu schaffen, das er in der großartigen Religion seines Meisters erziehen wollte. Er ließ sich zu dem semitischen Stamm herab, der seit den Hyksoszeiten noch im Lande verweilte, stellte sich an ihre Spitze (und) führte sie aus dem Frondienst in die Freiheit.«
Freud tritt uns hier ersichtlich als Historiker des Judentums entgegen, der für die anvisierte Entwicklungsgeschichte des judäischen Monotheismus auf das ihm zur Verfügung stehende Wissen seiner Zeit zurückgreift – und jetzt ereignisgeschichtlich (und nicht länger ideengeschichtlich) weiterspinnt. Wenn Moses ein Gefolgsmann des Echnaton war, der den Juden auf dem Wege eines Kulturtransfers die neue Religion brachte, dann waren ägyptischer und jüdischer Monotheismus anfänglich wesensgleich. Und gleich war auch ihr Schicksal. Weder die Ägypter noch die Juden »ertrugen den anspruchsvollen Glauben der Atonreligion«; er war zum Scheitern verurteilt. Freud hält es für wahrscheinlich, dass die junge hebräische Atongemeinde den ägyptischen Mann Moses »wenige Jahrzehnte später in einem Volksaufstand erschlagen und seine Lehre abgeworfen hat«. Die frühe mosaische Religion war kurz nach ihrer Einführung wieder von der Bildfläche verschwunden. Aber anders als in Ägypten – so die atemberaubende Fortsetzung der Freud’schen Gedankenführung – tauchte sie nach Ablauf von mehreren Jahrhunderten wieder auf, um sich (nun unter dem Namen der Jahwe-Religion) auf Dauer durchzusetzen. Wie war das möglich? Weil, so der jetzt psychoanalytisch argumentierende Freud, der Mord an Moses ein frühes Menschheitstrauma reaktiviert hat. »Das Schicksal hatte dem jüdischen Volk die Großtat und Untat der Urzeit, die Vatertötung, näher gerückt, indem sie dasselbe veranlasste, sie in der Person des Moses, einer hervorragenden Vatergestalt, zu wiederholen.« Weil der Moses-Mord eine alte verpönte Erinnerung wachrief, wurde die Tat verleugnet und verdrängt. Aber nur weil die Mosestradition den Zustand des Verweilens im Unbewussten durchgemacht hatte, konnte sie bei ihrer Wiederkehr die Massen in ihren Bann zwingen. Frühes Trauma – Abwehr – Latenz – Wiederkehr des Verdrängten, so lautet die Schlussformel, die der frühe Freud einst für die Entwicklung der individuellen Neurose aufgestellt hatte und die der späte Freud nun bereit war, aufzugreifen und in kühner Analogie auf die Genese des judäischen Monotheismus zu applizieren (und diesen damit in den zweifelhaften Rang einer kollektiven Neurose zu erheben).
Es ist hinreichend bekannt, dass sich Freuds historische wie phylogenetische Spekulationen als nicht haltbar erwiesen haben. Sein Konstrukt einer vorzeitlichen, von einem unbeschränkt herrschenden Patriarchen angeführten Urhorde ist nichts anderes als die Projektion des patri-ödipalen Dramas der eigenen Kindheit. Bei Moses handelt es sich um eine Gestalt der Gedächtnisgeschichte, nicht der Realgeschichte; die Annahme einer Zeitgenossenschaft mit Echnaton sowie die seiner angeblichen Ermordung sind rein fiktional. Der Exodus ist ein Stiftungsmythos, der als Umschrift der historisch bezeugten Vertreibung der Hyksos aus Ägypten zu verstehen ist; als Volk sind die Israeliten nie in Ägypten gewesen – und nie von dort ausgezogen. Der Abschied von einigen Prunkstücken der Freud’schen Argumentation darf aber nicht dazu führen, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Im Gegenlicht des Augenblicksmonotheismus von Amarna, der mit dem Tod seines Stifters wieder verging, hat Freud das Modell einer monotheistischen Durchsetzungsgeschichte von langer Dauer entworfen, das auf den beiden Säulen »Trauma« und »Wiederkehr des Verdrängten« ruht. Darin steckt das Angebot, unter der Oberflächenstruktur geschichtlicher Ereignisse die Tiefenschicht einer verborgenen Psychohistorie wahrzunehmen. Der Gewinn für die hier in Rede stehende Debatte besteht in der Anwendung dieses Verfahrens auf die Erinnerungsgeschichte Echnatons.
Es ist das große Verdienst von Jan Assmann, die Konzeption Freuds im Rahmen einer kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorie aufgegriffen und für den ägyptologischen Diskurs um Amarna fruchtbar gemacht zu haben. Hundert Jahre nach Breasted, in seinem Buch Moses der Ägypter (1998), hat Assmann die Frage nach der Beziehung von Echnaton und Moses neu aufgeworfen und sich mit ungemein inspirierenden Antworten an die Spitze der Monotheismusdebatte gestellt. Dies gilt uneingeschränkt auch deshalb, weil er nicht nur als Ägyptologe über ein exzellentes Dossier in Sachen Amarna verfügt, sondern in den benachbarten Häusern von Klassischer Archäologie und Alter Geschichte, von Theologie und Religionswissenschaft ebenso souverän zu Hause ist. Entstanden ist auf diese Weise ein eindrucksvolles Denkgebirge mit gut sichtbaren Sedimentschichten, die elaborierteste Sinngeschichte von Amarna, über die wir zurzeit verfügen.
Als Ausgangspunkt dienen Assmann – nicht anders als bei seinen ägyptologischen Vorgängern – die Sonnenhymnen. Ihr Zeugnis »stellt Echnaton als religiösen Revolutionär vor Augen, der, seiner Zeit weit voraus, in heroischem Modernismus die traditionellen Kulte verwirft und an deren Stelle einen exklusiven Kult der Sonne setzt«. Seiner Zeit weit voraus und doch Kind seiner Zeit; denn es war die weltumspannende (in der langen Regentschaft von Amenophis III., Echnatons Vater, kulminierende) Politik der Thutmosiden, die, so Assmann mit ausdrücklicher Berufung auf Breasted, die ägyptische Weltsicht drastisch veränderte und »eine Krise des polytheistischen Weltbildes zur Folge hatte. Das neue (...) Weltbild fand seinen religiösen Ausdruck in der universalistischen Idee des Sonnengottes, der mit seinem weltumspannenden Laufen und Strahlen alle Völker erschafft und erhält.«
Das Stichwort von der Krise des Polytheismus ist von allergrößter Bedeutung. Mit ihm gerät plötzlich die Vorgeschichte des neuen Monotheismus, die bislang im Schatten der ungeheuren Nachwirkung stand, in den Blickwinkel. Ganz im Sinne einer theologischen Vorbereitung des späteren Umsturzes hat Assmann die Entwicklung hin zu einer »neuen Sonnentheologie« verstanden, aus der die Amarna-Religion hervorgegangen ist. Der für die kulturelle Semantik Ägyptens tiefgreifende Wandel vollzieht sich in der Konzeption des Sonnenlaufs: als Wechsel von einer gemeinsamen, auf das Zusammenwirken der verschiedenen Götter angewiesenen Tat zu einer einsamen Handlung des Sonnengottes. Zur religiösen Vorgeschichte von Amarna zählt also ein den alten Polytheismus von innen auflösender Strukturwandel, der Echnatons Monotheismus als eine »radikale Variante« der neuen Sonnentheologie erscheinen lässt.
Um das Einmalige des Umschlags eines alt gewordenen Polytheismus in die Qualität eines weltgeschichtlich neuen Monotheismus auf den Begriff zu bringen, greift Assmann an dieser Stelle auf die Kategorie der sogenannten »Mosaischen Unterscheidung« zurück. Dieser Zentralbegriff gilt dem Antagonismus von wahr und falsch, dem Absolutsetzen der eigenen theologischen Position bei gleichzeitiger Verketzerung der Gegenseite. Genau diese unversöhnliche Geisteshaltung sieht Assmann beim Umsturz des Echnaton am Werke. Sie kreist um zwei Pole. Einerseits ist der rationalistische Charakter der neuen Religion unverkennbar. Sie ist mythologiearm und durchdacht. Wenn Echnaton Licht und Zeit als die beiden alles erklärenden Momente der solaren Energie begreift, dann stellt er sich »an den Anfang einer Reihe, die erst 700 Jahre später die ionischen Naturphilosophen fortsetzten« – und für die heute Namen wie Newton und Einstein stehen. Der Religionsstifter als physikalischer Welterklärer. Andererseits gilt Assmann derselbe Mann als Bilderstürmer, der in fanatischer Weise das dem Monotheismus inhärente Gewaltpotential entbindet. In Form einer großangelegten Razzia hat er versucht, das Gedächtnis der Götter des alten Pantheon zu tilgen, indem er ihre inschriftlichen Namen auskratzen ließ. Diese theoklastische Gewalttat ist die dunkle Seite der Religion des Lichts, die schon bald auf denjenigen zurückschlagen sollte, der sie entfesselt hat.
Doch für Assmann ist die damnatio memoriae, die den Amarnakönig mit gleicher Schärfe traf, keineswegs der letzte Akt. »Echnaton ist in Ägypten nämlich nicht vergessen, sondern verdrängt worden.« Und deswegen ist das Trauma des Monotheismus, das Sigmund Freud am Mann Moses und seiner Ermordung exemplifiziert hatte, als Trauma des Theoklasmus auch (und mit größerer Berechtigung) im Fall Echnaton nachweisbar. Spuren des theoklastischen Traumas resp. seiner Verdrängungsgeschichte findet Assmann in der »Legende von den Aussätzigen«, die Manetho, ein ägyptischer Priester und Geschichtsschreiber aus dem 3. Jahrhundert v.u.Z., überliefert hat.2 Er liest die Erzählung, in der die Gestalten Echnatons und Moses’ zusammenwachsen, als eine verschobene Erinnerung an Amarna – als eine späte »Wiederkehr des Verdrängten«. In der kulturellen Begegnung mit den im Lande siedelnden Juden, den einzigen Trägern der monotheistischen Idee, kehrt die untergegangene und überwunden geglaubte Epoche von Amarna plötzlich wieder. Der historisch bezeugte Antijudaismus in den Zeiten des Manetho ist damit psychohistorisch gesehen als ein wiedergekehrter Antimonotheismus aus der Zeit Echnatons zu verstehen.
Die Skizze der Assmann’schen Argumentation erhellt, wie hochdifferenziert eine sich in Augenhöhe mit anderen Kulturwissenschaften bewegende Ägyptologie das ambivalente Erbe des Echnaton zu analysieren vermag – und welche intellektuelle Schönheit ihr auf diese Weise zuwächst. Mit langem Atem quert Assmann die Horizonte der endlichen Tagfahrt und der unendlichen Nachtfahrt der Sonnenreligion von Amarna. Der kühne Bogen spannt sich von der Vorgeschichte der monotheistischen Episode (»Neue Sonnentheologie«) über die Wesensbestimmung der etablierten Atonreligion (»Mosaische Unterscheidung«) hin zur rätselhaften Doppelgestalt von Untergang und Wiederkehr (»Traumatische Erfahrung«). Wenn Assmann nach dem Durchgang einer tausendjährigen Geschichte die innerägyptische Abwehr des solaren Monotheismus als letzten Grund für die Frühform der antiken Judenfeindschaft ins Auge fasst, dann vollendet sich ein Denkbild, in dem der Theoklasmus des Echnaton als Ursprungsimpuls einer ungeheuer komplexen Gedächtnisgeschichte in Anspruch genommen wird. In letzter Konsequenz führt die alte bronzezeitliche Spur, wie Assmann an einigen Stellen behutsam andeutet, in die Nähe der Erinnerungslandschaft des Holocaust, des unvergänglichen Traumas der Jetztzeit. Eine sehr deutsche Ergänzung der treffenden Feststellung von Barry Kemp (1989), dass »wir noch immer im Schatten der Bronzezeit leben«.
Hundert Jahre Monotheismusthese: Unser Abriss hat den Siegeszug einer großen Idee über einige der zentralen Etappen nachgezeichnet, von den Anfängen bei Breasted und Weigall bis zum vorläufigen Abschluss bei Assmann. Naturgemäß ist eine solche Erfolgsgeschichte ohne die breite Zustimmung innerhalb der scientific community nicht möglich. Allerdings ist die Lage hier sehr uneinheitlich. An der intensiven Debatte, die Assmanns Buch Moses der Ägypter ausgelöst hat, haben sich vor allem Religionswissenschaftler, Alttestamentler und Theologen beteiligt. Viele Ägyptologen betrachten die Überschreitung der Fachgrenzen mit Unbehagen und verweigern sich der Aufnahme genuin kulturwissenschaftlicher Konzepte wie Gedächtnisgeschichte oder Traumatheorie. Die wenigsten sind entsprechend ausgebildet und auf diesen Schritt vorbereitet. Andererseits schärft die klassische Archäologie des Spatens den Blick für eine Vielzahl kontroverser Detailfragen. Hier wiederum liegt eine unbestreitbare Stärke. Und tatsächlich haben die jüngsten Grabungskampagnen, das »Akhenaten Temple Project« unter Leitung von Donald Redford nicht anders als die Arbeiten der »Egypt Exploration Society« mit Barry Kemp an der Spitze, sehr viel sperriges Material zutage gefördert, das die Anschlussfähigkeit der Monotheismusthese auf eine harte Probe stellt. Die alte Vorstellung eines landesweiten Bildersturms deckt sich nicht mit den neuesten Befunden. Das Aushacken von Namen und Bildern geschah eher sporadisch; die Tempel der Götter sind nicht systematisch zerstört worden. Was bedeutet es, wenn Götter wie Atum oder Uto weiterhin in Ehren gehalten, Götter wie Ptah oder Thot verschont oder geduldet, andere wie Osiris »nur« übergangen wurden? Wie war es möglich, dass selbst die Erinnerung an das meistverfolgte Götterpaar, Amun und Mut, in Gestalt theophorer Personennamen in Amarna weiterleben konnte? In den ausgegrabenen Wohnhäusern fanden sich Hausaltäre, die der göttlichen Trias Aton-Echnaton-Nofretete geweiht waren, sowie zahlreiche Relikte der beliebten Schutzgötter Bes und Thoeris. Könnte es sein, dass nur das Königspaar Aton allein verehrte, die Gefolgsleute des Hofes und die Bevölkerung dagegen einem neuen Pantheon huldigten; dass andererseits neben dem offiziellen Staatskult Platz blieb für die alten Formen der Volksfrömmigkeit? Der Bruch mit Amarna hat sich keineswegs so jäh vollzogen, wie bislang angenommen wurde. Echnaton hatte vier Nachfolger (Nofretete, Semenchkare, Tutanchaton/-amun, Eje), die zusammen noch einmal 17 Jahre regierten. Wie ist zu erklären, dass noch zu Zeiten des frühen Tutanchaton die Arbeiten an den Atontempeln von Karnak wieder aufgenommen wurden und selbst die Nach-Amarnazeit den »neuen Gott« Echnatons keineswegs verfemte? Lag der Stein des Anstoßes, der zunächst Haremhab und dann die Ramessiden auf den Plan rief, nicht allein auf dem Gebiet der Religionspolitik, sondern ebenso auf dem der Machtpolitik? Steckte hinter der damnatio memoriae gar nicht das Motiv des Antimonotheismus, sondern eine sehr nüchterne Staatsräson?
Der Klärungsbedarf, den diese offenen Fragen dringlich vor Augen führen, hat indes den Erfolg des in Rede stehenden Paradigmas nicht zu schmälern vermocht. Ehemalige Skeptiker wie Erik Hornung, der Nestor der deutschen Ägyptologie, haben ihren Widerstand gegen die Monotheismusthese aufgegeben – und arbeiten mittlerweile selber mit ihr. Die These vom ersten Monotheismus der Weltgeschichte ist heute Teil des kulturellen mainstream und als solcher von beeindruckender Breitenwirkung; sie wird in den Feuilletons der großen Zeitungen nicht anders als im Umfeld der großen Ägyptenausstellungen nahezu als Gewissheit kolportiert. Nun ist auffällig (und bemerkt worden)3, wie sehr die Resonanz, die der (angeblichen) Entdeckung eines altägyptischen Monotheismus zuteil wurde, von den Seelenständen der Entdecker abhängig war. Wenn für das Zeitalter, das es zu besichtigen gilt (die späte Bronzezeit im Alten Ägypten), die Formel »Krise des polytheistischen Weltbildes« gefunden wurde, so ist die Welt der Entdecker der ersten monotheistischen Revolution (das späte 19. und beginnende 20. Jahrhundert) durch die Krise des biblischen Monotheismus gekennzeichnet. Alle genannten Autoren schreiben unter dem Eindruck einer fortschreitenden Entzauberung der Bibel durch Literarkritik und Archäologie, die ein rapider Verfall von Religion und Sittlichkeit begleitet. Alle begrüßen, freilich auf unterschiedliche Weise, die »Religion des Lichts« als Offenbarung: Breasted, der im Aufgehen der Atonreligion »die Morgenröte des Gewissens« erkennen will; Weigall, der in Christus den wiederauferstandenen Echnaton feiert; Mann, der in den alten Spuren mythische Prägungen wahrnimmt, die unserer Seele Tiefe und unserem Leben Sinn geben können; Freud, der die (vormals jüdisch bestimmte) Großtat der Wiedereinsetzung des Urvaters in Gestalt des einen Gottes Echnaton dem Ägypter zuschreibt; und Assmann, der »religiös Virtuose und Musikalische«, der mit feinem Gespür die Sprache der Gewalt wahrnimmt und auf den Preis aufmerksam macht, den wir für den Monotheismus (und damit zugleich für das Verstummen des Kosmotheismus) bis auf den heutigen Tag zu entrichten haben.
Heute ist der Schrecken religiös codierter Gewalt allgemein und der unter dem Schlagwort »Kampf der Kulturen« firmierende Krisenzusammenhang längst um die Krise des islamischen Monotheismus erweitert worden. Doch die alte Vision, die drei verfeindeten Monotheismen in Erinnerung an den gemeinsamen abrahamitischen Anfang zu versöhnen, hat sich erschöpft – und durch die Auffindung eines vierren Monotheismus, der historisch gesehen an der Spitze steht, erledigt. Verbirgt sich hinter der Idee eines ägyptischen Vorläufers der alten Monotheismen ein neuer Mythos von der Einheit des Menschengeistes?4 Wenn dem so wäre, dann hätten wir ein weiteres Stück der geheimen Anziehungskraft des Paradigmas zutage gefördert; seine Durchsetzungsgeschichte aber wäre damit noch nicht erklärt. Der Siegeszug der Monotheismusthese hat erstaunlicherweise mit dem Gegenstand der Forschung selbst zu tun. Zugespitzt formuliert hält die um den Monotheismusbegriff gerahmte Sinngeschichte innerhalb des Diskurses um die Ära Echnaton eine quasi-monotheistische Position inne. Ihre Rekonstruktion der Ereignisfolge ist konkurrenzlos. Neben unzähligen Einzelanalysen, die häufig nur notdürftig chronologisch verlötet werden, gibt es keinen vergleichbaren Gesamtentwurf, der die rätselhafte Geschichte der Amarnakönige auf den Begriff zu bringen vermöchte. Die Monotheismusthese fungiert nach Art einer exklusiven Navigationshilfe durch das unwegsame Gelände von Raum und Zeit. Sie allein, so scheint es, verfügt über einen durchlaufenden roten Faden, der es erlaubt, die komplexe Geschichte als Abfolge von Phasen zu erzählen: der Einführung, der Radikalisierung, der Wiederaufgabe und der Verfemung einer grundstürzenden monotheistischen Religion.
Reden so die ausgegrabenen Steine? So und anders. Das Dilemma des saxa loquuntur besteht ja darin, dass jeder Fund gedeutet werden muss. Kein Monument interpretiert sich selbst. Das gilt für den Fall Amarna in einem ganz besonderen Maße, denn nicht mündliche oder schriftliche Überlieferung hat uns den Weg dorthin gewiesen, sondern allein der Spaten der Archäologen. Achetaton und die amarnatypischen Anlagen von Theben sind ausgegraben, aber nirgends hat sich die Spur einer großen Geschichte oder Legende gefunden. Die archäologischen Funde sind ohne jeden mythologischen Index. Was das bedeutet, zeigt erst der Vergleich mit dem gegenläufigen Fall Troia. Schliemann war beseelt von der großen Erzählung der Ilias; was er ausgrub, hatte einen Namen und eine genaue Stelle in der literarischen Überlieferung, hieß »Schatz des Priamos« oder »Maske des Agamemnon«. Unbeschadet vieler Irrtümer vollzieht sich die Diskussion um Homer und den Troianischen Krieg bis heute unter dem Spannungsbogen von »Mythos oder Realität«. Im Fall Amarna waren die ersten Funde »blind«. Weder der Ort selber noch Namen und Herkunft seiner Herrscher waren bekannt. Noch Lepsius, dem es gegen Mitte des 19. Jahrhunderts gelang, den »Bech-en-Aten« (wie er den unbekannten Pharao anfänglich nannte) der 18. Dynastie zuzuordnen, musste sich mit dem Gerücht herumschlagen, die Monumente von El-Amarna stammten von den Hyksos. Mit dem spektakulären Fund des Tontafelarchivs (der keilschriftlichen Korrespondenz der Amenophis III und IV mit den Königen und Fürsten Vorderasiens) änderte sich das Bild, das heißt: die Erwartungshaltung hinsichtlich einer großen Geschichte. Schon die Ausgrabungen des frühen 20. Jahrhunderts begleitet die teils heimliche, teils offene Suche nach dem Mythos von Amarna. Die ganze Rezeptionsgeschichte steht im Bann dieser Idee.
Der Anspruch auf diese Semantik ist nicht leicht abzutun, wie die unzähligen Romane und Bühnenwerke, Opern und Musicals, Bilder und Filme belegen, die jenseits der Forschung entstanden sind und die Ikonen der Amarnazeit auf ihre Art verherrlichen.5 Der kulturelle Sinn, den das Monotheismusparadigma anzubieten hat, ist fraglos von anderer Qualität, aber es wäre ein Irrtum zu glauben, hier wäre der Faden der wahren Geschichte gefunden und entrollt worden. Bei der These von der »monotheistischen Revolution, ihrem Scheitern und heimlichen Weiterleben« handelt es sich um eine glänzende Interpretation. Sie imponiert durch die Vielzahl der Räume, die das Erklärungsmuster erschließt, die klugen Denkwege, die diese miteinander verbinden, schließlich die scheinbar passgenaue Zusammensetzung der Teile zu einem kohärenten Ganzen. Sie definiert sich aber nicht minder durch ebenso viele Einseitigkeiten und Auslassungen, ohne die ein in sich stimmiges Paradigma nicht Kontur gewinnen kann. Solange man sich in seinem Inneren bewegt, eingeschlossen im Kokon eines dichten Bedeutungsgewebes, wird dieser einbehaltene Sinn nicht als Mangel erlebt. Erst wenn man heraustritt und dem schönen Ganzen gegenübertritt, vermag man zu erkennen, dass der Versuch, den Knoten des Amarnakomplexes vom Leitfaden des Monotheismus her aufzulösen, der Dialektik der Aufklärung nicht entgangen ist. Anders als beim legendären Bild zu Sais, das entschleiert werden will, haben die Monotheismustheoretiker die nackten Tatsachen, die der Spaten nach und nach freigelegt hat, eingekleidet. Was vor uns steht, ist das verschleierte Bild von Amarna, in seiner Mitte Echnaton, angetan mit des Königs neuen Kleidern. Er ist nackt und hässlich, allein der Glaube an das besondere semantische Schnittmuster verbürgt jene Tuchfühlung, die ihn, ein anderer Lilienprinz, vor unserem geistigen Auge in einen Schöngeist und kulturellen Heros verwandelt.
Abb. 3: Grabung der Deutschen Orient-Gesellschaft in Tell-el-Amarna (1914)
Heißt das nun, eine theologisch inspirierte und spekulativ verfahrende Ägyptologie handle hier leichten Sinns nach dem Motto »Kleider machen Leute«? So einfach dürfen wir es uns sicherlich nicht machen. Aber wer immer die konkrete Einzelanalyse verlässt und (bei spärlicher Quellenlage) aufs Ganze geht, der muss wissen, dass die wenigen Bruchstücke von unstrittiger Bedeutung allein durch den Kitt eines meta-physischen Sinns zusammengehalten werden.6 Zu gewinnen ist bestenfalls ein »ehernes Bild auf tönernen Füßen«. Diese selbstkritische Einschätzung, die Sigmund Freud einst mit Blick auf seine großartige Mosesstudie getroffen hat, gilt ohne alle Ausnahme, also auch für die vorliegende Studie. Sie muss auf die Weise einer engmaschigen Argumentation überzeugen: durch Triftigkeit (nicht durch Gewissheit). Für die etablierten Entwürfe, den Freud’schen nicht weniger als den von Assmann, beinhaltet der semantische Vorbehalt gegenüber den Rekonstruktionsversuchen kulturellen Sinns paradoxerweise eine gewisse Immunisierung; sie haben jenseits der Frage nach der historischen Wahrheit Bestand, insofern sie als Modelle zu einer Theorie der kulturellen Überlieferung dienen können. Das begründet ihren bleibenden Wert. Das mehrfache Bürsten gegen den Strich des Monotheismusparadigmas ist deshalb auch nicht auf Widerlegung aus. Intendiert ist vielmehr, den Horizont an Möglichkeiten neu aufscheinen zu lassen. Was sich mit der Sondierung des Prospekts der monotheistischen Kulturlandschaft Ägyptens andeutete, ist in heilsame Verunsicherung umgeschlagen. Die Dinge sind im Fluss, ihre einseitige Ausrichtung ist ins Wanken geraten. Vieles könnte sich offenbar ganz anders zugetragen haben – und damit andere Erklärungen erzwingen. Das bedeutet, es sind Zweifel aufgekommen, ob in alle Richtungen ermittelt wurde oder ob die frühe Festlegung auf eine bestimmte Version genau dies verhindert hat. Die Konsequenz aber lautet: Der Fall Echnaton muss neu aufgerollt werden. An diesem Punkt, einem point of no return, stehen wir. Die übersehenen Spuren noch exakter zu sichern, die vernachlässigten Dimensionen der Debatte noch präziser zur Sprache zu bringen, ist der nächste Schritt. Die Monotheismusthese, so viel sollte deutlich geworden sein, ist offensichtlich überinstrumentiert und der Hauptgrund ist die extreme Fokussierung auf Echnaton.
Alle Entscheidungen gehen von ihm aus, alle Fäden laufen bei ihm zusammen. Dem jungen König von »ausgeblühtem Geschlecht« wird eine weltgeschichtliche Rolle zugeschrieben (oder sollten wir sagen: aufgebürdet), die selbst stärkere Naturen überfordert hätte. Ausgestattet mit dem Genie eines Naturphilosophen und der poetischen Kraft eines Sängers hat er die Sendung der Religionsstiftung angenommen und quasi im Alleingang die altehrwürdige Kultur Ägyptens aus den Angeln gehoben. Ist das glaubhaft? Doch die Überbewertung hat Methode. Werke wie der Große Atonhymnus, die mit gleicher Berechtigung von anderen (wie dem »Gottesvater« Eje) stammen könnten, gelten wie selbstverständlich als Echnatons Schöpfung. In ähnlicher Weise werden ihm die weichenstellenden Taten der ersten Jahre (der Bau des ersten Atontempels in Karnak sowie die Feier des Sed-Festes) zugerechnet, obwohl belegt ist, dass er als unmündiges Kind auf den Thron kam und die Regierungsgeschäfte anfänglich in den Händen seiner Mutter, Königin Teje, lagen (Abb. 4). Gewiss, in Fragen der Datierung und Zuschreibung folgt die Ägyptologie nur den inschriftlichen Vorgaben der Zeit; aber der nachlässige Positivismus, mit dem die extrem herrscherzentrierten Angaben übernommen werden, hat schwerwiegende Folgen. Wer zulässt, dass die dem Pharao geltende Propaganda Zeugniskraft erhält, der verstellt den Blick auf andere Schlüsselfiguren und Einflussgrößen.
Nun handelt es sich bei Teje und Eje um keine ganz beliebigen Akteure auf der Bühne der späten 18. Dynastie. Die beiden sind Geschwister und stammen aus dem Hause des Juja, eines hohen Würdenträgers, der unter Thutmosis IV. (Echnatons Großvater) die Funktion eines »Vorstehers der Pferde« innehatte und damit die militärische Schlüsselstellung der Leitung der Streitwagentruppe. Juja und seine Frau Tuja, deren hohes Ansehen durch ein reich bestücktes Grab im Tal der Könige bezeugt ist, haben es vermocht, dass ihre Tochter Teje zur Großen Königlichen Gemahlin von Amenophis III. aufstieg und ihr Sohn Eje die bedeutende Position seines Vaters beerben konnte. Anen, ein weiterer Sohn, bekleidete in Theben das nicht minder wichtige Amt eines Hohepriesters des Re; er komplettiert damit den beispiellosen Einfluss des Hauses Juja auf die Politik der Thutmosiden. Doch die Positionierung von drei Kindern im Herzen der Macht ist nur ein Teil, das Mittelstück sozusagen, eines größeren, sich über vier Generationen erstreckenden Prozesses der Machtverschiebung am ägyptischen Königshof. Am Anfang dieser Reihe steht Mutemwia, eine Schwester des Juja, der es als erster Frau dieses mächtigen Clans gelungen ist, die Stellung einer Königin einzunehmen. Als Gattin Thut-mosis IV. wird sie zur Mutter Amenophis III. Und sie ist es, die nach dem Tod ihres Mannes als faktische Regentin dafür sorgt, dass der noch minderjährige Kronprinz mit ihrer Nichte Teje vermählt wird. Eine Generation später wird die verwitwete Teje das Spiel mit der (und um die) Macht wiederholen und ihren Sohn Amenophis IV. wiederum mit einer Nichte, einer Tochter des Eje, verheiraten. Als Nofretete die Position der Großen Königlichen Gemahlin an der Seite ihres Mannes, des nachmaligen Pharao Echnaton, einnimmt, ist sie die dritte Frau in Folge, die aus dem Hause Juja zur Königin gekrönt wird. Der direkte Zugriff auf den Pharaonenthron gelingt dann ausgerechnet dem alternden Eje selbst; als er nach Tutanchamun den Thron besteigt, schließt sich der Kreis. Der finale Triumph markiert zugleich das Ende des Hauses Juja.
Abb. 4: Amenophis IV. als Kindkönig zu Beginn seiner Regierung
Die Wiedergewinnung einer genuin politischen Ebene zur Erklärung der Ereignisse, die zum Untergang der Thutmosiden führten, gelingt erst, wenn die zentrale Rolle, die Echnaton im Rahmen der Rekonstruktionsgeschichte zugewachsen ist, aufgegeben wird. Dazu muss das enge (und analytisch gesprochen: überdeterminierte) Geschichtsfeld von Amarna räumlich wie zeitlich erweitert werden. Out of Amarna, das heißt vor allem Preisgabe der Fixierung auf theologische und religionspolitische Fragen. Ein solchermaßen beschränkter Diskurs interpretiert alle relevanten Geschichtsmomente im Lichte der »religiösen Revolution« des Echnaton. Unter den Stichworten »Neue Sonnentheologie« und »Kultische Privilegierung solarer Gottheiten« sinkt die Epoche der Vorgänger zur bloßen Vorgeschichte eines kommenden Großereignisses herab. Ich werde dagegen plausibel machen, dass die Geschehnisse von Amarna Teil einer größeren Geschichte sind, die nicht (allein) religionspolitisch, sondern in erster Linie machtpolitisch inspiriert war.
Eine zweite vernachlässigte Dimension ist in meiner Rekonstruktion der Debatte von Anfang an zur Sprache gekommen, in Form der verschiedenen Reaktionsweisen auf die irritierende Körperlichkeit Echnatons. Diese bestehen typischerweise in einer Art von Abwehrhaltung, der Weigerung, den Eindruck einer bedeutsamen Leiblichkeit als Moment der Erkenntnis zuzulassen. Erlaubt ist einzig eine medizinische Ferndiagnose, und so wird bis heute mit zweifelhaften Expertisen darüber gestritten, ob Echnaton vielleicht unter dem »Fröhlich’schen Syndrom« oder eher unter dem »Marfan-Syndrom« gelitten haben könnte.7 Dabei steht der deformierte Körper des Königs nicht allein; seine Darstellung ist Teil einer ostentativen Sinnlichkeit, die sämtliche Abbildungen der Schönen und Nackten von Amarna durchzieht. Die ebenso anziehend wie abstoßend wirkende Körperlichkeit kulminiert in der offen zur Schau gestellten Tyrannei der Intimität, wie sie vor allem in den Familienszenen vorherrscht; sie hat ihren Höhepunkt in der androgynen Kolossalfigur Echnatons, die den frühen Atontempel von Karnak zierte. Mit dem Wissen um mehrschichtige inzestuöse Verbindungen innerhalb der königlichen Familie schließt sich dieser aufdringliche Bildkomplex – von einem psychoanalytischen Blickwinkel aus betrachtet – nahezu zwangsläufig zur Vorstellung eines ganz anderen Syndroms zusammen. Sichtbar wird der Glutkern eines heilig-verfluchten Eros, der die gleichsam gefühlte (nicht erdachte) Kraft der Sonnenenergie des »lebenden Aton« aufscheinen lässt – und damit den Beziehungsaspekt hinter dem Inhaltsaspekt der Atonreligion zur Sprache bringt. Ich werde zeigen, dass die charismatische Prophetie des Echnaton nur vor dem Hintergrund eines sich über mehrere Generationen erstreckenden inzestuösen Familienzusammenhanges verstanden werden kann, der die dynastisch erlaubten Gleise einer Bruder/Schwester-Verbindung verlassen hat. Der (in den Worten der griechischen Tragödiendichtung) »sich fortzeugende Frevel« des Inzests bezeichnet den verborgenen seelischen Motor hinter den Umwälzungen und Zerwürfnissen der Amarnazeit. Die aufgenommene Spur einer verhängnisvollen Sexualpolitik verspricht ineins das Rätsel um die Herkunft der Prinzen Semenchkare und Tutanchaton zu lösen.
Die durchgehende Privilegierung des theologisch-religiösen Diskurses hat sowohl die machtpolitische als auch die sexualpolitische Dimension in den Schatten gestellt. Beide Ebenen spielen im Monotheismusparadigma praktisch keine Rolle. Ihre Wiedergewinnung bedeutet aber nicht, dass nun die religionspolitische Ebene der Aufmerksamkeit entzogen werden soll. Ihre grundsätzliche Bedeutung liegt offen zutage; sie ist unbestritten, bedarf aber im Lichte einer thematisch breiteren Debatte einer Neubewertung. Auch die Anfänge der Kultreform liegen out of Amarna – und (noch) nicht in den Händen Echnatons.8 In den frühen Regierungsjahren Amenophis’ IV. werden im thebanischen Karnak die ersten Aton-Tempel errichtet. Formell im Namen des jungen Königs erbaut, zeigen die Heiligtümer deutlich die Handschrift von Teje und Eje. Ihre auffälligsten Elemente, die Kolossalstatuen des Königs und die Pfeiler der Königin, sind der eindrückliche Ausweis der absoluten Gleichrangigkeit eines gottgleichen Königspaares. Das heißt, jene Position, die sich Teje im Verlauf einer langen Regierungszeit erobern musste, wird Nofretete von Beginn ihrer Regentschaft an auf den Leib geschrieben. Mit der Einführung einer monotheistischen Religion hat das nichts zu tun. Die frühe Atonreligion ist vielmehr Mittel zum Zweck: der Herrschaftssicherung und Legitimierung der weiblichen, aus dem Hause Juja stammenden Linie.
Auch das frühe Sed-Fest dient der religionspolitischen Zementierung des prekären Machtgefüges zwischen dem Geschlecht der Thutmosiden und dem Hause Juja. Dass es sich um herrschaftssichernde Königstheologie handelt und nicht um das Weiterspinnen einer monotheistischen Sonnentheologie, belegt das Nebeneinander des Aton mit den anderen Gottheiten. Die traditionelle Göttervielfalt ist beim Erneuerungsfest des Königs noch unangetastet geblieben. Erst Echnaton der Amarnakönig legt Jahre später Hand an die alte Komplementarität von Gott und Göttern. Als er die Zügel der Macht endlich in die Hand nimmt, radikalisiert er eine Entwicklung, die ursprünglich anders gemeint war. Und doch hat Achetaton als Ganzes die polytheistische Semantik, die seit alters her ein Oszillieren zwischen dem Einen und den Vielen war, nicht wirklich durchbrochen. Die sich zunehmend dogmatisch gebende Monolatrie, die das Königspaar ausübt, wird seitens der erweiterten Atongemeinde konterkariert durch die Verehrung einer Trias aus Aton, Echnaton und Nofretete – und der Duldung von nachrangigen Gottheiten. Nicht in der Stiftung einer monotheistischen Religion, sondern – so die hier vertretene These – in der Errichtung eines Gottesstaates des Aton verbirgt sich die revolutionäre Tat des Echnaton. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte vollzieht sich in Amarna die Umbuchung der politischen Bindungen auf Gott. Der Kult feiert und erneuert die unumschränkte Königsherrschaft des Gottes im heiligen Bezirk von Achetaton, in dem der junge Pharao als dessen erster Prophet auftritt.
Mit der Neubewertung der Tat des Echnaton – Theokratie statt Monotheismus – fällt auch auf die Gedächtnisgeschichte von Amarna ein neues Licht. Im Assmann’schen Entwurf ist die lange unterirdisch verlaufende Erinnerungsspur der verdrängten Atonreligion erst nach Ablauf eines Jahrtausends wieder greifbar – am Material einer fragmentarischen und mehrdeutigen Legende. Ein problematischer Befund. Der vorgeschlagene Perspektivenwechsel lenkt dagegen den Blick auf eine weitere theokratische Gründung auf ägyptischem Boden nur 250 Jahre nach Amarna: den thebanischen Gottesstaat des Amun. Erst in dieser Gegenüberstellung wird die Rede von Trauma, Verdrängung und Wiederkehr des Verdrängten konkret. Ethnopsychoanalytischem Verständnis zufolge kann die Aufrichtung des Gottesstaates des Amun als weitgehend unbewusste Reaktionsbildung auf den Gottesstaat des Aton verstanden werden – mithin als eine traumatische Reinszenierung. Träger dieser Bewegung war offensichtlich die entmachtete und gedemütigte Amun-Priesterschaft, die bestrebt war, die historische Niederlage über den bekannten Mechanismus einer »Identifikation mit dem Aggressor« in ihr Gegenteil zu verkehren und so ungeschehen zu machen.
Die zu Trittsteinen einer noch weithin unaufgedeckten Gedächtnisgeschichte verbundenen Theokratien von Amarna und Theben lenken den Blick unwillkürlich out of Egypt: auf das nachexilische Juda, wo die theokratische Semantik des Gottesstaates geschichtlich ein drittes Mal Fuß fassen konnte. Ist der judäische Gottesstaat (auf den Josephus Flavius den Begriff Theokratie ursprünglich gemünzt hat) jenseits der angeblichen Wirkungsgeschichte des monotheistischen Geistes in Wirklichkeit durch das jahrhundertelange Beispiel des thebanischen Gottesstaates beeinflusst worden? Mit der hier aufblitzenden »Nähe Amuns zu Jahwe« (Manfred Görg) verliert die von Jan Assmann postulierte Verbindung Echnatons zu Moses weiter an Plausibilität. Als Marker des Wiederauftauchens der traumatischen Amarnaerinnerung ist der Bericht des Manetho ohnehin nur bedingt geeignet, weil in ihm das Gedächtnis vieler anderer Leidenszeiten eingeschrieben ist. In ihrem Kern ist die »Legende von den Aussätzigen« eine polemische Gegengeschichte zur jüdischen Exoduserzählung, die (vergeblich) versucht, die historisch bezeugte Vertreibung der Hyksos aus Ägypten mit dem mythischen Auszug der Israeliten, der zweiten semitischen Großgruppe, in ein Verhältnis zu bringen. Alle Missverständnisse haben damit zu tun, dass die antiken Autoren (und in ihrer Nachfolge nicht wenige der christlichen Autoren von heute) leichtfertig die »Hebräer in Ägypten« als geschichtliche Größe ernst genommen und wahlweise mit den Hyksos selbst identifiziert oder als Platzhalter einer ägyptischen Großgruppe wie der Atongemeinde von Amarna wahrgenommen haben. Werden die Fäden von Geschichte und Gedächtnisgeschichte wieder auseinandergehalten, findet das Verwirrspiel um Moses den Ägypter ein Ende.
Unbeschadet dieser Einwände lenkt die These, bei Moses handele es sich um eine verschobene Erinnerung an den verdrängten Pharao, den Blick auf die mythologische Ebene; sie hat in der Amarnageschichte bis heute keine deutliche Kontur erfahren und sollte deshalb nicht leichthin verworfen werden. Ist es möglich, dass die Gestalt des Echnaton in einem anderen als dem biblischen Mythos verdeckte Spuren hinterlassen hat? Erinnern wir zunächst noch einmal an den besonderen historischen Raum, in dem Amarna angesiedelt ist: die späte Bronzezeit. Diese Zeit ist im kulturellen Gedächtnis des Abendlandes als heroische Epoche lebendig geblieben. Vor allem die griechische Antike hat diese Erinnerung wachgehalten und dabei den Untergang des heroischen Zeitalters auf die Kriege um Theben und Troia bezogen. Ihre Helden, Ödipus und seine Söhne nicht anders als Agamemnon oder Achill, bevölkern eine glänzende Vorwelt. Es ist, wenn wir uns die Fiktion gestatten, die Geschichte vor der Kulisse des Mythos abspielen zu lassen, die Welt von Theben, Amarna und Piramesse. Steckt im göttergleichen Geschlecht der letzten Thutmosiden und ersten Ramessiden die historische Vorlage für das göttergleiche Geschlecht der Heroen? Für den Kampf um Troia lässt sich zeigen, dass der gewaltige gedächtnisgeschichtliche Raum, in dem die Ilias Platz greift und den das Epos mit einer verwirrenden Vielfalt von Erinnerungsfäden vernetzt, von zwei ägyptischen Großereignissen begrenzt wird: durch die Schlacht von Kadesch (1275/4 v.u.Z.) auf der einen, die Eroberung Thebens (663 v.u.Z.) auf der anderen Seite.9 Lässt sich Ähnliches für den zweiten Mythenstrang sagen? Gibt es eine Verbindung zwischen dem siebentorigen Theben im Lande Böotien und dem »hunderttorigen Theben« im Land der Ägypter, das Homer besungen hat? Ist König Ödipus der zu Echnaton passende Mythos?10
Unter dieser Fragestellung soll in behutsamer Weise der mythologische Bodensatz gefiltert werden, in dem die Amarnageschichte auf andere Weise überlebt haben könnte. Es ist dies zugleich – nach den unter den Stichworten Machtpolitik, Sexualpolitik, Religionspolitik und traumatische Gedächtnisgeschichte skizzierten Ebenen – die letzte Schicht, mit welcher der Sondierungsschritt zur Formulierung einer alternativen Sinngeschichte sein Ende findet. Zu den Eckpfeilern des neuen Erzählgebäudes, dessen Solidität und Standfestigkeit sich in den nachfolgenden Kapiteln zu beweisen hat, zählen – thesenhaft gebündelt – diese Aussagen:
Das bewegende Geschichtsmoment der Amarnazeit ist ein vom Hause Juja betriebener Dynastiewechsel und nicht die Erfindung des Monotheismus.
Zum Machterhalt werden inzestuöse Verwandtschaftsverhältnisse auf Dauer gestellt, welche letztlich den Untergang der Thutmosiden heraufbeschwören.
Die religionspolitische Großtat Echnatons besteht in der Aufrichtung des weltgeschichtlich ersten Gottesstaates in Achetaton.
Im thebanischen Gottesstaat des Amun erlebt die untergegangene Theokratie von Amarna nach Jahrhunderten eine traumatische Wiederkehr.
Nicht in der Gestalt des biblischen Moses, sondern in König Ödipus könnte sich eine verschobene Erinnerung an König Echnaton erhalten haben.
Sämtliche Bausteine meiner Argumentation stammen aus dem Fundus, den die Forschung zusammengetragen hat. Das heißt, ich selber werde keinen neuen Sensationsfund präsentieren, sondern die vorhandenen Materialien – als handele es sich um verstreute Talatatblöcke11 – neu zusammensetzen und deuten. Keines der zentralen Zeugnisse der Monumente und Keilschriften, der Hymnen und Inschriften, der Kunst und Architektur wird dabei unberücksichtigt bleiben. Alles, was hier erzählt wird, wurde schon einmal erzählt – nur bruchstückhaft oder in anderer Reihenfolge und mit anderem Zungenschlag. Diese Arbeit will nicht das Sichtbare wiedergeben, sondern (nach dem schönen Wort von Paul Klee) sichtbar machen. Die Leser werden eingeladen, Amarna zu verlassen, um von außen einen neuen Blick auf die erweiterte Epoche zu werfen. Das schließt ein, dass die Sache nicht nach der herkömmlichen Weise chronologisch abgehandelt wird. Die Kapitel des Buches schließen aneinander vielmehr an wie die Teile eines Puzzles. Sie müssen passen, Sinn machen und neue Möglichkeiten eröffnen. Das ist ihre Ordnung. Eine Ordnung, die es mit sich bringt, dass zuweilen etwas vorausgeschickt werden muss, was erst später eingeholt werden kann. Und so beginnt die ägyptische Reise in Hattuscha, der Hauptstadt des bronzezeitlichen Hethiterreiches, um nach langer Fahrt in der griechischen Thebais zu enden, dem Schauplatz einer Tragödie, die wir möglicherweise als fernes Echo auf den Aufruhr von Amarna verstehen müssen.
Abb. 5: Das Königstor in Hattuscha (Detail des göttlichen Kriegers)