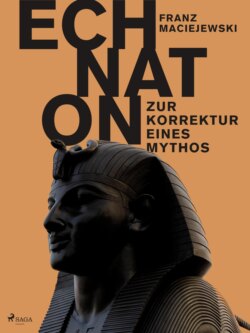Читать книгу Echnaton oder Die Erfindung des Monotheismus: Zur Korrektur eines Mythos - Franz Maciejewski - Страница 6
I Der Fluch der bösen Tat 1. König Muršili öffnet ein Fenster
ОглавлениеIn der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung wütet im Lande Hatti, dem auf dem Gebiet des heutigen Anatolien gelegenen Hethiterreich,12 die Pest. Als die Plage nacheinander den eigenen Vater (Šuppiluliuma I.) und Bruder (Arnuwanda II.) dahinrafft, bekennt der in Hattuscha residierende Großkönig Muršili II. – ein Zeitgenosse der beiden letzten Amarnakönige Tutanchamun und Eje – öffentlich seine Seelenpein. Die nicht enden wollende Not lehrt ihn beten. In einem sogenannten »Pestgebet« wendet er sich an den Dynastiegott sowie die übrigen Götter des Landes. In der doppelten Rolle des Königs, der das Leben und Überleben (von Menschen, Tieren und Pflanzen) in seinem Herrschaftsbereich zu schützen hat, und des obersten Priesters, der den Göttern nahe ist und den gesamten Ritualbestand an seiner Seite weiß, bittet er um ein Ende des Unheils.
Wettergott von Hatti, mein Herr, und ihr anderen Götter von Hatti, meine Herren. Es sandte mich Muršili, der Großkönig, euer Diener: Geh und sprich zu dem Wettergott von Hatti, meinem Herrn, und zu den andren Göttern folgendermaßen:
Das ist es, was ihr getan habt: in das Land Hatti habt ihr eine Pest hineingelassen, und das Land Hatti wurde von der Pest überaus hart bedrückt.
Und wie es zur Zeit meines Vaters dahinstarb und zur Zeit meines Bruders und wie es, seit ich Priester der Götter wurde, nun auch vor mir dahinstirbt, das ist nun das zwanzigste Jahr. Und das Sterben, das im Lande Hatti herrscht, und die Pest wird von dem Lande noch immer nicht genommen.
Ich aber werde der Pein im Herzen nicht Herr. Der Angst in der Seele aber werde ich nicht mehr Herr.
Hier hadert kein Hiob mit seinem Schicksal. Wenn Muršili feststellt, dass die Götter die Pest in das Land gelassen haben, dann sind seine Worte von jedem Vorwurf frei. Er weiß die Verhängung des Unheils als Strafaktion einer zürnenden Gottheit zu deuten und er kennt die Voraussetzung, unter der allein eine Wende zum Heil vollzogen werden kann. Die von den Göttern erbetenen Machterweise hängen von der Offenlegung eines verschwiegenen Schuldzusammenhanges ab. Nur so kann der Fluch der bösen Tat aufgehoben werden. Der König befragt deshalb in einem zweiten Schritt das Orakel, um die Schuld herauszufinden beziehungsweise die Schuldigen benennen zu können, deren Handeln den Anlass für den Ausbruch der Pest gegeben hat. Die Auskunft verweist auf zwei »alte Tafeln« mit verbindlichen Vereinbarungen. Die eine verpflichtet das Land zu Opferriten für den Fluss Mala (den Euphrat), die aufgrund der Pest vernachlässigt wurden; die andere handelt von einem Vertrag mit Ägypten, der dem kulturellen Gedächtnis der Hethiter als »Vertrag mit den Leuten von Kuruštama« eingeschrieben ist – ein undurchsichtiger (wahrscheinlich in die Zeit Amenophis’ II. zurückgehender) Vorgang, bei dem »der Sturmgott Söhne des Hatti-Landes gepackt und sie nach Ägypten geführt hatte und sie hatte Ägypter werden lassen«. Dieser eidlich besiegelte Freundschaftsvertrag – der kleine Vorläufer des großen paritätischen Staatsvertrages, den Ramses II. und Huttuschili III. anderthalb Jahrhunderte später miteinander geschlossen haben – erklärt unter anderem, warum Muršilis Vater »seinem Bruder« Amenophis IV.-Echnaton anlässlich der Thronbesteigung gratulierte (wie wir aus einem der berühmten Amarna-Briefe wissen). Anderthalb Jahrzehnte später wurde der Vertrag jedoch von demselben Šuppililiuma verletzt, und zwar unmittelbar vor Ausbruch der Pest.
Der Sturmgott von Hatti brachte die Leute von Kuruštama nach Ägypten und schloss einen Vertrag über sie mit den Hethitern, so dass sie ihm unter Eid standen. Obwohl nun sowohl die Hethiter als auch die Ägypter dem Sturmgott eidlich verpflichtet waren, ignorierten die Hethiter ihre Verpflichtungen. Sie brachen den Eid der Götter. Mein Vater sandte Truppen und Wagen, das Land Amqa, ägyptisches Gebiet, anzugreifen. Die Ägypter aber erschraken und baten sogleich um einen seiner Söhne, das Königtum zu übernehmen. Aber als mein Vater ihnen einen seiner Söhne gab, töteten sie ihn, während sie ihn dorthin brachten. Mein Vater ließ seinem Zorn freien Lauf, er zog gegen Ägypten in den Krieg und griff es an. Er schlug die Truppen und Streitwagen des Landes Ägypten. Der Sturmgott von Hatti, mein Herr, gab meinem Vater durch seinen Ratschluss den Sieg; er besiegte und schlug die Truppen und Wagen des Landes Ägypten. Aber als sie die Gefangenen nach Hatti brachten, brach eine Pest unter ihnen aus, und sie starben.
Als sie die Gefangenen nach Hatti brachten, brachten diese Gefangenen die Pest in das Land Hatti. Von dem Tage an sterben die Menschen im Lande Hatti. Als ich nun die Tafel über Ägypten gefunden hatte, ließ ich darüber das Orakel befragen: »Diese Vereinbarungen, die der hethitische Sturmgott machte, nämlich dass die Ägypter ebenso wie die Hethiter vom Sturmgott unter Eid genommen wurden, dass die Damnassaras Gottheiten im Tempel anwesend waren, und dass die Hethiter sogleich ihr Wort gebrochen hatten – ist das vielleicht der Grund für den Zorn des Sturmgottes von Hatti, meines Herrn?« So wurde es bestätigt.
Was Muršili hier liefert, ist nicht weniger als die Eröffnung eines sakralrechtlichen Verfahrens.13 Mit einer (wie immer fragmentarischen) Rekonstruktion der relevanten Ereigniskette wird einerseits die moralische Schlussfolgerung, dass Unheil auf Schuld beruht, konkret belegbar; andererseits ist ein Ausweg aus der Notlage in Sicht. Der Zusammenhang von Tun und Ergehen liegt in der Hand der Götter, die Menschen können ihn aber erkennen und durch Sühneriten beeinflussen. Der Krieg Hattis gegen Ägypten stellt offensichtlich einen eklatanten Vertragsbruch dar. Mit dieser politischen Sünde hat der verantwortliche hethitische Herrscher, König Šuppiluliuma, den Zorn der Götter heraufbeschworen und den Ausbruch der Pest verschuldet. Muršili zögert nicht, ein umfassendes Sündenbekenntnis abzulegen, das bemerkenswert vor allem deshalb ist, weil es beim Schuldvorwurf an den Vater nicht stehen bleibt, sondern ausdrücklich die eigene Schuldübernahme einschließt. Natürlich ist beider Schuld nicht Sache der privaten Biographie, sondern des offiziellen Regierungshandelns, dessen Folgen und Nebenfolgen auf den jeweiligen Amtsnachfolger übergehen. Im Lichte der Staatsräson ist das skrupulöse Verhalten, das König Muršili an den Tag legt, deshalb auch nicht ruinös (im Sinne von rufschädigend), sondern im Gegenteil staatstragend, weil Schaden vom Lande abwendend.
Hattischer Wettergott, mein Herr, und ihr Götter, meine Herren, es ist so: Man sündigt. Und auch mein Vater sündigte und übertrat das Wort des hattischen Wettergottes, meines Herrn. Ich aber habe in nichts gesündigt.
Es ist aber so: Die Sünde des Vaters kommt über den Sohn. Auch über mich kam die Sünde des Vaters.
Ich habe sie nunmehr dem hattischen Wettergott, meinem Herrn, und den Göttern, meinen Herren, gestanden: Es ist so, wir haben es getan. Und weil ich nun meines Vaters Sünde gestanden habe, soll sich dem hattischen Wettergott, meinem Herrn, und den Göttern, meinen Herren, der Sinn wieder besänftigen.
Seid mir wieder freundlich gesinnt und jaget die Pest wieder aus dem Lande Hatti hinaus.
Abb. 6: Eine in Boghazköy gefundene Tontafel
Das umfassende Schuldeingeständnis ist Bedingung für die ersehnte Rettung, und die Durchführung der Sühneriten sind der einzuschlagende Weg zum Heil. Aber wie absichtslos hat das Leiden und die Anstrengung, es zu überwinden, noch eine andere Funktion erfüllt. Die Schuld ist zum Auslöser von Erinnerungsarbeit und Vergangenheitsrekonstruktion geworden. Wir sehen Muršili nicht nur beten und beichten, er berichtet auch nach Art eines antiken Polyhistors, das heißt: Er schreibt Geschichte. Im Zeichen der Schuld wird die Sinngeschichte der eigenen Taten lesbar – und die der beteiligten anderen. So wie die Pest naturgemäß nicht an den Grenzen des hethitischen Machtbereichs Halt gemacht hat, so ist auch die hethitische Geschichtsschreibung grenzüberschreitend. Zentrale Glieder der rekonstruierten Ereigniskette sind die Züge und Gegenzüge der ägyptischen Seite; darunter das mysteriöse Unternehmen, einen hethitischen Prinzgemahl auf den Thron zu bringen – und die Vereitelung dieses Vorhabens durch dessen Ermordung. En passant nehmen wir Einblick in eine alle Tradition sprengende Affäre, über die wir aus ägyptischen Quellen nie etwas erfahren hätten – und welche die (an spektakulären Episoden nicht eben arme) Amarnazeit in ein neues grelles Licht taucht. Aber die Andeutungen in dieser heiklen Sache bleiben zunächst durchaus schemenhaft. Nun hat die hethitische Geschichtsschreibung in einer anderen literarischen Gattung, den Annalen, ihr wahres Zuhause gefunden. Durch einen glücklichen Umstand ist aus dem Fundus des Tontafelarchivs von Boghazköy, dem modernen Grabungsort auf dem Gebiet der alten Hauptstadt Hattuscha, der Bericht über die Mannestaten des Šuppiluliuma erhalten geblieben. Der Text, dessen Autor wiederum Muršili ist, schildert auf seiner siebten Tafel die gleichen Vorgänge aus einer anderen Perspektive und mit anderen stilistischen Mitteln. Im Unterschied zu den Pestgebeten werden in diesem Rechenschaftsbericht die militärischen und diplomatischen Verwicklungen zwischen dem hethitischen und dem ägyptischen Hof detailliert und nuanciert geschildert – unter Nennung der Namen der beteiligten Personen.
Während mein Vater unten im Lande Karkemisch war, sandte er Lupakki und Tarhundaz-alma in das Land Amqa. Sie zogen los und griffen Amqa an und brachten Gefangene, Rinder (und) Schafe zurück vor meinen Vater. Als aber die Ägypter vom Angriff auf Amqa erfuhren, bekamen sie Angst. Und da zudem ihr König Nipchururija gestorben war, schickte die Königin von Ägypten Dahamunzu (Gemahlin des Königs) einen Boten zu meinem Vater und schrieb ihm wie folgt:
»Mein Gemahl ist gestorben, und ich habe keinen Sohn. Man sagt aber, dass deine Söhne zahlreich sind. Wenn du mir einen deiner Söhne gibst, so wird er mein Gemahl sein. Niemals werde ich einen meiner Diener zum Gatten nehmen.«
Als mein Vater das hörte, rief er die Edlen zur Beratung zusammen und sprach zu ihnen: »Eine solche Geschichte ist mir in meinem ganzen Leben nicht vorgekommen!« Da schickte mein Vater den Kanzler Hattusaziti nach Ägypten (und sagte zu ihm): »Geh und bring mir die Wahrheit zurück. Vielleicht wollen sie mich täuschen. Vielleicht haben sie (doch) einen Sohn des Königs. Bring mir die Wahrheit zurück!« Als der Frühling kam, kehrte Hattusaziti aus Ägypten zurück, und der Edle Hani kam als ägyptischer Bote mit ihm. Da mein Vater, als er Hattusaziti nach Ägypten geschickt hatte, ihm den folgenden Auftrag gegeben hatte: »Vielleicht haben sie einen Sohn ihres Königs. Vielleicht wollen sie mich täuschen und wünschen sich nicht meinen Sohn, um ihn zum König zu machen«, antwortete die Königin Ägyptens meinem Vater auf einer Schreibtafel mit diesen Worten:
»Warum sprichst du in dieser Weise: Sie wollen mich täuschen? Wenn ich einen Sohn hätte, würde ich dann an eine ausländische Macht schreiben? Es ist eine Schande für mich und mein Land. Du hast mir nicht getraut und hast auf solche Weise zu mir gesprochen. Der mein Gemahl war, ist gestorben, und ich habe keinen Sohn. Niemals werde ich einen meiner Diener zum Gatten nehmen. Ich habe an kein anderes fremdes Land außer dir geschrieben. Man sagt, deine Söhne seien zahlreich. Gib mir einen deiner Söhne. Für mich wird er mein Gemahl sein und für Ägypten wird er König sein.«
So war mein Vater, da er in guter Stimmung war, bereit, die Anfrage der Frau zu erwägen, und beschäftigte sich mit der Frage des Sohnes.
Die Geschichtsdaten aus den Annalen Šuppiluliumas sind erstaunlich detailliert und präzise, wenngleich nicht ohne Vorgeschichte.14 Übertragen wir sie in den rudimentären historischen Prospekt, wie er in den Ritualtexten (vor allem dem zweiten Pestgebet des Muršili) zum Vorschein gekommen ist, so lässt sich folgende dichte Beschreibung der Ereigniskette rekonstruieren:
1 Šuppiluliuma entsendet Truppen unter Führung zweier Generäle gegen das ägyptische Amqa. Nach dem Untergang des Mitanni-Reiches stehen sich damit die Großmächte Ägypten und Hatti zum ersten Mal unmittelbar feindlich gegenüber.
2 Die ungünstige militärische Lage (Niederlage bei Qades und hethitischer Einfall in Amqa) erfährt durch den plötzlichen Tod von Pharao Nipchururija eine krisenhafte Zuspitzung.
3 Die verwitwete Königsgemahlin (t3 hm.t njsw.t = Dachamunzu) eröffnet mit einem Schreiben an Šuppiluliuma den Weg zu einer diplomatischen Heirat; sie bittet um einen hethitischen Prinzen als Gemahl und Nachfolger für den verstorbenen ägyptischen König.
4 Šuppiluliuma reagiert abwartend und schickt zur Klärung der näheren Begleitumstände seinen Gesandten Hattusaziti nach Ägypten. Nach längerem Aufenthalt kehrt dieser in Begleitung des ägyptischen Gesandten Hani, der ein erneuertes Heiratsschreiben seiner Herrin überbringt, nach Hatti zurück.
5 Šuppiliulumas Bedenken scheinen ausgeräumt. Er konsultiert einen alten Vertrag mit Ägypten und erteilt dem Heiratsplan schließlich seine Zustimmung.
6 Prinz Zannanza, der auserwählte Heiratskandidat unter den Söhnen Šuppiliulumas, begibt sich auf den Weg nach Ägypten; er fällt jedoch einer ägyptischen Intrige zum Opfer und wird unterwegs ermordet.
7 Šuppiliuluma nimmt die Ermordung seines Sohnes zum Anlass für einen Rachefeldzug und gewinnt eine erste Schlacht.
8 Ägyptische Gefangene schleppen die Pest in Hatti ein, die dort mehr als zwanzig Jahre wüten sollte. Šuppiliuluma selbst und sein Sohn (und kurzzeitiger Nachfolger) Arnuwanda fallen der Seuche zum Opfer.
9 Muršili übernimmt die hethitische Regierung im Schatten der Pest; er rollt das gesamte Geschehen im Sinne eines Schuldzusammenhangs neu auf.
Die komplexe Handlungs- und Ereigniskette beginnt zu einer Zeit, wo Muršili, wie er in den Texten selber bekennt, »noch ein Kind war« (ca. 1335). Als bilanzierender Staatsmann und erster Priester der Götter steht Muršili II. an deren Ende (ca. 1313). Es ist jene historische Bruchstelle, die durch die 20-jährige Seuche markiert wird und dazu geführt hat, dass die militärischen Aktionen auf beiden Seiten für eine gewisse Zeit tatsächlich zum Erliegen kamen. Leiden und Schuld haben, wie gesehen, die hethitische Geschichtsrekonstruktion in Gang gesetzt und nicht etwa ein besonderer historischer Sinn. »Wann hat es angefangen? Womit? Wie hat es sich zur Katastrophe auswachsen können? Wer war schuld? Welcher Gott zürnt? Womit kann man ihn versöhnen?« – das sind, in den Worten von Assmann, die leitenden Fragen hinter der öffentlichen Selbstthematisierung des hethitischen Großfürsten.
Unser Interesse ist ein anderes. Durch das Fenster, das König Muršili geöffnet hat und das die Amarnazeit schlagartig als Zeit einer dramatischen außen- wie innenpolitischen Krise erscheinen lässt, blicken wir mit anderen Augen. Und folglich stellen wir andere Fragen: Wer war König Nipchururija? Welche Gestalt verbirgt sich hinter der sogenannten Dachamunzu? Welche Frau hatte die Macht, gegen alle Tradition die Heirat mit einem ausländischen Prinzen in die Wege zu leiten? Hätte die diplomatische Heirat den Fortbestand der Dynastie gefährdet? Welche Kreise verbergen sich hinter dem Komplott, dem der erwählte Prinzgemahl zum Opfer fiel? Geben ägyptischen Quellen irgendeinen Hinweis auf eine Krise der Thronfolge und einen nachfolgenden Machtkampf?
Die Beantwortung dieser Fragen, das liegt auf der Hand, ist für ein Sinnverstehen der Amarnazeit von allergrößter Wichtigkeit. Es wäre jedoch voreilig, die skizzierte hethitische Geschichtsepoche auf eine bloße Vorgeschichte zur Aufarbeitung der uns eigentlich interessierenden ägyptischen Geschichte zu reduzieren – und hier abzubrechen. Das heißt, wir dürfen in Muršili nicht allein den unbeteiligten Dritten und bloßen Zuträger eines rein innerägyptischen Rätsels sehen. Zum einen finden sich viele Züge der hethitischen Geschichtsschreibung auch in anderen Teilen der spätorientalischen Welt, in Ägypten nicht anders als in Mesopotamien, historisch später dann in Israel und schließlich Griechenland. Was in der späten Bronzezeit seinen Anfang nimmt und in den hethitischen Texten zuerst in größerem Umfang greifbar wird, ist Teil eines allgemeineren interkulturellen Sinnhorizontes. Er wird später ausdrücklich beleuchtet werden. An dieser Stelle ist zunächst etwas anderes entscheidend. Das sakralrechtliche Verfahren des Muršili ist nicht nur der erste Glanzpunkt einer allgemeinen Entwicklung, es hat darüber hinaus paradigmatische Kraft. Mit ihm tritt die Grundfigur einer schuldabtragenden Vergangenheitsbewältigung ins Relief, die uns in anderen Kulturen wiederbegegnet – nicht zuletzt in Gestalt der griechischen Ödipus-Sage. (Erscheint der vor das klagende Volk tretende thebanische König, der angesichts einer von den Göttern verhängten Pest die jüngste Vergangenheit der Stadt aufrollen lässt, nicht geradezu als ein Wiedergänger des hethitischen Königs?) Herzstück ist jedes Mal das In-Beziehung-Setzen eines aktuellen Unheils – Pest, Seuche, Hungersnot – zu einem vergangenen, aber unabgegoltenen Unrecht oder Verbrechen. Die den göttlichen Zorn erregende Untat bleibt so lange verborgen, bis die Gottheit eine zweite Not schickt, die zum Himmel schreit. Dies ist der bekannte Topos der »späten Entdeckung«. Erst die göttliche Strafaktion führt zur Besinnung, dazu, dass der Fall, über den schon das Gras wuchs, neu aufgerollt und die Tat entsühnt werden kann. In dieser nachträglich in Gang gesetzten Vergangenheitsrekonstruktion wird die aktuelle Plage zum Zeichen für einen verdeckten Frevel ganz anderer Art. Die Götter bedienen sich typischerweise einer Naturkatastrophe, das inkriminierte Faktum ist dagegen immer ein sozialer Tatbestand: die Verletzung der heiligen Ordnung, von Recht und Gerechtigkeit, ägyptisch der »Maat«. Die genaue Referenz zwischen beiden ist das Problem; sie ist alles andere als eindeutig, weil kulturell codiert. Der skrupulöse Muršili sucht die Schuld bei sich selbst (resp. seinem Vorgänger und Vater Šuppiluliuma) und findet sie im Überfall auf ägyptisches Gebiet. Für uns als Beobachter hätte es viele gute Gründe gegeben, die Ägypter zu beschuldigen: des Angriffs auf Qades, der Ermordung des Zannanza, des Einschleppens der Pest. Aber im Selbstverständnis der hethitischen Kultur ist der Vertragsbruch das Urmodell der Sünde. Andere Kulturen mit weniger ausgeprägter politischer Moral, so dürfen wir schlussfolgern, hätten bei gleichem Anlass eine andere Schuldzuweisung getroffen, das heißt, das göttliche Zeichen anders gedeutet.
Das führt zum zweiten Punkt. In der in Rede stehenden Plage, der wir die Pestgebete des Muršili verdanken, haben wir mit Sicherheit kein isoliertes Ereignis hethitischer Geschichte vor uns. Wie die Annalen berichten, haben ägyptische Gefangene die Pest in Hatti eingeschleppt. Damit kann aber gerade nicht das anatolische Kernland gemeint sein, sondern in erster Linie das umkämpfte syrisch-kanaanäische Gebiet. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat sich die Pest von dort auf die Nachbarländer (unter Einschluss Ägyptens) ausgebreitet und nach und nach im gesamten Vorderen Orient gewütet. Wie ist sie in diesen Ländern erinnert worden? Gibt es Quellen, die mit den hethitischen Dokumenten vergleichbar sind? Hat es Versuche gegeben, die Heimsuchung durch die Seuche in ähnlicher Weise auf schuldhaftes menschliches Verhalten zurückzuführen? Welche zürnenden Götter treten auf, welche werden um Rettung angerufen?15 Dies ist ein Fragenkatalog ganz anderer Art. Von seiner Beantwortung hängt es ab, ob wir die Zwillingsgestalt von »Schuld und Plage« für ein konstitutives Element der Überlieferungsgeschichte von Amarna in Anspruch nehmen dürfen, das sich in all seinen Sedimentschichten nachweisen lässt, oder doch eher für den Ausdruck eines besonderen Rechtsbewusstseins der hethitischen Kultur halten müssen, das durch die Laune des Zufalls in die Nähe von Amarna gerückt worden ist.
Für die Vermutung, dass die Pestepidemie die ganze vorderasiatische Welt heimgesucht hat, sprechen mindestens vier Belegstellen aus den Amarnabriefen.16 In einem an König Amenophis IV.-Echnaton gerichteten Schreiben (EA 35) entschuldigt sich der König von Alaschia (Zypern) für eine doppelte Unbill, die geringe Menge gelieferten Kupfers sowie das Ausbleiben (Ableben?) eines ägyptischen Gesandten. In beiden Fällen handele es sich nicht um die Nachlässigkeit des Hofes oder gar um eine böse Absicht, beteuert der (um die Aufrechterhaltung guter Handelsbeziehungen bemühte) Monarch; vielmehr habe der Pestgott Nergal seine Hände im Spiel.
Dass das Kupfer so wenig ist, kein Kummer komme darüber in dein Herz! Denn in meinem Land hat die Hand Nergals, meines Herrn, alle Menschen meines Landes getötet, und so ist keiner da, der Kupfer bereitete.
Mein Bruder, in dein Herz komme kein Kummer darüber, dass dein Bote drei Jahre in meinem Land geblieben ist; denn die Hand Nergals ist auf meinem Land und auf meinem Hause. Meine Frau hatte einen Sohn, der jetzt tot ist, mein Bruder.
Wahrscheinlich um dieselbe Zeit – der kanadische Ägyptologe Redford datiert EA 35 in die Nähe des fünften Regierungsjahres von Amenophis IV.-Echnaton – wütete die Seuche entlang der phönizischen Küste. Einer der lokalen Stadtfürsten, Rib-Addi von Byblos, meldet die Pest mit den Worten: »Die Leute von Simyra dürfen nicht in meine Stadt kommen; es herrscht Pest in Simyra« (EA 96). Wenig später, nach dem Fall von Simyra, tragen Flüchtlinge die Pest dennoch nach Byblos, der für Ägypten von alters her wichtigsten Handelsmetropole in der Region. Rib-Addi versucht entsprechende Nachrichten gegenüber dem ägyptischen Hof herunterzuspielen, jetzt wohl seinerseits aus Furcht vor Isolierung, einer drohenden Quarantäne von Menschen und Waren (Zedernholz aus dem Libanon und Papyrus aus Ägypten); aber seine abwiegelnden Worte klingen wenig überzeugend:
Sie versuchen Ärger zu machen, indem sie vor dem König sagen: »Der Tod ist in der Stadt«. Möge der König, mein Herr, diesen Worten keinen Glauben schenken. Es gibt keine Pest im Land.
Abgeschnitten vom Hinterland wie zuvor Simyra hat Byblos die Seuche möglicherweise über den Seeweg weitergetragen – nach Norden. Jedenfalls hören wir im Brief König Niqmaddus II. (EA 49) von der Erkrankung von Mitgliedern der königlichen Familie von Ugarit in Nordsyrien. Schließlich ist laut EA 11 auch die für eine diplomatische Verheiratung mit Echnaton auserwählte babylonische Königstochter – König Assuruballit erwähnt sie zuvor in EA 16 – an der Seuche gestorben. Die beiden letzten Nennungen bezeugen die breitgestreute Auswirkung der Epidemie in der Zeit der ausgehenden Regierung Echnatons. Hier schließt sich der Kreis, denn dies ist die Zeit der ägyptisch-hethitischen Kämpfe, in deren Verlauf die Pest nach Hatti übergreift – wie uns König Muršili zwanzig Jahre nach dem Ereignis berichtet.
Wir haben eine Nachrichtenkette rekonstruiert, die es gestattet, die Ausbreitung der Plage über das Gebiet des gesamten östlichen Mittelmeerraums und für einen Zeitraum von mehr als einer Generation (etwa von 1348 bis 1313) für realistisch zu halten. Ägypten dürfte die verheerenden Folgen der Epidemie nicht nur an seinen Rändern (der Erkrankung von in Syrien stationierten Soldaten), sondern buchstäblich am eigenen Leibe, das heißt in der Heimat und hier vor allem im unterägyptischen Kernland, erfahren haben. Dafür spricht die frühe Datierung. Schenken wir den Aussagen des Königs von Zypern und des Fürsten von Byblos Glauben, so ist die Pest nicht erst gegen Ende der Regierung Echnatons, also in den Zeiten des ägyptisch-hethitischen Krieges, sondern bereits Jahre früher ausgebrochen. Es verwundert daher nicht, wenn Autoren wie Helck oder Redford darüber spekulieren, ob nicht die ungewöhnlich hohe Sterblichkeitsrate unter den Mitgliedern der königlichen Familie von Amarna (der frühzeitige Tod von vier Töchtern Echnatons und Nofretetes sowie der noch jugendlichen Könige Semenchkare und Tutanchamun, aber auch der Tod König Echnatons selbst, der nur knapp dreißig Jahre alt wurde) als Folge der Pest zu bewerten sei. Immerhin hatten, wie wir hörten, auch andere Fürstenhöfe – so in Hatti, Ugarit, Zypern und Babylon – Angehörige unter den Pestopfern zu beklagen. Diese medizinhistorische These hat durch eine erst jüngst entdeckte Quelle neue Nahrung erhalten. Seit 2006 wird im wüstenartigen Hinterland von Amarna ein großer Friedhof freigelegt, auf dem die normalen Bewohner der Stadt bestattet wurden, denen ein Felsengrab nicht zustand oder die sich ein solches nicht leisten konnten. Die (Knochen-)Funde sind eindeutig. Sie verweisen auf einen schlechten Gesundheitszustand und eine geringe Lebenserwartung zumindest der einfachen Bevölkerung. In Achetaton wurde jung gestorben, nur wenige wurden älter als Anfang dreißig.17
Abb. 7: Sterbealter von 68 Personen, die auf dem südlichen Friedhof von Achetaton begraben wurden (nach Tietze 2008)
Einige Autoren halten es sogar für möglich, dass schon die außerordentliche Entscheidung, die alte Metropole Theben zu verlassen und in einer unberührten Landschaft eine neue Hauptstadt aus dem Boden zu stampfen, durch das Motiv bestimmt (oder zumindest mitbestimmt) war, angesichts des wahrscheinlichen Überspringens der Epidemie auf die bevölkerungsreichen Zentren Ägyptens einen sicheren Zufluchtsort für den königlichen Hof zu schaffen. Wäre es so gewesen, hätte sich allerdings das Projekt angesichts der vielen Opfer als Fehlschlag erwiesen. Wie auch immer, die zunehmende Alleinverehrung des »lebenden Aton« könnte vor diesem Hintergrund tatsächlich als eine religionspolitische Notstandsmaßnahme verstanden werden, wie sie uns aus anderen Kulturen unter dem Stichwort einer »zeitweiligen Monolatrie« bekannt ist.18 So wurden Marduk, der babylonische Hauptgott, Assur, der Staatsgott der Assyrer, und der hebräische Jahwe in Kriegszeiten zeitweilig zu »göttlichen Kriegern« ausgerufen, denen eine bedingungslose Gefolgschaft zu leisten war – bis die Menschen nach überstandener Krise zur gewohnten Verehrung aller Götter zurückkehrten. Könnte es sein, dass Aton, der Gott mit den fürsorglichen Strahlenhänden, in den Zeiten des großen Sterbens als »Lebensgott« angerufen wurde? War die dogmatische Verhärtung der Kultreform einer wachsenden Angst geschuldet? Ist umgekehrt die Leichtigkeit des Seins, wie sie uns auf zahlreichen Mosaiken und Abbildungen aus Amarna entgegentritt, in Wahrheit Ausdruck eines Tanzes am Abgrund und einer rauschhaften Überbetonung des Hier und Jetzt?
Spekulationen wie diese dürften kaum zu erhärten sein, aber indem sie den Horizont der möglichen Einflussfaktoren, die zum Projekt von Amarna geführt haben, in überraschender Weise erweitern, können sie als Warnung vor allzu voreiligen Festlegungen und Schlussfolgerungen dienen. Ich möchte sie zunächst im Raum stehen lassen und selber vorsichtiger formulieren: Die verheerenden Folgen einer mehr als 30-jährigen Pest müssen nicht nur die Könige von Zypern, Hatti und Babylon sowie die verschiedenen kanaanäischen Stadtfürsten, sondern mit ihnen auch alle Amarnakönige in Atem gehalten haben. Nach der Aufdeckung der Dachamunzu-Affäre, die uns später ausführlich beschäftigen wird, ist das Szenario einer gefährlichen Epidemie das zweite Krisensymptom, das einen dunklen Schatten auf das heitere Amarna wirft. Angesichts der zahlreichen Quellen auf der anderen Seite wäre es erstaunlich, wenn sich ägyptischerseits keine entsprechenden Erinnerungsspuren finden ließen. Um ihre Sichtung und Interpretation soll es jetzt gehen. Betreten wir – nach der hethitischen Ouvertüre – ägyptischen Boden.