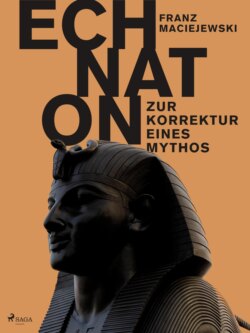Читать книгу Echnaton oder Die Erfindung des Monotheismus: Zur Korrektur eines Mythos - Franz Maciejewski - Страница 7
2. Die kanaanäische Krankheit
ОглавлениеDie im hethitischen Kontext so klar hervortretende Zwillingsgestalt von »Schuld und Plage« ist in der historischen Parallelwelt von Amarna nur nach der Art eines Vexierbildes zu erschließen. Erste Hinweise stammen aus der späten Amarnazeit, womit hier – unbeschadet der Tatsache, dass die beiden letzten Pharaonen dieser Epoche, Tutanchamun und Eje, den Regierungssitz nach Memphis verlegten – die gesamte Nach-Echnaton-Ära (ca. 1335 bis 1315) gemeint ist. Es handelt sich um einige Buß- und Dankpsalmen, in denen sich erste Anklänge einer mentalitätsgeschichtlich neuen Schuldkultur finden lassen.19 Sie gelten deshalb innerhalb der Ägyptologie als frühe Beispiele einer religiösen Strömung, die nach einem Wort von James Breasted als »persönliche Frömmigkeit« bezeichnet wird und erst in der Ramessidenzeit (der auf Amarna folgenden 19. und 20. Dynastie) ihren Höhepunkt erlebte. In älterer Zeit war es üblich, einen Unglücksfall oder eine Erkrankung bösen Geistern oder Feinden zuzuschreiben und zu den Mitteln der Magie und des Abwehrzaubers zu greifen. Nunmehr wurde die Ursache zunehmend in einer Schuld gesucht, die man persönlich und einer bestimmten Gottheit gegenüber auf sich geladen hatte. An die Stelle der magischen Handlung traten das Gebet und die Abbitte an die zürnende Gottheit in der Hoffnung auf Errettung. Mit der neuen Entwicklung erhielt die ägyptische Schuldkultur so etwas wie einen »Sitz im Leben«. Die traditionelle Form war eng mit der ägyptischen Grabkultur verbunden und kannte – als Moment der rituellen Inszenierung des Totengerichts mit der »Wägung des Herzens« im Zentrum – die stereotype Unschuldsbeteuerung, den für das Überleben im Jenseits unabdingbaren Nachweis einer schuldfreien Lebensführung. Diesem »negativen Bekenntnis« (»Ich habe nichts Krummes getan, keinen Tempelbesitz gestohlen, keinen Kornwucher betrieben« etc.) stand damit ein positives Schuldbekenntnis zur Seite. Die rituelle Reinigung, welche den Toten galt, wurde durch die neue Form einer schuldbezogenen Selbstthematisierung, wie wir sie beispielhaft in den Pestgebeten des Muršili kennengelernt haben, überlagert.
Das früheste Zeugnis dieser Art, oder besser deren Vorläufer, ist ein Graffito, der in einer verlassenen Grabkapelle in den thebanischen Bergen entdeckt wurde, im Grab eines gewissen Pere. Die Schrift ist einem Priester und Schreiber namens Pawah (dem Bruder des Grabbesitzers) gewidmet und auf das »Jahr 3« des Königs Anchcheperure-Semenchkare, des Vorgängers des Tutanchaton, datiert (Abb. 8). Die Nennung des Regenten enthält die aus der Königstitulatur geläufige Beifügung »geliebt von Aton«, ein deutlicher Hinweis auf den offiziellen Fortbestand des Aton-Kultes. Gleichwohl – und das ist das Bemerkenswerte an diesem Text – ist sein Adressat der alte, verfemte Reichsgott Amun. Semenchkare hatte offenbar als Zugeständnis an die Opposition in Theben einen dem Amun geweihten Totentempel errichten lassen, in dem Pawah seine Dienste versah.
Mein Herz sehnt sich danach, dich zu sehen.
O Amun, Beschützer des armen Mannes ...
Wende dich uns wieder zu, o Herr der Ewigkeit.
Du warst hier, als noch nichts entstanden war,
und du wirst hier sein, wenn sie gegangen sind.
Du lässt mich Finsternis sehen, die du gibst;
Leuchte mir, dass ich dich sehe!
So wahr dein Ka dauert, so wahr dein schönes Angesicht dauert,
du wirst kommen von fern und geben,
dass dein Diener, der Schreiber Pawah, dich erblickt.
Abb. 8: Das »Pawah-Graffito« in hieratischer Schrift mit hieroglyphischer Transkription (links)
Dies ist der Klagepsalm eines »armen Mannes« an den abwesenden Gott, verfasst in einer Situation der Not. Pawah gehört der demoralisierten Amun-Priesterschaft an, die unter Echnaton verfolgt wurde und erst unter Semenchkare wieder in offizieller Funktion amtieren durfte. Eine Zeit also zwischen Hoffen und Bangen. Pawah spricht eine Bitte aus, enthüllt aber (noch) keinen Schuldzusammenhang. Die Sehnsucht nach Heilung ist eingekleidet in den Wunsch nach dem Anblick des lange verfemten Gottes. Ob dem ein individuelles Geschick oder ein allgemeines Leiden zugrunde liegt, lässt sich letztlich nicht entscheiden. Üblicherweise hat man die Notlage im Sinne einer wirklichen Blindheit gedeutet. Das ist jedoch nicht zwingend. Die Rede von »uns« und »sie« (in Vers 3 und 5) spricht eher für einen kollektiven Kontext. In dieser Deutung erscheint »Finsternis« als eine Metapher für die Abwesenheit resp. Verbannung des Gottes Amun. Wenn es sich so verhielte, stünde implizit die von Echnaton verschuldete Gottesferne im Zentrum der Klage.
Es ist aufschlussreich, einen Text hinzuzuziehen, dessen Autor dem Zentrum der Macht näher gestanden hat, der jedoch ganz ähnliche Bilder und Redewendungen enthält. Dies gilt etwa für die Steleninschrift eines gewissen Hui, der unter Tutanchamun das Amt eines Vizekönigs von Nubien innehatte.
Komm in Gnaden, mein Herr Tutanchamun!
Ich sehe Finsternis, die du bewirkst, Tag für Tag.
Mach mir Licht, dass ich dich sehe,
dann will ich deine Macht verkünden den Fischen im Fluss
und den Vögeln im Himmel.
Ziemlich sicher tritt Hui hier nicht als jemand in Erscheinung, der mit Blindheit geschlagen, sondern der des Anblicks seines Königs, des »lebenden Abbilds des Amun«, beraubt ist. Es ist diese Gottesferne, die wiederum als Finsternis bezeichnet wird. Licht und Finsternis sind in beiden Texten die zentralen Metaphern für die Abwesenheit von jemandem, nach dessen Anblick man sich sehnt. Aber nur im ersten Fall, dem Graffito des Pawah, blitzt etwas von einer Schuld auf, die jene Gottesferne bewirkt haben könnte. Wie ein Schattenriss erkennbar wird dieser noch schemenhaft bleibende Schuldzusammenhang erst auf einer Inschrift des Tutanchamun selbst. Die ihm zugeschriebene Restaurationsstele – wir dürfen als ghostwriter hinter dem Kindkönig den »Gottesvater« Eje vermuten – spricht zweifelsfrei von einer gesellschaftlich verschuldeten Gottesferne, deren Folgen das ganze Land getroffen haben:
Als seine Majestät [Tutanchamun] als König erschien,
da waren die Tempel der Götter und Göttinnen
von Elephantine bis zu den Sümpfen des Deltas ...
im Begriff, vergessen zu werden,
ihre Heiligtümer fingen an zu vergehen,
indem sie Schutthügel geworden waren,
mit Unkraut bewachsen,
und ihre Kultbildräume waren, als wären sie nie gewesen,
ihre Hallen ein Fußweg.
So machte das Land eine Krankheit durch,
und die Götter kehrten diesem Land den Rücken.
Wenn man Soldaten nach Syrien schickte,
die Grenzen Ägyptens zu erweitern,
so hatten sie keinerlei Erfolg.
Wenn jemand einen Gott anflehte,
etwas von ihm zu erbitten,
so kam er nicht.
In diesem Text wird die unheilvolle Gottesferne nicht mit »Finsternis« sondern mit »Krankheit« assoziiert. Nun zählt der Begriff für Krankheit, wie er hier verwendet wird, zur Topik der traditionellen Chaosbeschreibung. Die Inschrift greift an dieser Stelle auf ein literarisches Zitat zurück, das aus den »Prophezeiungen des Neferti« (einem klassischen Text der ägyptischen Literatur) stammt.20 Wird dort die Leidenszeit im Bild der Verkehrung aller sozialen Verhältnisse veranschaulicht (»Der Schwache ist jetzt stark, man grüßt den, der sonst grüßte«), so wird hier die Krise im dramatischen Bild der völligen Abkehr der Gottheiten festgehalten: »Die Götter kehrten diesem Land den Rücken.« Als zeitgenössisches Zeugnis muss die Metapher von der »schweren Krankheit« jedoch auch ein unabweisbares Realitätszeichen getragen haben. Wie wir gesehen haben, wütete in dem von den Göttern verlassenen Land die Pest. Lässt sich diese Verbindung, die zunächst nur als sekundäre Ableitung aus den hethitischen Texten plausibel ist, durch eine innerägyptische Quelle absichern?
Hans Goedicke (1984) hat den erwünschten Nachweis anhand des »Londoner Medizinischen Papyrus«, der in die Regierungszeit des Tutanchamun datiert wird, erbracht. In einer luziden Textinterpretation hat er zeigen können, dass der Papyrus die magische Anrufung zweier Gottheiten enthält, die vor der »Krankheit der Amu« (der Pest) schützen sollen. Amu war im Alten Ägypten die gängige Bezeichnung für die »Asiaten«, so dass wir den Ausdruck mit »asiatische Krankheit« oder regional präziser »kanaanäische Krankheit« übersetzen dürfen – eine Weise der Benennung, die kulturübergreifend bis in unsere Zeit bekannt ist (etwa in der Rede von der »französischen Krankheit« oder der »spanischen Grippe«) und die stets eine Herkunftsvermutung mit einer apotropäischen Abweisung verbindet. Die nähere Spezifizierung des Papyrustextes bringt weitere Klarheit. Die Fürbitte wird in »der Sprache der Keftiu« (Kreter) vorgetragen und richtet sich an zwei nicht-ägyptische Götter (Santas und Kupapa), für die Goedicke einen anatolischen Hintergrund vermutet – womit überraschend (und doch erwartbar) die hethitische Karte im Spiel ist. Die Anrufung der anatolischen Götter macht Sinn, weil die Ägypter die Seuche mit Hatti in Verbindung bringen – wie umgekehrt die Hethiter mit den Ägyptern. Kreta steht dagegen mutmaßlich für das Land, das von der Epidemie aller Wahrscheinlichkeit nach verschont blieb; das Zitieren kretischer Sprache – mutmaßlich handelt es sich um Linear B – soll die Gunst des Verschontwerdens magisch auf die Schutzflehenden übertragen.
Unsere Suche nach einer ägyptischen Reaktion auf die Epidemieerfahrung hat zu einem ersten Ergebnis geführt. Wie für die betroffenen Nachbarländer kann auch für Ägypten »eine eindeutige Betroffenheit über die kanaanäische Krankheit« (Goedicke) festgestellt werden. Mit dieser Vergewisserung im Rücken dürfen wir jener Metapher von der »schweren Krankheit« einen Doppelsinn unterstellen – ganz so, wie dies Jan Assmann in einer prägnanten Schlussfolgerung festgehalten hat: »Wenn man bedenkt, dass am Ende der Amarnazeit eine wirkliche Pest ausbrach, dann ist diese Beschreibung nicht nur metaphorisch zu verstehen.« Das ist nun aber keineswegs so zu interpretieren, als enthalte die Inschrift der Restaurationsstele gleichsam als Subtext den in den hethitischen Texten ausgemachten Zusammenhang von Schuld und Strafe. Ganz im Gegenteil. Der zeitgleiche Londoner Medizinische Papyrus verharrt noch ganz im Kontext ritueller Reinigung; er nährt freilich zugleich den Verdacht, bestimmte Kreise am ägyptischen Hof könnten ein Interesse daran gehabt haben, den sozialen Ursachen- und Schuldzusammenhang der kanaanäischen Krankheit gezielt außer Landes zu lokalisieren und damit zu einer nicht-ägyptischen Angelegenheit zu machen. König Tutanchamun ist jedenfalls kein ägyptischer Muršili; die Idee einer Strafaktion ägyptischer Götter, die mit der Seuche geschehenes Unrecht ahnden, bleibt eigentümlich blass und vage. Das Moment des Unausgeführten zeigt sich am deutlichsten darin, dass die am Auszug der Götter Schuldigen im Stelentext nicht einmal andeutungsweise genannt werden.
Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn wir einen zweiten historischen Text, mit dem die Steleninschrift des Tutanchamun eine verblüffende Ähnlichkeit hat, einblenden. Es handelt sich um die große Inschrift der Königin Hatschepsut am Felsentempel von Speos Artemidos. Vier Generationen vor Amarna in Erinnerung an die Überwindung der Schreckensherrschaft der Hyksos geschrieben, begründet auch sie (als Königin auf dem Pharaonenthron unter besonderem Legitimationsdruck stehend) eine Politik der Restauration und Erneuerung:
Der Tempel der Herrin von Kusa [Hathor]
war zerstört und verfallen,
die Erde hatte sein edles Allerheiligstes verschlungen
und Kinder tanzten auf seinem Dach ...
...
Ich habe wieder aufgebaut, was zerstört war
Seit der Zeit, als die Asiaten Avaris beherrschten,
räuberische Horden unter ihnen.
Sie stürzten um, was gebaut war;
Sie herrschten ohne Re ...
Hier wird das Unheil in ganz ähnlicher Weise als Bruch mit der göttlichen Ordnung beschrieben. Die Klage gilt der Abwesenheit der Gottheit, der Schließung und dem Verfall der Tempel sowie der Einstellung der Kulte. Im Unterschied aber zur Inschrift des Tutanchamun nennt Hatschepsut die Verursacher des Übels beim Namen. In der Rede von den »räuberischen Horden aus Avaris«, die »ohne Re herrschten«, sind die aus Kleinasien stammenden Hyksos eindeutig erkennbar.
Der Grund, warum Tutanchamun und seine Berater ihrerseits die Verantwortlichen mit Schweigen übergehen, ist schnell ausgemacht. Anders als Hatschepsut, die sich selbstbewusst in die Väterreihe der Ahmosiden und Thutmosiden (der natürlichen Feinde der Hyksos also) stellt, ist und bleibt Tutanchamun ein Kind Amarnas. Der im Jahre 3 oder 4 vollzogene spektakuläre Namenswechsel – von Tutanchaton zu Tutanchamun – suggeriert eine Kehrtwendung, die allein schon durch das Zeugnis der Physiognomie – wenn wir uns etwa an den Berliner Kopf des Tutanchamun halten – dementiert wird, denn was wir erblicken, ist nichts anderes als das »lebende Abbild des Echnaton«, seines Vaters (Abb. 9). Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde deshalb diese Büste noch Echnaton zugeschrieben. Auch jenseits des Augenscheins, gewissermaßen zwischen den Zeilen der Hieroglypheninschrift, hat diese Aussage Gültigkeit. So ist schwerlich die Mehrdeutigkeit zu übersehen, die darin besteht, dass die religiös konnotierte Vater-Metapher der Steleninschrift (»Da erschien Seine Majestät auf dem Thron seines Vaters«) zwar der Anrufung des Vaters Osiris gilt, aber immer auch mit der Beziehung zum verstorbenen Vatergott Echnaton spielt. Noch eindeutiger weisen Teile der Grabausstattung den verstorbenen Tutanchamun als Amarnakönig aus. So trug die Mumie des Königs eine perlenbestickte Kappe, welche die Kartuschen des Gottes Aton zeigen, der als Strahlenaton ebenso die Rückenlehne eines beigegebenen Goldthrones ziert. Tutanchamun ist Teil des Schuldzusammenhangs, der aufgebrochen werden soll; er selber verkörpert den Gräuel. Mit ihm als Galionsfigur ist der offene Bruch mit der Politik von Amarna nicht wirklich zu vollziehen. Deshalb trägt die Restaurationsstele alle Anzeichen einer Kompromissbildung. Sie ist als zeitgenössisches Dokument von großer Deutlichkeit und belässt doch alles im Zwielicht von Andeutungen. Der kryptische Umgang mit der Amarna-Erinnerung, der – wie sich zeigen wird – die gesamte Gedächtnisgeschichte durchzieht, hat hier seinen Ursprung. Und schemenhaft ist zu erkennen, wie das Unbewusste in der Kultur Ägyptens dieses Dilemma »nutzt«, um nach einem anderen historischen Referenzrahmen Ausschau zu halten, dem das Gedächtnis von Amarna eingeschrieben werden kann.
Abb. 9: Büste von König Tutanchamun
Natürlich wird man an dieser Stelle fragen müssen, warum der wirklich starke Mann im Staate, der militärische Befehlshaber Haremhab, nicht schon in jenen Tagen die Zügel der Macht selbstbewusst in die Hand genommen hat. Ganz offensichtlich war es zu einem Staatsstreich noch zu früh. Zwar wirft die Figur des Haremhab mit dem so ungewöhnlichen wie anmaßenden Titel »Stellvertreter des Königs« einen bedrohlichen Schatten in Richtung des Zentrums der Macht; aber der General ist selber von Amarna kontaminiert. Er hat nicht nur seine militärische Karriere unter der Regierung Echnatons begonnen21, er muss auch wie kein anderer für die außenpolitischen Misserfolge der Amarna-Zeit seinen Kopf hinhalten. Erstaunlicherweise hält die Restaurationsstele des Tutanchamun dieses Faktum ungeschminkt fest – eine Eingebung, die man auf Eje, den mächtigen Gegenspieler, beziehen möchte. Mit der Erwähnung der erfolglosen Kämpfe an der Nordgrenze Ägyptens wird die Erinnerung an die militärische Niederlage gegen die Hethiter wachgerufen. Die aber ist, wie wir gesehen haben, entscheidend mit dem Ausbruch der Pest verbunden, denn die Dezimierung des ägyptischen Expeditionscorps durch die Seuche dürfte den Verlauf der Auseinandersetzungen nicht unerheblich beeinflusst haben. Ein weiteres Mal bestätigt sich die Mehrdeutigkeit im Begriff der »Krankheit«: Amarna wird heimgesucht von der Plage der Pest und ist insgeheim selber eine Plage.
Die Machtübernahme der Militärs musste warten, bis sich die Lage an der Front entspannt – und möglicherweise die Pestepidemie ihren Höhepunkt überschritten hatte. Haremhab, heißt das, musste mit Eje einen weiteren Amarna-König an sich vorbeiziehen lassen; keinen beliebigen übrigens, sondern den letzten Vertreter des Hauses Juja, einen ausgewiesenen Exponenten des Aton-Kultes, denn es ist (wie bereits erwähnt) die Grabanlage Ejes, die uns den berühmten Sonnengesang in seiner langen Fassung überliefert hat. Als Haremhab im Jahre 1315 endlich den Thron besteigt, besteht einer der ersten hoheitlichen Akte darin, die Restaurationsstele des Tutanchamun zu usurpieren. Er lässt in die ausgehackten Kartuschen des Amarna-Königs seinen eigenen Thronnamen einsetzen, die Inschrift bleibt aber ansonsten unverändert. Haremhab schreibt die Geschichte nicht neu – auch er kein Muršili, der die Pest als Strafe des Amun für den Frevel des Echnaton zu deuten wüsste: als Fluch der bösen Tat. Ein bemerkenswerter Befund, denn ein Blick in die Geschichte liefert uns ganz andere Beispiele. So hat die 12. Dynastie das Gedächtnis der chaotischen Ersten Zwischenzeit (ca. 2150 bis 2040 v.u.Z.) für die Zwecke einer dauerhaften Konsolidierung des Mittleren Reiches in Anspruch genommen. Demgegenüber wird die Amarnazeit gerade nicht »als Chaoserfahrung stilisiert, um die Militärherrschaft des Haremhab und der von ihm zu Nachfolgern berufenen Offiziersfamilie aus Sile als Heilswende zu legitimieren« (Assmann). Die Politik der Ramessiden, der Haremhab den Weg ebnete, vollzieht sich in den alten Bahnen der Gründungssemantik des Neuen Reiches. Nicht der innere Feind wird beschworen; nach dem Muster des Befreiungskampfes gegen die Hyksos geht es um die Abwehr und Unterwerfung des »asiatischen Feindes«, der sich jetzt in Gestalt der Hethiter zeigt. Die Einschätzung eines feindseligen Verhältnisses zwischen Ägypten und Hatti wurde übrigens von der Gegenseite geteilt, wie aus einem Schreiben des Muršili an den Fürsten Duppi-Teschub von Amurru hervorgeht: »Dein Vater brachte Tribut nach Ägypten; du selbst aber sollst ihn nicht nach Ägypten bringen, denn Ägypten ist ein Feind.« Dass in diesem Assoziationsfeld die »asiatische Krankheit« einen bestimmten Platz einnimmt, wird man kaum für zufällig halten dürfen. Tatsächlich wird die Erinnerung an Amarna genau in Richtung auf die Ursprungserfahrung der Invasion aus dem Norden verschoben. Es ist, als würde der »Feind von Amarna« hinter dem Bild von den »asiatischen Feinden« unsichtbar. In einigen der überlieferten Narrative der Hyksos-Erinnerung ist die Amarnaerfahrung indes in verstellter Form nachweisbar und als Subtext lesbar.
Ein instruktives Beispiel einer solchen Verschiebung findet sich auf einem ramessidischen Papyrus der 19. Dynastie dokumentiert. Es handelt sich um die berühmt gewordene Erzählung vom Streit zwischen dem Hyksoskönig Apophis und dem thebanischen Gaufürsten Sekenenre, von der in einem späteren Kapitel noch ausführlicher die Rede sein wird. An dieser Stelle genügt der Hinweis, dass die Legende, die vordergründig eine Rückerinnerung an den Vorabend des thebanischen Befreiungskampfes gegen die Hyksos verarbeitet, ein auffälliges religionspolitisches Kolorit trägt. So heißt es von König Apophis, »er machte sich den Seth zum Herrn. Er diente keinem Gott im ganzen Land außer dem Seth«. Diese Aussage bedeutet nicht weniger, als den Hyksosherrscher mit einer monolatrischen Gottesverehrung in Verbindung zu bringen. Diese Behauptung ist aber historisch unhaltbar; zwingend ist dagegen der Umkehrschluss, den Jan Assmann aus dem gedächtnisgeschichtlichen Verwirrspiel gezogen hat: »Die ortlos gewordenen Amarna-Erinnerungen hefteten sich an die Hyksos und ihren Gott Baal, der dem ägyptischen Gott Seth gleichgesetzt wurde.« In diese Richtung weisen auch andere Reminiszenzen. So hat der Bau des zentralen Tempels in unmittelbarer Nachbarschaft zum Palast (im Text »Haus des Königs Apophis« genannt) sein Vorbild ganz offensichtlich in Achetaton, der Amarna-Metropole.
Bedeutet das nun, dass allein diese Rückschau (der »Amarna-Blick« sozusagen) die Konfrontation mit den Hyksos in einen religiösen Konflikt umgedeutet hat? So weit dürfen wir nicht gehen. Sicherlich ging ein mächtiger Anstoß von dem aus, was (noch unscharf) mit dem »Trauma von Amarna« zu bezeichnen wäre. Aber die erwähnte Inschrift der Hatschepsut belegt zweifelsfrei, dass die Tradition die verhassten Asiaten lange vor Amarna mit Vorstellungen einer religiösen Differenz zu verbinden wusste. Der Hinweis »... sie herrschten ohne Re« lässt sich zwanglos auf den gleichen Sachverhalt, die frevelhafte Abkehr vom Pfad des traditionellen Kultus des Re-Harachte, beziehen. Dann aber steckte in der Erzählung vom Streit zwischen Apophis und Sekenenre auch das Moment eines gedächtnisgeschichtlich aufbewahrten Déjà-vu. In der Monolatrie-Variante läge eine amarnaspezifische Umarbeitung vor; im Bericht vom Bruch mit der rituellen Ordnung käme ein Stück Wiedererinnerung zum Zuge. Die aufgedeckte Erinnerungsspur macht es glaubhaft, dass die Hyksos nicht nur als fremde Invasoren den Hass auf sich zogen, die das Land tributpflichtig machten, sondern ebenso in der Gestalt der kultisch Unreinen. Der Hinweis auf die Titulatur der Hyksoskönige – einige von ihnen führen Re in ihrem Namen – steht dem nicht entgegen; er zeigt den Vorgang einer formalen Ägyptisierung an, nicht mehr.
Unsere Argumentation erfährt eine nicht geringe Bekräftigung durch die Verwendung des Begriffs der Plage zur Kennzeichnung der eingetretenen Katastrophe. Im Text des Papyrus heißt es: »Die Plage herrschte in der Stadt der Asiaten [Stadt des Re (?)], denn König Apophis saß in Avaris.« Die Erzählung scheint an dieser Stelle in bemerkenswerter Weise zwischen Avaris, dem Herrschersitz der Hyksos, und der »Stadt des Re« zu differenzieren. Schon Gustave Maspero (1911), der »les Impurs de la ville de Ra« liest, hat die Stadt mit Heliopolis, der alten Sonnenstadt, identifiziert. Einem weit gefassten Verständnis nach umfasst »Plage« die demütigende Hyksosherrschaft insgesamt; in einem engeren Sinne könnte der Begriff die Entweihung der alten Sonnenstadt Heliopolis meinen, die – anders als Theben – im unmittelbaren Einflussgebiet der Hyksoskönige lag. Hier ist die Plage als Travestie der Religion fassbar. In dieser Zuspitzung wird die (den gesamten Text strukturierende) geopolitische Gegnerschaft »Avaris/Nordstadt vs. Theben/Südstadt« als religiöser Konflikt lesbar: »Stadt der Unreinen/Heliopolis vs. Stadt der Reinen/Theben«. Diese interkulturelle Radikalisierung erfährt der Hyksoskonflikt aber sicherlich durch die intrakulturelle Erfahrung mit der historisch jüngeren »Gegenreligion« des Echnaton. Die analogiestiftende Folie, die jener älteren Erinnerungsfigur unterlegt ist, enthält als Kennung das Gegensatzpaar »Achetaton/die neue Sonnenstadt vs. No-Amun/Theben/das südliches Heliopolis«. Die hier aufscheinende Strukturähnlichkeit – und das heißt zugleich: nicht die Identität der historisch divergenten Sinnformationen – ist die Klammer, welche die Hyksos-Erinnerung so eng an die Amarna-Erinnerung anbindet. Es sind Analogien dieser Art, mit denen das kulturell Unbewusste auf der Suche nach der verlorenen Zeit, die selber nicht beim Namen genannt werden darf, arbeitet.
Am semantischen Potential von »Plage« lässt sich die Linie einer eigensinnigen Formatierung der Hyksos-Erinnerung noch weiter ausziehen. Goedicke hat in der zitierten Arbeit über die »kanaanäische Krankheit« darauf hingewiesen, dass sich der ägyptische Erstbeleg für den Ausbruch einer Pest im medizinischen Papyrus Hearst findet, der gemeinhin in die Zeit von Amenophis I. (gegen Ende des 16. Jahrhunderts v.u.Z.) datiert wird. Interessanterweise gilt dort die beschwörende Anrufung niemand anderem als Seth, der in Avaris verehrten Gottheit.
So wie Seth das Große Meer [Mittelmeer] gebannt hat,
so wird Seth dich bannen, o Krankheit der Amu!
Goedicke bezieht die Heldentat des Seth, die hier evoziert wird, auf die Bannung einer Flutwelle im Gefolge der vulkanischen Katastrophe von Thera (dem heutigen Santorin). Das ist ein kontrovers diskutiertes Thema, aber für unsere Diskussion ohne Belang. Bedeutsamer ist eine andere Verknüpfung. Jene erstmals erwähnte Pest, die in Kanaan/Syrien wütete und Ägypten bedrohte, wirft ihren Schatten auf das Ende der Hyksos-Zeit – ein erstaunlicher Parallelismus zu jener Seuche am Ende der Amarnazeit, auf die König Muršili mit seinen Pestgebeten reagierte. Wir sind mit einer weiteren starken Ähnlichkeitsrelation von Hyksos- und Amarna-Erinnerung konfrontiert. Es überrascht daher nicht, wenn Goedicke die Erwähnung einer Plage in der ramessidischen Erzählung von Apophis und Sekenenre mit der im Papyrus Hearst berichteten Pest zusammenbringt: »Das Auftreten der Plage im späten 16. Jahrhundert stimmt mit dem einleitenden Hinweis der spät-ägyptischen Geschichte vom Streit zwischen Apophis und Sekenenre überein, nämlich dass ›das Land von Ägypten den Unreinen gehörte‹; das Letztere bezieht sich möglicherweise auf vor der Pest Geflohene.«
Natürlich ist die Mutmaßung über Pestflüchtlinge nicht weniger spekulativ als der Bezug auf den Vulkanausbruch von Thera.22 Wir werden deshalb für unsere gedächtnisgeschichtliche Rekonstruktion nur so viel festhalten wollen: Unabhängig von Amarna arbeitet schon das Gedächtnis der Hyksos-Ära mit einem doppelsinnigen Begriff von Plage – der Reminiszenz an die Bedrohung durch eine Pest sowie der Erinnerung an einen schmerzhaften Riss im Sinnhaushalt der Kultur. Mit dem Begriff der kanaanäischen Krankheit in seiner spezifischen Kulturbedeutung stand den Ägyptern der Nach-Amarnazeit damit ein Referenzrahmen zur Verfügung, der es ihnen erlaubte, den Schrecken von Amarna gleichsam in verhüllter Form zu bannen und auszutreiben. Eingeschrieben in das semantische Schnittmuster der Hyksoserfahrung wurde es möglich, das inkommensurable Eigene in Gestalt des Fremden auszustoßen. Denn genau hierin besteht der große Unterschied: Die Hyksos waren wirklich Fremde, die Amarnakönige dagegen Ägypter aus dem Geblüt der glorreichen 18. Dynastie. Hatten die eigenen Herrscher jenseits der Anklänge an die Bedrohung durch Pest und kultische Unreinheit noch in einer anderen Hinsicht Ähnlichkeit mit den »Herrschern der Fremdländer«, den Hyksos? Könnte es sein, dass der Schrecken, den das schöne Achetaton verbreitete, nicht allein, wie gemeinhin vermutet, von der Kultreform ausging, sondern ebenso durch eine machtpolitische Bedrohung verbreitet wurde? Seit zwei Generationen hatte das Haus Juja die Macht der Thutmosiden gleichsam untergraben. Und sah es jetzt (nach dem Tod Echnatons) nicht so aus, dass Amarna drauf und dran war, den »fremden Asiaten« in Gestalt der Hethiter die Hand zu reichen und einer neuen Fremdherrschaft den Weg zu ebnen? Die bisher gegebenen Andeutungen reichen zu einer so weitgehenden Erklärung bei weitem nicht aus. Es gilt, die besonderen Grundlagen der Macht, die Legitimierung der Machthaber und die Verschiebung der Machtzentren in den Blick zu nehmen. Unsere Erkundung wird aber nicht dem ausgetretenen Königsweg (des Echnaton) folgen – eine Absage an die gängige Erwartung, mit der schrittweisen Radikalisierung einer religiösen Reform durch den jungen König die entscheidende Richtschnur in Händen zu halten. Sie setzt an anderer Stelle an, an dem scheinbar marginalen Vorkommnis eines Plans, der nur zur Hälfte ausgeführt wurde – des Versuchs, einen hethitischen Königssohn auf den ägyptischen Thron zu setzen. Wir nehmen den Faden wieder auf, den uns nicht die ägyptische Überlieferung selbst, sondern die hethitische Geschichtsschreibung in die Hand gegeben hat; den Dachamunzu-Faden, dessen pure Existenz als deutliches Krisensymptom zu verstehen ist und der deshalb helfen kann, das Knäuel Amarna zu entwirren.