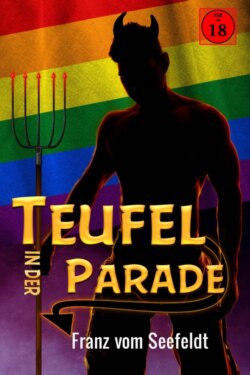Читать книгу Der Teufel in der Parade - Franz vom Seefeldt - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAnfahrt
In der Blauen Stunde kehren die letzten nachtaktiven Tiere von der Jagd zurück. Der Waldkauz hat die gefangenen Mäuse an seinen Nachwuchs verfüttert. Der Marder liegt satt und zufrieden in seinem Versteck. In einer Fasanerie, in die er eingedrungen war, hat er noch vor gar nicht langer Zeit sein Schlachtfest veranstaltet. Er konnte nicht alles fressen, was er erlegt hatte. Die Federn und die anderen verbliebenen Reste der getöteten Tiere musste er den Krähen überlassen, die sich an den Kadavern für den Tag stärken.
Zur selben Stunde torkeln die Übriggebliebenen der letzten Nacht langsam von den zwei, drei Kneipen der Stadt zurück zu ihren Betthöhlen. Im Gegensatz zu den Tieren meistens ohne Beute. Andere Artgenossen waren beim Heranpirschen an das weibliche oder männliche Geschlecht schon längst erfolgreicher gewesen, auch die, die sich über das Internet zu einem sexuellen Abenteuer mit irgendwelchen Dorfschönheiten getroffen haben. Sowohl die Kneipen als auch die Computer können jetzt ein wenig schlummern, wie auch die meisten derer Besitzer.
Nur Thomas findet keinen Schlaf mehr. Sein Kopf mit den noch immer vollen, roten Haaren, den Sommersprossen im Gesicht, der hagere Körper, selbst die Zehenspitzen verweigern sich der weiteren Einheit mit der weichen Daunendecke und dem Laken. Er muss heute an präseniler Bettflucht leiden – oder sollte sein Testosteronhaushalt tatsächlich sich erst jetzt aufs Jagen und Sammeln eingestellt haben?
Schon eine halbe Stunde vor Abfahrt des Zuges steht er am Automaten und schießt uns eine Fahrkarte. Mit dem Schönes-Wochenende-Ticket der Deutschen Bahn AG werden bis zu fünf Personen für einen erschwinglichen Preis mit den Nahverkehrszügen durch ganz Deutschland befördert. An diesem Samstagmorgen im Juni sind wir aber nur vier, die sich am Bahnhof eingefunden haben, um gemeinsam auf der Fahrkarte den Tagesausflug ins schwule Berlin zu machen: Thomas, Björn, Wolfgang, der sich endlich einmal aufraffen konnte, für einen Tag sein Buchantiquariat zu verlassen, und ich. Jan, von Beruf Altenpfleger und der Freund von Björn, muss arbeiten und kann leider nicht mit.
Thomas behauptet ernsthaft, er werde heute seine große Liebe finden und diese am Abend aus Berlin in unsere kleine Stadt entführen. Schon völlig abwegig für jeden anderen von uns, dafür den freien, fünften Platz auf der Fahrkarte haben zu wollen! Und was wäre, er führe alleine auf dem Wochenend-Ticket? Wollte Thomas dann etwa irgendwelche vier Berliner Jungs zu einer Orgie mit zu sich nach Hause nehmen? Auch wenn heute jede kleinere Gemeinde in Deutschland nichts weiter als ein Vorort einer Großstadt ist, unsere liegt doch immerhin fast 200 Kilometer von der Metropole an der Spree entfernt. Da müsste verdammt gute Überzeugungsarbeit bei den Hauptstadtschwuppen geleistet werden, ehe die mit aufs Land führen. Die schaffen es ja kaum, ihren eigenen Kiez zu verlassen. Gerade bei Thomas wäre an so viel Verführungskunst nicht mal ansatzweise zu denken, so zurückhaltend und schüchtern der in diesen Dingen doch ist. Hin und wieder hegen wir den Verdacht, dass er noch eine schwule Jungfrau ist, eine, die vor langer Zeit einmal ein schmerzhaftes Coming Out hatte, ohne dafür jemalsim Leben durch wilden Sex mit einem schnuckeligen Mann entschädigt worden zu sein.
Zumindest nicht mit einem aus unserer Region. DAS wüssten wir!
Der Zug rollt pünktlich am Bahnsteig ein. Wolfgang betont, dass es Zeiten gab, in der dies keiner Erwähnung bedurft hätte. Wir steigen ein und quälen uns in die für die lange Fahrt viel zu unbequemen Sitze. Diese sind einer der Gründe, warum wir nur noch ein- bis zweimal im Jahr mit der Bahn reisen. Die Zugbegleiterin ist eine stadtbekannte Lesbe, die alle nur unter ihrem Profilnamen Aurora kennen, die sie in den einschlägigen Internetforen nutzt. Ihren richtigen Namen kennen wir nicht. Sie gibt ihn standhaft nicht preis.
»Aus Rücksicht auf die türkischstämmigen Großeltern«, heißt es immer, »damit kein Gerede an deren Ohren gelangt.« Andere behaupten, es wäre aus Angst vor den Neonazis.
Sie hat uns schon beim Einsteigen entdeckt und zugewunken. Als sie zu uns kommt, um die Fahrkarte zu kontrollieren, bringt sie Wolfgang eine Zeitung mit, die jemand in einem anderen Abteil liegen gelassen hat, damit es ihm während der Fahrt nicht langweilig wird.
Sie gibt uns den Segen für den Tag: »Viel Spaß beim CSD!«
Dann beteuert sie noch, sie wäre auch gerne mitgefahren, aber sie müsse ja, genauso wie Jan, arbeiten. Emsig und voller Tatendrang zieht sie weiter zu den nächsten Reisenden und kontrolliert deren Fahrkarten. Auf dem metallic-grauen Namensschild an der Bluse, das sie heute angeheftet hat, steht: Fr. Aydın. Ihren Vornamen haben wir auch heute nicht erfahren, aber immerhin hat die Bahn ihren Nachnamen geoutet. Aurora zuliebe werden wir ihn sofort wieder vergessen.
Der feuerrote Streifen, bestehend aus der Diesellok der 218-er Reihe und mehreren Doppelstockwagen, zieht gemächlich durch den Morgen in den Tag hinein.
Vorbei an einer rot-braunen Kuhherde, die an einem Abhang grast, vorbei an Wäldern und Wiesen. Hinab in die Norddeutsche Tiefebene. Die Landschaft ändert sich. Ein anderes Bundesland. Riesige Getreide-, Raps- und Maisfelder wechseln sich jetzt ab. Vorbei geht es weiter an vergessenen Bahnhöfen beliebiger Dörfer, die seit der Wende an einer dramatischen Entvölkerung leiden. Der Niedergang von Regionen, den man sonst nur aus Kriegen, Seuchen und Katastrophen kennt. Der Aggressivität, mit der die Arbeitskräfte nach Bayern oder Baden-Württemberg weggeworben wurden, konnten die ehemaligen DDR-Gebiete auch dank der Treuhand nichts mehr entgegensetzen. Jetzt fehlt es an fähigen Bürgern vor Ort, die das Land wirtschaftlich voranbringen könnten, und an Kapital. Allein die vielen Windräder geben ein Zeichen der Hoffnung, auch wenn die meisten von ihnen heute stillstehen. Keine Luftbewegung. Flaute.
Während die Landschaft am Fenster vorbeizieht, liest Wolfgang ausgiebig die Zeitung. Wenn ich mich einmal über das Weltgeschehen informieren will, dann gehe ich ins Internet. Da ich weiß, dass für schwul auch die amerikanischen Wörter gay und queer im Gebrauch sind, ist es einfach, über eine Suchmaschine interessante Seiten im weltweiten Netz zu finden. Für mich haben Printmedien etwas Anachronistisches an sich. Das wäre wie der Austausch von Rauchzeichen zu einem Zeitpunkt, als es bereits die berittenen Herolde gab, die auf den Marktplätzen die Gesetze des Kaisers verlasen. Die Tageszeitungen werden vermutlich aussterben. Ganz sicher ist das aber nicht, denn es gibt tatsächlich noch Menschen wie Björn. Der geht regelmäßig in die Stadtbibliothek, um dort in der ZEIT, im STERN oder der GALA zu blättern. Nicht einmal die BRAVO verschmäht er, obwohl er für dieses Magazin wirklich schon ein wenig zu alt ist.
Thomas fragt Wolfgang, ob etwas Interessantes in dem Tagesblatt steht.
Er fasst den gerade gelesenen Artikel zusammen: »Der Kreisvorsitzende der NPD ist ein sehr einsamer Mensch. Niemand will mit ihm reden.«
Thomas hakt sofort nach: »Haben die demokratischen Parteien auch hier entschieden, sich nicht mehr mit den Neonazis auf Diskussionen einzulassen? Das finde ich einerseits gut so. Die sind für andere Meinungen sowieso taub, genauso wie die Anhänger irgendwelcher Verschwörungstheorien. Andererseits glaubt die braune Brut wegen der Ausgrenzung, sie wären Märtyrer. Das kann den geistigen Unfug ungemein verstärken.«
Wolfgang nickt zustimmend, während seine Augen noch immer auf den Artikel geheftet sind.
Thomas weiter: »Aber die faschistischen Gefolgsleute wissen ja nicht einmal, was eine Diskussion ist. Den Begriff haben die doch noch nie gehört. Wahrscheinlich nicht einmal der Kreisvorsitzende. Sinnlos, denen mit guten Argumenten zu kommen.«
Wolfgang blickt hoch. Nach einer theatralischen Pause, fast triumphierend: »Eine Frau an seiner Seite, mit der er reden könnte, gibt es auch nicht! Hat es wohl auch nie gegeben!«
Björn aus seinem Halbschlaf erwachend: »Mein Gott, er ist schwul.«
Thomas springt darauf an: »Er ist den ganzen Tag mit jungen, aber dafür äußerst unattraktiven Männern zusammen, die nichts zu sagen haben.«
Björn: »Okay. Er ist nicht schwul. Er ist selbst hässlich und verklemmt und kriegt darum keine Frau ab.«
Wolfgang ergänzt: »… und ganz schön dämlich. Einer Ideologie anzuhängen, bei der man sich das Frauenangebot selbst so extrem einschränkt, dass man leer ausgehen muss.«
Ich: »Wie meinst du das?«
Wolfgang: »Mädels aus der Ukraine, Polen oder die kleinen Thaimädchen sind für ihn ja tabu. Die sind halt nicht deutschnational genug.«
Ich: »Bei so einem unerfüllten Triebleben muss man ja auf dumme Gedanken kommen.«
Wolfgang und Björn stimmen mir zu. Ich denke da schon weiter: »Dort, wo die Neonazis an Einfluss gewinnen, entvölkern sich somit die Gegenden langsam von selbst. Bei so wenig Sex!«
Das bestätigt mir, dass politisches Engagement auch gegen das braune Gesocks Zeitverschwendung ist. Alles regelt sich von selbst.
Nach einem kurzen Innehalten liest Wolfgang, selbst etwas überrascht, weiter vor: »Der NPD-Kreisvorsitzende hat zweiunddreißig Semester Jura studiert und dann das erste Staatsexamen gemacht.«
Der Kommentar von Thomas: »Was für eine Intelligenzbestie! Da hat er wenigstens etwas, worauf er stolz sein kann. Schließlich schafft es nicht jeder, so lange zu studieren.«
Ich hatte mit den Rechten Gott sei Dank noch nie zu tun. Entweder gibt es sie bei uns nicht mehr oder sie sind unsichtbar geworden. Anders Wolfgang und Thomas, die vor langer Zeit einmal von Glatzköpfen, die so viel Haare auf wie Verstand unter der Schädeldecke haben, als Ziel eines Übergriffs auserkoren wurden.
Im hinteren Bereich des Buchantiquariats gibt es einen heimeligen Raum, die sogenannte Katzenstube. Der Name stammt nicht von irgendwelchen schwarzen Katern, die zwischen den Buchregalen oder auf der Fensterbank eingerollt schlummern und nur noch in ihren Träumen Mäuse und kleine Vögel fangen. Wolfgang findet die ach so süßen Miezen sogar ausgesprochen langweilig. Zudem reagiert er auf deren Haare allergisch. Zur Eröffnung des Ladens hat ihm aber ein befreundeter Fotograph eine Unmenge von ausdrucksstarken Katzenportraits geschenkt. Er war der Meinung,
an einem Ort, in dem die Vergangenheit durch die Schrift gegenwärtig sein soll, müsse auch der Geist von Katzen, wie der des Katers Murr oder der von Rumpleteazer, zumindest bildlich anwesend sein. Schließlich haben diese mehrere Leben und sind damit bedeutungsvoller als die menschlichen Romanhelden. Die der Stube den Namen gebenden Fotographien hat Wolfgang an fast jede freie Stelle der Wände gehängt, aber nur, weil er damals keine andere Dekoration hatte. Ursprünglich sollten in dem Raum regelmäßig Lesungen stattfinden. Mangels Interesse an guter Literatur und Wolfgangs Schwierigkeit, geeignete Autoren zu finden, die in der Provinz ihre Bücher vorstellen wollten, schlief dieses Vorhaben schnell wieder ein. Die Stube mit seinen circa zwanzig Plätzen an den Tischen, auf denen sonst Bücher gestapelt werden, wurde dennoch zu einem Ort des geselligen Beisammenseins. Wolfgang hatte ihn jeden ersten Freitag im Monat am Nachmittag kostenlos der örtlichen Schwulen- und Lesbengruppe überlassen, die ihn für ihren sogenannten »Kaffeeklatsch« nutzte. Den Verein gibt es schon lange nicht mehr. Aber es sind immer noch genügend Homosexuelle aus der kleinen Stadt und aus den Dörfern der Umgebung, die sich Anfang des Monats im Antiquariat einfinden. Alle Getränke stellt jetzt Wolfgang zum Selbstkostenpreis. Ein wichtiges Argument auch für die ganz Jungen, sich dort regelmäßig einzufinden.
Wenige Jahre nach dem Mauerfall – Björn und ich wussten damals noch nichts von dem Schwulentreffpunkt – standen plötzlich vier Neonazis in der Katzenstube. An den Kaffeetischen wurde es sofort mucksmäuschenstill.
Wolfgang erzählt bis heute immer wieder: »Dabei sahen die mit ihren rasierten Köpfen und den Springerstiefeln so lächerlich aus. Einer von denen hatte ein aufgedunsenes Gesicht. Man sah das Fett nur so schwabbeln. Was er zu viel an Gewicht auf die Waage brachte, hatten zwei von denen zu wenig. Diese extrem dürren Beine, die sie noch mit den engen Jeans betonten, und dazu die martialischen Stiefel – richtig albern! Dann hatten die beiden auch noch Gesichter voller Akne. Nur der Vierte, der Rädelsführer, war von seinem Äußeren her zwar nicht gerade schön, aber immerhin tageslichttauglich. Das nutzte ihm aber nichts, denn dafür schien er am meisten unter allgemeiner Geistesschwäche zu leiden.«
Beim Auftauchen dieser vier Gestalten sträubten sich einem die Nackenhaare. Die meisten der anwesenden Schwulen hätten sich am liebsten ganz klein gemacht und sich dann auf Samtpfoten leise an den Regalen vorbei nach draußen davongeschlichen, aber die Neonazis standen zu nah an der Tür. Der Rädelsführer suchte sich sein Opfer aus, vor das er sich breitbeinig stellte. Es war Thomas, bei dem seine Unsicherheit ja in sein bleiches Gesicht geschrieben steht.
»Du Perversling! Du Schädling der deutschen Volksgesundheit!«, pöbelte der Nazi los.
Thomas saß da, schaute ihn nur verwundert an und ertrug eher gelangweilt die Hasstiraden. Bei anderen hätten da nicht nur die Hände so etwas von gezittert, er behielt zu aller Überraschung einen kühlen Kopf, so wuchs er über sich hinaus. Von Angst oder Einschüchterung überhaupt keine Spur.
Der Glatzkopf schrie schon fast: »Schwule haben kein lebenswertes Leben! Wenn wir das Sagen haben, dann ist es aus mit euch!«
Bei Thomas war noch immer keine Reaktion erkennbar. Die Provokationen und Beleidigungen gingen offensichtlich bei ihm ins Leere.
In dem Moment, wo er nach einem neuen Opfer Ausschau hielt, fragte Thomas nur: »Fertig?«
Ohne eine Antwort zu erwarten, stand er seelenruhig auf, wandte sich an Wolfgang »Es ist langsam Zeit, dass du von deinem Hausrecht Gebrauch machst und die ungebetenen Gäste nach draußen begleitest.« Dann verließ er den Raum.
Wolfgang schaffte es endlich mit zittriger Stimme: »Meine Kunden lasse ich nicht beleidigen … In einer Minute … Ihr draußen, sonst Hausfriedensbruch.«
Die Neonazis amüsiert. Endlich jemand, der Zeichen von Angst zeigte. Das wollten sie auskosten und setzten sich demonstrativ auf die Tische.
»Und jetzt?« fragte der Rädelsführer.
Schweigen.
Nur Thomas war zu hören, wie er im Eingangsbereich mit der Polizei telefonierte. Als die Neonazis das mitkriegten, verließen sie fast fluchtartig das Antiquariat, aber nicht ohne vorher noch ein paar Bücher aus den Regalen zu reißen.
Wolfgang erzählt von dem Überfall häufig und immer mit demselben Schluss: »Als das Pack den Raum verließ, haben die Katzen auf den Bildern ihre Krallen gezeigt und fürchterlich gefaucht.«
In Wirklichkeit hatte es eine lange Zeit gedauert, bis sich zwei Polizeibeamte ins Antiquariat bequemten. Sie zickten herum, als sie den Strafantrag wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung aufnehmen sollten. Thomas musste erst drohen, sich bei deren Vorgesetzten zu beschweren oder die Presse einzuschalten.
Einige Tage danach lud sich ein Staatsanwalt zum nächsten »Kaffeeklatsch« ein.
»Die vier Beschuldigten, die sich selbst als der Stolz Deutschlands sehen, haben ein so langes Vorstrafenregister, dass sie sich keine weitere Verurteilung mehr erlauben können, wenn sie nicht im Gefängnis landen wollen«, berichtete er. »Ein Grund, warum der Überfall so glimpflich ausging.«
Er lobte, dass man sich nicht provozieren ließ und betonte, wie wichtig es sei, Anzeige zu erstatten. Dann stand er den Schwulen und Lesben Frage und Antwort.
»Ist Rechtsextremismus eigentlich heilbar?«, fragt Björn.
»Die davon Betroffenen müssten nur lernen, selbst zu denken und jeder Gewalt abzuschwören«, antwortet Thomas lapidar.
»Nein, ich meine wirklich im medizinischen Sinne. Wäre doch schön, die Wissenschaft hätte schon einen Impfstoff gegen braunes Gedankengut entwickelt«, konkretisiert Björn seine Frage.
Wolfgang lächelt einen Moment in sich hinein. Dann legt er los: »Du meinst, ob man Menschen mit rechtsextremistischer Veranlagung zu Demokraten umpolen kann? So im Sinne einer Reorientierung?«
Björn nickt zustimmend.
Wolfgang: »Vielleicht durch etwas Psychoanalyse auf der Couch? Herausfinden, was in der Kindheit schiefgelaufen ist? Fragen, woher die Sehnsucht nach dem dominanten Vater und die Gewaltbereitschaft herkommen? Meinst du etwas in der Richtung?«
Björn lacht: »Ja, ja, aber die armen Psychotherapeuten, die sich das anhören müssen.«
Wolfgang mit gespielter Nachdenklichkeit: »Das ist natürlich ein großes Problem. Wahrscheinlich bliebe die Analyse wirkungslos.«
Nach einer kurzen Pause setzt er triumphierend fort: »Es kommt nur eine härtere Methode in Betracht: die Elektroschocktherapie! Vielleicht funktioniert die ja wenigstens bei Neonazis. Erfreut sich dieser an rechten Parolen, gibt es – pitsch – einen kleinen Elektrostoß.«
Dann erklärt er uns: »Diese Reorientierungstherapie wurde noch in den 1950er in den USA bei den Schwulen in dem vergeblichen Glauben ausprobiert, die Patienten dadurch auf heterosexuell trimmen zu können.«
Thomas setzt nach: »Natürlich ohne Erfolg! Homosexualität ist ja auch – anders als Rechtsextremismus – weder eine Perversion noch sonst eine Krankheit. Aber es gibt immer wieder Scharlatane, die behaupten, es gebe ein Wundermittel gegen das Schwulsein. Aber mit Stromstößen zu quälen, das ist einfach nur unmenschlich.«
Wolfgang weiter: »Diese Therapie würde bei den Rechten auch nicht funktionieren. Eine Elektrode im Hintern und der Neonazi kriegt eine Erektion … und am Ende Priapismus, wenn er nur an Adolf Hitler denkt.«
Thomas und Björn schütteln sich vor Ekel bei diesem Gedanken.
Dann prusten sie vor Lachen los, während ich weiter aus dem Zugfenster schaue.
Wenn Wolfgang anfängt, einen seiner bildungspolitischen Vorträge zu halten, schalte ich entweder ab oder es geht mir schlicht auf die Nerven. Für unseren Buchhändler muss immer alles unter dem Aspekt gesellschaftskritischer Theorien diskutiert werden. Nicht nur an seinen leicht ergrautem Fusseln in dem schon etwas verbrauchten Gesicht, die einen Goatie darstellen sollen, erkennt man sofort, dass er aus dem vorigen Jahrtausend stammt, sondern auch wie oft er noch heute von Machtstrukturen, Unterdrückung oder Klassenkampf faselt.
Mich interessiert die Politik überhaupt nicht. Zu den Wahlen gehe ich nicht, weil ich nicht weiß, welcher Partei ich meine Stimme geben sollte. Im Bundestag sitzen doch nur alternde Männer und Frauen. Die meisten Politiker haben überhaupt keine erotische Ausstrahlung. Es gibt zwar einige Ausnahmen: Christian Lindner oder Daniel Bahr von der FDP zum Beispiel oder der Sprecher der SPD für irgendetwas, Carsten Schneider, die man manchmal im Fernsehen sieht. Die sind noch jung. Gäbe es von denen Nacktbilder wie früher im PLAYGIRL, würde ich mir das entsprechende Magazin sofort kaufen. Aber die Herren sind bestimmt alle heterosexuell veranlagt und damit sowieso für mich tabu.
Pornobilder mit Sebastian Edathy als Motiv wären auch nicht schlecht. Aber würde der sich dafür hergeben und dann nach dem Fotoshooting gleich in den Sicherheitsausschuß gehen? Wohl eher nicht. Das wäre eine zu große Strafe für ihn.
Die jungen Politiker verlieren sowieso mit der Zeit ihren Reiz, werden genauso knochentrocken und abgehangen wie alle anderen Politiker auch, oder verschwinden nach irgendeinem Skandal von der Bildfläche. Warum sollte ich also meine Zeit mit so etwas Langweiligem wie irgendwelchen Parteiprogrammen vergeuden?
Ich will Party. Darum fahre ich heute nach Berlin.
Nachdem wir in Magdeburg umgestiegen sind, öffnet Wolfgang endlich die erste Sektflasche, aus der wir reihum trinken. Geht doch – auch ohne Politik!
*
Brötchen, Butter, Honig, Johannisbeergelee, zwei Scheiben Gouda, ein hartgekochtes Ei und natürlich Kaffee. So sieht ihre Morgenmahlzeit aus, das sie sich am Buffet zusammengestellt hat. Dazu noch ein kleines Glas Champagner, welches ihr die Bedienungskraft direkt an ihren Platz bringt. Ein Geschenk an sich selbst, das sie sich nur äußerst selten macht, obwohl sie es sich dank eines mehr als beträchtlichen Vermögens durchaus täglich leisten könnte. Aber jeden Morgen mit einem Sektfrühstück zu beginnen, wäre ihr einerseits zu dekadent und bliebe bei ihr leider nicht ohne Nebenwirkungen. Außerdem ziemt sich das nicht für eine Dame.
Der Frühstücksraum hat den morgendlichen Andrang bereits hinter sich. Die Messer klappern nicht mehr auf den Tellern. Das Gurgeln der Kaffeemaschine verklingt langsam. Die meisten Gäste des Nobelhotels in der Nähe des Kurfürstendamms haben das Haus bereits verlassen. Einige von denen besichtigen bereits die Sehenswürdigkeiten Berlins. Andere suchen die in einem anderen Stockwerk gelegenen Konferenzräume auf, um sich in der Teilnehmerliste der betreffenden Tagung einzutragen, die an diesem heißen Wochenende stattfindet. Wenige sind abgereist.
Kurz vor Schließung des Buffets kann die Dame das Frühstück in Ruhe genießen.
Hin und wieder wirft sie schon einmal einen Blick auf die Schlagzeilen der Tageszeitung, die noch gefaltet neben dem Brötchenkorb liegt. Das Blatt lag kostenlos im Foyer aus.
Sie will es noch lesen, aber erst später. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das Weltgeschehen an sich heranzulassen.
Sie hebt das Champagnerglas und prostet sich selbst zu: »Auf diesen Himmlischen Geist, der für mich den Reichtum dieses Universums erkämpft!«
Dann nach oben in Richtung Weltall: »Na ja, vielleicht lerne ich dich einmal persönlich kennen … und das möglichst noch vor meinem 35. Geburtstag!«
Die Dame will nicht mehr allein reisen.
Plötzlich fliegt ein Space Shuttle, geführt von einer Kinderhand, am Honig und Käse vorbei, um dann zur Landung neben der Kaffeetasse anzusetzen. Der Astronaut des Raumschiffs trägt ein weißes T-Shirt, auf dem ein bunter Papagei auf einem Skateboard surft. Der kleine Junge mit seinen glänzend schwarzen Haaren, der teakholzfarbenen Haut und den riesigen dunkelbraunen Augen schaut die Dame bittend an. Statt nach unbekannten Welten sucht er jemanden, mit dem er nur einfach spielen kann. Völlig hingerissen von dem niedlichen Kind wendet sie sich zu ihm: »Du hast aber ein schönes Spielzeug.«
Als Antwort nur ein fragender Blick.
Sie versucht es erneut: »Wenn du groß bist, willst du bestimmt ins Weltall fliegen.«
Wieder kein Wort. Nur diese großen Kulleraugen, die die Welt verzaubern.
Jetzt eilt der Vater herbei: »Entschuldigen Sie bitte die Störung! Er versteht kein Deutsch.«
Ein göttlich gut aussehender Mann in einem nachtblauen Seidenhemd kommt zu ihrem Tisch. Ihr gefallen nicht nur die schwarzen Haare auf seinem Handrücken, die bis zu dem kleinen Finger reichen. Starke Hände, die ein Kind beschützen können. Auf seinen breiten Schultern sitzt die kleine Schwester des Astronauten. Mit ihr war er gerade durch den Frühstücksraum spaziert, als er für einen Moment seinen Sohn aus den Augen verlor.
Ein Familienmensch durch und durch, so denkt die Dame. Jetzt entdeckt sie auch die dazu gehörige Ehefrau, wie sie fast geistesabwesend am Fenster steht und hinab auf die Straße sieht. Eine Frau, die nicht wirklich schön ist. Die aschgraue Haut, die etwas zu große Nase und die ein wenig eingefallenen Wangen geben ihr Gesicht eine unnötige, störende Härte. Ihr fehlt das passende Make-Up, erkennt die Dame am Frühstückstisch sofort. Der Rest des Körpers ist in Unmengen von Seiden- und Wollstoffen verhüllt, das Haar hinter einem Kopftuch versteckt. Modisch der reinste Horror. Ein Outfit kurz vor der Burka. Ein Schrecken für jede emanzipierte Frau. Die Familie kommt irgendwo aus dem Mittleren Osten, vielleicht Iran, Pakistan, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Indien.
Der kleine Junge schmiegt sich von der einen Seite an seinen Vater, blickt zu ihm nach oben und zu seiner Schwester und fragt ihn etwas in einer Sprache, die sie nicht erkennt. Das Space Shuttle auf der anderen Seite hält er noch immer fest in der Hand.
»Wissen Sie zufällig, ob heute in Berlin etwas los ist?«, gibt der Vater die Frage seines Sohnes an die reiche Dame weiter.
In der Hauptstadt gibt es immer viel zu sehen und zu erleben, sodass sie einen Augenblick überlegen muss, was sie überhaupt sagen soll. Diese überflüssige Frage hätte sie bei jedem anderen Mann als plumpe Anmache gewertet. Ein Blick auf die Zeitung, dann antwortet sie, ohne weiter nachzudenken nur: »CSD!«
Aber die drei Buchstaben scheinen dem Vater nichts zu sagen. Er schaut sie – wie kurz vorher sein Sohn – mit großen dunklen Augen an. Genau so hinreißend.
Sie wiederholt: »Heute findet der CSD-Umzug statt.«
Eigentlich weiß das doch heute jeder, der nicht hinter dem Mond lebt: Der CSD steht für Christopher Street Day, an dem an die Ereignisse vom 28.06.1969 in New York erinnert wird: Die Polizei schikanierte mal wieder mit einer
ihren willkürlichen Razzien die Homosexuellen. Die Schwulen wehrten sich und lieferten sich über mehrere Tage Straßenschlachten mit der Polizei. Hauptschauplatz war die legendäre Christopher Street. Die Homosexuellenbewegung war wiedergeboren, nur schien das damals die Weltöffentlichkeit nicht sonderlich interessiert zu haben.
Das Ereignis des Jahres 1969, von dem die Welt redete: Neil Armstrong betrat am 21.07.1969 als erster Mensch den Mond. Die Erdbevölkerung lernte, dass der Mond ein unwirklicher, lebensfeindlicher Ort ist. Die Schwulen lernten, dass mit eigenen Rechten die Erde ein Ort sein kann, auf dem es sich lohnt, zu leben. Von der Mondlandung spricht heute kaum noch jemand. Es gibt zwar noch Raumschiffe als Spielzeug für die Kinder und hin und wieder eine sonstige kleinere Erinnerung. Die Star Wars-Filmreihe hat schon nichts mehr damit zu tun. Die gehört eher in den Bereich Fantasy. Aber an die Unruhen in der Christopher Street dagegen wird in vielen Städten jedes Jahr mit immer lauteren, bunteren Umzügen erinnert, wenn sie woanders auch »Regenbogenparade« oder »Gay Parade« heißen.
Gay Parade – mit dieser Bezeichnung kann der junge Vater etwas anfangen. Er wirkt sofort sichtlich nervös.
Mit etwas aufgeschreckter Stimme stammelt er: »Nein, nein, ich meine etwas, wo ich meine Frau und meine Kinder allein hingehen lassen kann.«
Wenigstens faselt er jetzt nicht, in seiner Kultur sei Homosexualität ein schweres Verbrechen, denkt die Dame. Trotzdem hat sie etwas an seiner Reaktion gestört.
Heißt das eben Gesagte nicht, es ist allein der Mann, der der Frau erlaubt, etwas zu tun? Er entscheidet, wo der Rest der Familie sich heute aufhalten darf?
So verliert bei ihr jeder Mann schlagartig an Attraktivität.
»Die verstehen kaum Deutsch, und ich kann sie nicht begleiten. Ich habe noch etwas anderes vor,« versucht er sich zu retten. Sie lässt diese etwas inhaltsleere Erklärung durchgehen, aber nur, weil er dabei wieder so hinreißend lächelt.
Ihr fällt spontan der Zoo ein. Tiere sind für alle Kinder in der Welt immer vor allen Dingen niedlich. Außerdem ist er nicht weit vom Hotel gelegen. Wenigstens fragt er jetzt seine Kinder und seine Frau, die zum ersten Mal lächelt. Die Ehegattin antwortet ihm mit einer schönen Sopran-Stimme, die sie bei vielen blinden Männern zu einer Sex-Göttin aufsteigen ließe. Die Tochter stammelt mit Begeisterung ein paar unverständliche Worte vor sich hin. Der Vater bedankt sich: »Meine Tochter ist schon ganz aufgeregt. Sie will unbedingt den kleinen Eisbären sehen, von dem die ganze Welt redet. Meine Frau ist übrigens Ornithologin, ihre Freude sind Vogelbestimmungen. Gemeinsam halten wir übrigens Greifvögel für die bei uns sehr beliebten Falkenjagd und ein paar dressierte Exemplare aus der Familie der Corviden.«
Die Ehepartnerin unterbricht ihn.
»Meine Frau freut sich besonders auf die Humboldt-Pinguine, Spheniscus humboldti, da die nach dem in Berlin geborenen Naturforscher benannt sind,« übersetzt der Mann.
Die Familie aus dem Orient verlässt den Raum. Die Ehefrau selbstredend fünf Schritte hinter ihrem Gatten.
Bestimmungsübungen hätte die Ehefrau eigentlich doch auch beim CSD machen können, denkt sich noch die Dame, während sie das Frühstück langsam ausklingen lässt.
Homo sapiens homosexualis – der Durchschnittsschwule.
Homo sapiens homosexualis analpenetrationis – Varietät, die Analsex bevorzugt . Die steht im Gegensatz zum Homo sapiens urinophilis, die den Golden Shower favorisiert.
Nicht zu vergessen der Homo sapiens homosexualis barbrastreisandi …
War es politisch zu inkorrekt, den armen Familienvater mit Homosexualität zu konfrontieren und ihn auf den CSD schicken zu wollen? Die Dame grübelt. Die Situation entbehrte ja nicht einer gewissen Absurdität und nur, weil sie unbedacht geantwortet hat. Sie hofft, ihn nicht zu sehr geschockt zu haben.
Entwarnung: Der Vater kommt mit seinem Sohn noch einmal zurück.
»Mein Kind will Ihnen etwas schenken.«
Es ist eine Tüte mit Süßigkeiten – kleinen Kugeln, die früher als Liebesperlen bekannt waren, die der kleine Junge ihr überreicht.
»Nur wen er wirklich mag, beschenkt er. Mich mag er auch. Ich finde die ständig in meinen Jackentaschen.«
Sie würde am liebsten nicht nur das Zuckerwerk, sondern auch den Mann, der vor ihr steht, gleich mit vernaschen.
*
Halb elf und wir sind schon auf dem Alexanderplatz.
Viel zu früh. Wir hätten einen Zug später nehmen können, aber Wolfgang rechnete ja nicht mit der Pünktlichkeit der Bahn. Mal sehen, wer sich sonst noch aus unserer Kreisstadt unter der Weltzeituhr einfindet. Die gilt jedes Jahr als der vereinbarte Treffpunkt, auch wenn wir für den durch halb Berlin fahren müssen.
Jetzt heißt es erst einmal warten.
Auf der Säule der Weltzeituhr ruht eigentlich kein Zylinder, denn er hat Ecken und Kanten, aber aus der Ferne sieht er trotzdem gleichmäßig rund aus. So wie die Zeit selbst, die ja auch ihre Spitzen und Längen hat und trotzdem kontinuierlich weiterläuft. Die Mantelfläche dieses Zylinders ist dreigeteilt. Oben und unten finden sich auf jeweils vierundzwanzig Aluminiumplatten Namen von Städten, die in den entsprechenden Zeitzonen liegen. In der Mitte rollt die Zeit mit bunten Ziffern dahin.
Was wäre, wenn das Leben nur einen Tag dauerte, statt der 96 Jahre, die heute ohne weiteres erreichbar sind? Dann vergingen vier Jahre in einer Stunde. Die Pubertät begänne um 3 Uhr morgens mit der ersten Latte. Die Schule endete kurz vor 5. Aber schon gegen Mittag wäre die interessante Zeit des Lebens vorbei. Die Sonne hat dann ihren Zenit überstrichen. Danach kommen nur noch der goldene Herbst des Alters und die Dunkelheit der Demenz.
Wolfgang steht passend unter der Moskauer Zeit.
Für ihn ist es schon halb eins nachmittags.
Wichtige Ereignisse in den Jahren, die ihn prägten:
Willy Brandts Kniefall in Warschau, die Olympische Spiele 1972 in München, und ja, für ihn auch die bemannten Raumflüge. Da war dieser positive Glauben an eine bessere Zukunft. Ferne Welten konnten noch erobert werden.
Aber dann das Sonntagsfahrverbot. Der Beginn der Umweltschutzbewegung. Überwachungskameras hinter Spiegeln in den städtischen Klos, nur um die warmen Brüder von den Klappen zu vertreiben und viele andere Diskriminierungen.
Endlose Diskussionen in der Schwulen-Selbsthilfe-Gruppe, in der er sich damals noch mit Rauschebart und wilden Ideen im Kopf engagierte.
Homosexualität ist eine hochpolitische Angelegenheit.
Klassenkampf und viel Klassenkrampf.
Thomas steht nur drei Stunden entfernt von Wolfgang, und trotzdem trennen die beiden Welten.
Nach Greenwich Mean Time ist es jetzt kurz nach halb zehn. Die Weltzeituhr ordnet für diese Zeitzone die Städte Reykjavik, Dublin, London, Lissabon, Madeira und die afrikanischen Städte Bissau, Casablanca, Conakry, Bamako und Accra zu.
Aus der ghanaischen Hauptstadt kam auch der Student der Ingenieurwissenschaften, den Thomas in der Katholischen Studentengemeinde kennengelernt hatte. Ein Afrikaner aus gutem Hause, bei dem man nie auf den Gedanken gekommen wäre, er könnte an AIDS erkranken. Den Virus, hieß es, habe er sich beim Geschlechtsverkehr mit einem britischen Piloten geholt. Der Tod ließ nicht lange auf sich warten.
Heißt ein schwules Leben nicht ein schneller Tod? Die Furcht, an der Seuche zu erkranken, selbst wenn man nur einen Mann küsst. Anderen half gegen die Panik das Tanzen – zu New Wave, Depeche Mode oder Frankie Goes to Hollywood. Thomas gab die Seuche als weiteren Grund an, sich emotional abgeschottet zu haben.
Die Angst vor dem HIV-Virus habe von ihm damals Besitz genommen, behauptet er immer wieder.
Ich schaue noch einmal hoch auf die Weltzeituhr. Auf der unteren Aluminiumplatte direkt über mir steht kein Ort und über der Ziffer lediglich Ostgrönland. Meine Zeit muss irgendwo im Eis der Neuen Ökonomie und den Weiten des Atlantiks und seiner Aktienmärkte verschollen sein. Da heißt es halt, zwar etwas ziellos durch das Leben zu schwimmen, aber dabei nicht gegen einen Eisberg zu stoßen oder wie die Titanic zu versinken. Kein Leuchtturm in Sicht, der einem den Weg zeigt. Immerhin bin ich mit einem passablen inneren Radar ausgestattet, um auf der Reise all die geilen Männer auf den Schirm zu bekommen.
Und Björn? Er ist noch so jung. Ich denke, in frühestens fünfundzwanzig Jahren mag er dann den jungen Schwulen von seinem Weg erzählen. Jetzt geht er ihn mit Jan erst einmal in einer festen Beziehung.
Was kommt, steht in den Sternen oder wird durch die sich ewig ändernden Konstellationen der Planeten bestimmt, mit der die Weltzeituhr gekrönt wird.
Punkt 11 Uhr tauchen Kathleen und Iris auf. Deren Wiege stand auch einst in Wolfgangs Katzenstube. Damals, als sie sich gerade ihrer Homosexualität bewusst wurden. Zwei schüchterne Mädels, die schnell zueinander fanden. Als Paar verließen sie gemeinsam kurz nach ihren achtzehnten Geburtstagen unsere Stadt und zogen nach Berlin-Friedrichshain. Sie wollten endlich in einer Welt leben, in der von ihrer Friseurin bis hin zur Kassiererin im Supermarkt alle hundertprozentig lesbisch sind. Selbst Kathleens Chefin, eine Rechtsanwältin, soll auf Frauen stehen. Das Leben der heterosexuellen Bevölkerung findet für die beiden nur noch in TV-Serien statt.
Berlin versprach ihnen genügend Anonymität, die seit Menschengedenken Minderheiten in den Großstädten suchen. Schutzorte der Verborgenheit und der Geborgenheit unter ihresgleichen.
Ihr heutiges Himmelreich befindet sich eine Straße von ihrer Wohnung entfernt, wo die beiden jeden Dienstagabend ihre Absacker zu sich nehmen. Die einzige gemeinsame Aktivität, die das Lesbenpaar noch außerhalb ihres trauten Heims in der Kopernikusstraße hat. Manchmal verlässt Iris noch ihren Kiez, um an irgendeinem Selbsterfahrungs-Workshops für Frauen teilzunehmen. Mehr ist von dem Traum von einem Leben in der Lesben-Szene nicht geblieben. Kathleen sitzt in der Freizeit fast nur noch vor dem Fernsehen. Sie kennt sämtliche amerikanischen Sitcoms in- und auswendig. Das Internet interessiert sie nicht. Jede Störung in ihrem Tagesablauf, auf die sie mit Eigeninitiative reagieren muss, beunruhigt sie. Die gemieteten vier Wände sind zum Schutzgebiet vor der Welt, aus dem sie nur noch zur Arbeit oder zum Einkaufen raus müssen, geworden. Die Ausnahme ist der CSD, aber da treffen sie sich mit uns, für die beiden noch immer wichtige, vertraute Gesichter nach all den Jahren.
Für Wolfgang sind die beiden Lesben der lebende Beweis, dass es in Berlin provinziellere Menschen gibt als in dem einsamsten Dorf der Uckermark. Im Computerzeitalter gelangen außerdem die neuesten Ideen in Sekundenschnelle selbst von Vanuatu bis auf die Färöer-Inseln, ohne noch in einen der Weltzentren einen Zwischenstopp einlegen zu müssen. Was manche Moden angeht, seien wir in unserer Kleinstadt mehr auf der Höhe der Zeit als viele Berliner. Das behauptet zumindest Wolfgang immer wieder.
Thomas hat einmal gelästert: »Wenn Kathleen und Iris alt sind, werden sie auf Kissen im Fenster liegen und in geblümten Dederon-Kitteln das Geschehen auf der Straße beobachten.«
Iris hat das gehört und darauf empört erwidert: »Wir haben überhaupt keine Küchenschürzen. Wozu auch? In Berlin gibt es an jeder Ecke einen Lieferservice, der einem lecker Essen bringt. Nebenbei sind die Pizza-Boten, die wir kennen, alle hetero. Von wegen wir hätten keinen Kontakt mehr zur nichthomosexuellen Mehrheitsgesellschaft!«
Die beiden Mädels erscheinen wie immer im Partnerlook – derselbe Kurzhaarschnitt, Tops mit der Aufschrift 2QT 2B STR8 – zu schön, um Hetera zu sein – und in knallengen Jeans.
Aber irgendwie ist das heute die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden haben. Dass es immer auch Unterschiede zwischen zwei Menschen gibt, versteht sich von selbst. Zum Beispiel, dass Kathleen im Gegensatz zu Iris nie einen BH trägt, sodass ihre ausufernden Brüste bei jedem Schritt lustig mitwippen oder dass Iris ein Kopf kleiner und ihr Körper wesentlich zierlicher ist als der ihrer Freundin. Gegensätze ziehen sich ja schließlich an.
Heute aber fehlt es an … wie soll ich es sagen, einer gewissen Harmonie zwischen den beiden Lesben. Sie streiten sich schon seit Tagen, erfahren wir.
»Iris will unbedingt ein Kind.« schmollt Kathleen.
Die Gattin: »Wenn die Heteros schon auf Familienplanung verzichten, dann sollten wenigstens wir an Nachwuchs denken.«
Kathleen: »Familienplanung? Reicht dafür nicht auch ein adoptierter Schäferhund. Könnten wir auch aus dem Tierheim holen.«
Iris ist sauer und fast den Tränen nahe.
Thomas fragt: »Habt ihr denn schon einen Vater?«
Kathleen schnippisch: »Iris will heute ja scheinbar auf Suche nach einem Samenspender gehen. Jungs, will nicht einer von euch?«
Iris blickt demonstrativ zur Seite.
Ich schlage vor: »Warum fragt ihr nicht euren Pizza-Boten?«
Beide schauen mich fassungslos an.
Dann antworten sie unisono: »Weil der nicht schwul ist!«
Die Zeit wartet auf niemand`. Außer auf Ronny, dem mir so unsympathischen Streber, der mit mir zwei Jahre in dieselbe Schulklasse ging. Außer ihm ist niemand mehr aus unserer Stadt auf dem Alex erschienen.
Die Zeit wartet auf niemand`. Wir auch nicht. Auch nicht auf den perfekten Samenspender!
Mit der S-Bahn geht es darum jetzt zum Bahnhof Zoo.