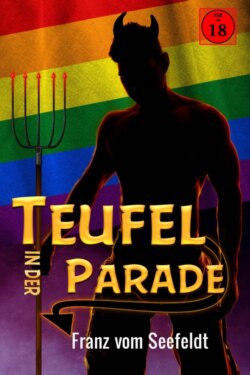Читать книгу Der Teufel in der Parade - Franz vom Seefeldt - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Frühes Leid
ОглавлениеDie Schwulen und Lesben unserer kleinen Stadt sollen mit diesem Tagesausflug nach Berlin ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl bekommen.
Das hat Wolfgang proklamiert, als er sich entschied, mitzufahren.
Wieder geht es ihm nur um das politische Bewusstsein, das uns angeblich abgekommen sein soll.
Die jungen Schwulen wollen doch nur noch Spaß, behauptet er ständig.
Ja, aber warum denn auch nicht? Spricht denn etwas dagegen? Dafür kommen wir raus, während er in seinem Antiquariat herumphilosophiert und versauert.
In der S-Bahn zum Bahnhof Zoo vertritt Wolfgang lautstark seine Thesen, wohl auch, um uns irgendwie politisch auf die Parade einzustimmen.
»Wie haben die Steinzeitmenschen die wochenlange Jagd überstanden, während die Frauen im Hause die Dinkelkörner zählten?«, fragt er uns stehend, sich an den Haltegriff klammernd, aber mit dröhnender Stimme, sodass der ganze Wagen mithören kann. Eine Wahlkampfrede, die die anderen Fahrgäste nur bedingt amüsiert, eigentlich eher belästigt, so wie ihnen sonst die Arbeitslosen, die ihre Zeitungen verkaufen wollen, oder bettelnde Straßenmusikanten schon während der Fahrt die gute Laune rauben.
»Na? Tag für Tag nur hinter dem Mammut her. Wie langweilig für die Spermaproduktion! Ohne Sex wäre das doch auf die lange Zeit die Hölle gewesen! Zur Befriedigung der Triebe in der männlichen Jagdgesellschaft hat die Natur den Schwulen geschaffen. An irgendwem müssen die Hormone sich abarbeiten können. Dort, wo die Homosexualität unterdrückt wird, muss es folglich immer zum Krieg zwischen den Herrn kommen. Darum kann auch heute noch jeder treue Familienvater, selbst der hier in der S-Bahn sitzt …«
Dabei schaut er sich ausgiebig im Abteil um. Nicht nur ich, mittlerweils sind alle männlichen Fahrgästen über seinen Auftritt mehr als peinlich berührt. Wolfgang sollte den Morgen wirklich nicht mit Sekt beginnen.
Mit selbsteuphorisierender Stimme fährt er fort: »Darum kann jeder Mann auch heute noch mit einem anderen Mann auf seine Kosten kommen. Sie müssten es nur endlich alle einmal wagen …«
Es folgt eine theatralische Pause.
Will Wolfgang tatsächlich jetzt wirklich alle Heteromänner zur Homosexualität bekehren? Der Gedanke ist zu schrecklich. Auch in dieser S-Bahn sitzt so ein dicker, feister Vater, der Sachbearbeiter im Job-Center sein könnte, oder da hinten, diesen schmierigen Klotz, so einer wie ich ihn auch aus dem Erdgeschoß bei mir im Haus kenne. Es gibt zu viele Heteros, bei denen ich gerade froh bin, dass sie nicht schwul sind. Sie wären eine Schande für unsereins. Außerdem ist unser Buchhändler nicht konsequent. Hat er auf der Hinfahrt nicht noch gegen jegliche Umpolung zu einer bestimmten sexuellen Ausrichtung gewettert?
Aber Wolfgang setzt unbeirrt und mit einer immer schriller werdenden Stimme fort: »… und natürlich muss es auch die Lesben geben. Als körperliche Freude für die am Herd
gebliebenen Ehefrauen. Der Zickenkrieg, den es sonst in den Dörfern gegeben hätte … nicht auszumalen!«
Iris fällt eher dazu und nur mit Schrecken der Frauen-Workshop »Weibliche Harmonie durch Yoga« vor ein paar Wochen ein, an dem sie teilnahm, um sich im spirituellen Sinne selbst etwas näher zu kommen. Bei dem Kurs flogen ab einem gewissen Zeitpunkt zwischen den Lesben nur so die Fetzen. Eifersuchtsdramen. Stutenbissigkeit. Alles, was das nach Meditation suchende Frauenherz gerade nicht begehrt. Sie ist mitten in einer Übung heulend weggerannt. Irgendwo in einer Kneipe in Charlottenburg hat sie sich mit Wodka-Cola volllaufen lassen. Was dann geschah? Weiß der Teufel! Ob der Absturz wirklich völlig hoffnungslos war, konnte sie am nächsten Morgen nicht einmal von dem Kater in ihr erfahren. Den hatte sie dummerweise recht früh mit Aspirin getötet.
Iris zu Wolfgang: »Hast Du ‘ne Ahnung!«
Mehr kann sie nicht mehr sagen, denn wir müssen aussteigen.
»Noch schlimmer wäre ein Vortrag von Wolfgang zum Weltfrieden gewesen!«, werfe ich noch ein und ernte dafür von ihm einen bösen, eisigen Blick.
Nebenbei: Ich glaube nicht, dass in der Steinzeit der Mann lange von seiner Frau getrennt war. Die sind doch wohl eher gemeinsam durch die Steppe gezogen. Trotzdem gab es auch in der Frühzeit Homosexualität. Warum die Natur die erfunden hat, ist doch eigentlich egal. Hauptsache: Ich bin schwul!
Ronny findet dagegen Wolfgangs Thesen tatsächlich diskussionswürdig. Da weiß ich wieder, warum ich meinen ehemaligen Mitschüler immer doof fand.
Vom Bahnhof Zoo bis zum Kurfürstendamm sind es keine fünf Minuten Fußweg. Eine Horde Schwuler und Lesben
kann dafür Ewigkeiten brauchen.
Das fängt schon damit an, dass Wolfgang zunächst den falschen Ausgang, den zur unauffälligen Jebensstraße, nehmen will. Der Bahnhof Zoo war während der Teilung Deutschlands der Ankunftsort sämtlicher Bundesbürger, die nach West-Berlin einreisten. Heute ist er nur noch ein Regionalbahnhof. Die Durchgangshalle und insbesondere die verschwiegene Rückseite blieben für etwas berühmt und berüchtigt, das anscheinend heute noch immer einige Männer anzieht:
»Die Macht der Gewohnheit«, lästert Thomas, »dort stehen ja auch die Stricher.«
Dabei hat sich Wolfgang noch nie sonderlich für die Drogenjunkies oder die jungen Männer aus Rumänien, Albanien oder Mazedonien interessiert, die sich in der Jebensstraße für Geld anbieten. Nach seiner Vorstellung reine kapitalistische Ausbeutung durch die Freier. Dem gegenüber sehen die Stricher lediglich die Möglichkeit, aufgrund des Elends unbefriedigter Herren schnell an Geld zu kommen. Einige von den männlichen Prostituierten sind hundertprozentig heterosexuell veranlagt. Die haben vermutlich noch Frau und Kinder in den Dörfern irgendwo hinter den Karpaten. Trotzdem stehen sie lieber am Bahnhof als sich in der Heimat dem täglichen Kampf gegen die Armut auszusetzen.
Jeder Mann kann, wenn es darauf ankommt, Sex mit einem anderen Mann haben. So hat es Wolfgang in der S-Bahn doch selbst gesagt. Wahrscheinlich gibt es tatsächlich ein Mittel der Reorientierungstherapie, mit der die sexuelle Ausrichtung zumindest vorübergehend ausgeschaltet werden kann: Geld! Viel Geld! Für ein paar Milliarden Dollar würde sogar ich Madonna oder Cher penetrieren wollen, auch wenn das mich nicht wirklich glücklich machen dürfte.
Ich hätte nichts dagegen, wenn Wolfgang sich mal einen Stricher leisten würde. Soweit ich weiß, hat er – wie Thomas – überhaupt keinen Sex mehr. Seit einigen Jahren besteht da Notstand. Er ist immer noch auf der Suche nach der großen Liebe, sagt er. Wahrscheinlich ist mittlerweile das Objekt seiner Sehnsucht ein verklemmter Hetero. Hauptsache: unerreichbar. Warum sollte er sonst in der S-Bahn solche Reden schwingen? Der will selbst jemanden umpolen!
Statt ihn für ein paar Euro mit einem Rumänen zu verkuppeln, überzeugen die anderen ihn dummerweise, der richtige Ausgang sei der, an dem die Doppeldeckerbusse abfahren. Der, auf dem man links auf dem Nachkriegsblock auf der anderen Seite des Platzes eine Giraffe abgebildet sieht, die den Weg zum Zoo weist.
Kaum haben wir die Bahnhofshalle verlassen, geht es nur ein paar Schritte nach rechts bis zum nächstbesten Supermarkt, der sich unter der Eisenbahnbrücke in der Hardenbergstraße befindet.
Björn und Thomas wollen den Sektvorrat, der auf dem Alexanderplatz sich schon merklich verringert hatte, wieder auffüllen. Dabei hat Iris gar nicht mitgetrunken. Sie leidet offensichtlich an Gesundheitswahn und hat nur eine Thermoskanne mit Tee als Tagesproviant dabei. Sie will jetzt aber auch im Laden einfach nur mal so gucken. Ronny trägt schon die ganze Zeit zwei riesige Plastiktüten mit sich. Keiner weiß warum. Alle anderen haben Rucksäcke. Jetzt stürmt er ebenfalls das Geschäft. Ich erwarte, dass er mit noch mehr Plastiktaschen wieder herauskommt. Dabei sollte er doch am ehesten wissen, wie umweltschädlich die sind. Schließlich arbeitet er beim Bundesumweltamt in Dessau.
Im Supermarkt sind gefühlt Tausende von Schwule und Lesben, die sich ebenfalls mit der Tagesration Schampus versorgen wollen. Die Schlangen an den Kassen sind endlos. Zu allem Überfluss müssen einige Hausfrauen, die sich zu dieser Zeit in den Laden verirrt haben, den Gegenbeweis antreten, das weibliche Geschlecht könne mehrere Dinge gleichzeitig machen. Von wegen Multi-Tasking-Fähigkeit: Die Ware wird ausschließlich mit der rechten Hand einzeln nach und nach in den Korb gelegt. Die Kassiererin ist flink, sodass sich am Ende des Rollbandes die Waren schon türmen. Aber erst muss alles mit Bedacht verstaut werden. Danach wird mühselig nach dem Portemonnaie gesucht, während die Kassiererin schon gelangweilt wartet. Die Kundin fragt natürlich noch zweimal nach, wie viel sie zu zahlen hat, ehe sie dann doch noch ihre Bankkarte zückt. Bis ihr dann die PIN-Nummer wieder eingefallen ist, hätten schon drei Barzahler die Kasse passieren können.
Nach fünfundzwanzig Minuten tauchen Björn, Iris und Ronny aus dem Laden auf.
»Bis zum Supermarkt hinter der Urania wird der Sekt wohl reichen«, sagt Björn mit Käuferstolz.
Iris überglücklich zu Kathleen: »Schatz, es gab ganz frischen Salat. Hab für heute Abend welchen gekauft und dazu noch Essig und eine Flasche Olivenöl. Waren im Sonderangebot.«
Kathleen entgeistert: »Um Gottes Willen! Jetzt müssen wir das Zeug den ganzen Tag mitschleppen. Bis heute Abend ist der Salat bei der Hitze welk … und außerdem: Hej, wie geil, wir tanzen auf den Straßen mit Essig und Öl, während andere sich mit Sekt vollspritzen. Na toll.«
In die Runde gerichtet: »Das zum Thema: Frauen und Logik!«
Der Salat landet daraufhin im nächsten Abfalleimer. Iris nimmt den Essig. Kathleen packt die Flasche Olivenöl in ihren Rucksack.
Ronny hat keine weitere Plastiktüte dabei. Ich bin enttäuscht.
Stattdessen ist er jetzt ständig mit seinem Smartphone beschäftigt. Andauernd macht er mit ihm in der dunklen, weil zu niedrigen Kolonnade des Blocks zwischen der Hardenberg- und der Kantstraße nichtssagende Fotos. Fotos von den Imbissbuden, die den Fußgängerbereich zur Straße trennen. Fotos von den heruntergekommenen Läden, der Spielhölle und dem Geldwechsel. Von einem Gebäude, das nur noch auf seinen Abriss wartet.
»Ist das hier nicht extrem häßlich?«, stellt Ronny immer wieder fasziniert fest. »Der Architekt wollte wohl, dass es nach dem Krieg endlich ein unattraktives und billiges Gebäude für ein Bahnhofsviertel gibt. Passend zur Unterwelt. In diesem Ungetüm gibt es übrigens auch noch ein Hostel. Vielleicht werden dort die Zimmer auch stundenweise vermietet.«
Als wir an einem Zeitschriftenladen vorbeikommen, erzählt Wolfgang, dass er dort noch vor der Wende sein allererstes Pornomagazin gekauft hat. Für Ronny ein Grund, auch von dem Geschäft ein Foto zu machen. Der findet auch alles toll, was Wolfgang jemals gemacht hat.
Aber er hält sich dort nicht auf. Wenigstens kommt er dabei Schritt für Schritt voran.
Anders Björn. Der trödelt, weil er eine SMS nach der anderen an seinen geliebten Jan senden muss. Dabei bleibt er immer wieder stehen. Auch wenn er eine Antwort erhält.
»Wartet bitte mal. Jan lässt grüßen!«
Alle murmeln vor sich hin, dass bei wohlwollender Interpretion sich zu einem ‚Danke‘ deuten lässt.
Nur Kathleen dreht sich zu ihm um: »Sag mal, Björn, was schreibst du eigentlich die ganze Zeit?«
Björn: »An Jan … was wir gerade machen.«
Kathleen: »Irgendwie nervt das.«
Nach ein paar Schritten fragt sie ihn dann: »Wie lang seid ihr eigentlich schon zusammen?«
Björn: »Im August werden es zwei Jahre.«
Kathleen: »Soll das jetzt die Liebe für das ganze Leben sein?«
Björn nachdenklich: »Ja, aber wie soll ich das wissen?«
Wie soll er es auch! Jan ist Björns erster Freund überhaupt, der, der ihn zum schwulen Mann gemacht hat. Da fehlt noch die Erfahrung, wie eine Partnerschaft auf Dauer zu gestalten ist, vorausgesetzt, man will sich ewig binden. Wenn ich irgendwann einmal über fünfzig Jahre alt bin, dann kommt das vielleicht auch für mich infrage.
Jetzt nicht. Björn ist noch Teenager, und in dem Alter ist die Welt noch aus lauter Träumereien gemacht.
Bei mir waren es zwar eher Sexphantasien, aber warum sollte Björn nicht stattdessen an die große Liebe glauben. Jeder Mensch ist anders.
Mein Kommentar ist daher nur: »Ach, wie romantisch!«
Björn ist aber viel realistischer, als ich dachte. Er antwortet mir: »Nein, das hat nichts mit Gefühlsduselei zu tun. Seit sich meine Eltern scheiden ließen, weiß ich ja, wie zerbrechlich eine Beziehung sein kann.«
Nach einer kurzen Zeit ergänzt Björn: »Es wäre schön, wenn Jan und ich unser Leben lang zusammen blieben. Ich liebe ihn.«
Björns beschreibt rückblickend seine Kindheit als eher trostlos, so wie den Kolonnadengang, durch den er gerade geht:
Die Eltern hatten nach sieben Ehejahren begonnen, sich anzuschweigen. Der Vater zog sich oft in sein Arbeitszimmer zurück. Am Computer vergnügte er sich dann an Bildern von nackten Frauen. Die Seite wurde schnell weggeklickt, sobald sein Sohn in der Nähe war. Ihm zuliebe spielte er weiterhin den noch immer allein seine Gattin liebenden Ehemann. Dabei hatte die Mutter selbst in der Zeit diverse One-Night-Stands mit Männern, die sie über ihre Arbeit als Physiotherapeutin kennenlernte. Auf eine richtige Beziehung mit einem ihrer Liebhaber hatte sie sich aus Rücksicht auf ihren Jungen, aber auch auf ihren Gatten, nicht einlassen wollen.
Björns Eltern haben sich weder angeschrien noch versucht, sich mit giftigen Pfeilen gegenseitig zu durchbohren. Es war kein Hass. Sie hatten sich nur auseinandergeliebt. Die Luft in der Wohnung schmeckte abgestanden. Nach der traurigen Erkenntnis, dass ein einst glücklicher Lebensabschnitt endgültig vorbei ist. Wie der schal gewordene Champagner, den man am Tag nach einer großen Feier in den herumstehenden Gläsern findet. Zeit zum Aufräumen. Zeit der Trennung.
Die Eltern waren so mit sich selbst beschäftigt, dass keine Zeit für Björn blieb. Der musste mit allen Ängsten und Sorgen allein klarkommen – und von denen gab es täglich mehr, als es einer Kinderseele gut tut.
»Schwuchtel!« »Schwanzlutscher!« »Homo!«
So kreischten sich die Jungs gegenseitig an, ohne zu wissen, was die Wörter eigentlich bedeuteten. Um die Schwächeren fertig zu machen, damit man selbst zum Alpha-Tier der Klasse wird, reichte es schon aus, dass die Wörter laut ausgesprochen werden. In der Grundschule mobben sich die Erstklässler gegenseitig. Die Rangordnung in einem Rudel wird früh festgelegt.
Muttis bewunderten dafür insgeheim ihre Zöglinge. Die
Frau mit den verfilzten Haaren aus dem Naturkostladen geiferte wütend herum, als eine Kundin dem »süßen Mäuschen« von Sohn einen Lolli schenken wollte: »Unterlassen Sie diese femininen Ausdrücke.« Wenn sie auf die Aggressivität des Kindes angesprochen wurde, dann zuckte sie nur mit den Schultern: »Mein Sohn ist halt ein richtiger Junge. Nicht so ein Weichei!«
Ein Vater, der als Imam in einer Hinterhof-Moschee predigte, war zwiegespalten: »Einerseits ist es richtig, dass die Kinder früh lernen, dass Homosexualität mit dem Koran nicht vereinbar ist. Aber seinen Sohn als perverse Sau zu beleidigen, ist nicht in Ordnung. Das geht doch zu sehr gegen die Ehren eines jeden Türken.«
Den Lehrerinnen war sowieso alles egal, oder sie waren schlicht überfordert. Kein einziges Mal haben sie den ständigen Kämpfen unter den Schülern Einhalt geboten.
»Schwanzlutscher!« »Homo!«
Björn wusste bereits mit sechs, sieben Jahren, dass er damit gemeint war, auch wenn er nur selten das Opfer seiner Klassenkameraden war. Es gab genügend Schwächere. Aber er wusste in seinem tiefen Inneren, dass er anders als die anderen Jungs war. Was unterschied ihn eigentlich?
Er hatte keine Abneigung gegen das Fußballspielen. Da war er nicht anders als die anderen. Nur ob seine Mannschaft, in der er genauso gut und schlecht wie die anderen mitkickte, gewann, das war ihm egal. Ihm ging es allein um 90 Minuten Ästhetik.
Björn spielte nur selten mit den Mädchen, nicht viel öfter als die anderen Jungs. Die Mädchen hatten Barbie-Puppen, mit denen sie lediglich übten, wie eine Frau sich richtig nach einem Traumprinzen sehnt. Das war ihm zu verschroben.
Lieber spielte er dann allein mit seinen Playmobil-Figuren. Die waren wenigstens dem realen Leben nachgebildet. Da gab es den Bauarbeiter, den Polizisten, den Motorradfahrer, den Indianer oder den Cowboy, mit denen er die Village People hätte nachbilden können. Berufsbilder und Stereotypen, bei denen die Männer gut auszusehen haben und viel Haut zeigten. So wie Rolf, ein Arbeitskollege seines Vaters. Der trug in der Freizeit meistens nur ein viel zu kurzes T-Shirt, der Blicke auf den Rücken und die beginnende Arschfalte zuließ, so bald er sich bückte. Bauarbeiter-Dekolleté, nannte das seine Mutter verächtlich. Björn mochte ihn nicht nur deswegen, sondern auch, weil er so intensiv nach verschwitztem Mann roch.
Aber eine warnende Stimme in ihm sagte immer wieder: Das sind alles Vorlieben, die die anderen Schüler in der Klasse nicht haben. Er behielt sie besser für sich. Mit wem hätte er auch darüber reden können?
»Homo!«
Einen Wolfgang hat es für Björn damals nicht gegeben, jemand, der schon in seiner Kindheit über das Wort »Homo« als Schimpfwort gelacht hätte.
»Wenn das Schweine oder Rindviecher unter sich sagen würden, wäre das noch nachvollziehbar. Aber wenn sich Menschen gegenseitig als »Mensch« beschimpfen, dann zeugt es nur von Dummheit,« so erklärte Wolfgang es Björn, als dieser das erste Mal in der Katzenstube auftauchte.
Er hat ihm dann auch – leider Jahre zu spät – vorgeschlagen: »Wenn dich jemand als »Homo« beschimpft, antworte ihm, du seist stolz, ein Mensch zu sein. Erkläre ihm: Homo ist Latein und heißt nichts anderes als Mensch. Verstehst du? Aber du selbst gehst davon aus, dass der andere dann ein »Bovis«, ein Ochse, sein müsse.«
Es war an einem bedeckten, nicht allzu warmen Sommertag. Björn war mittlerweile auf dem Gymnasium, als er den Nachmittag im Freibad, das in einer Talsenke mitten in einem Hain gelegen ist, verbrachte. Ein idyllischer Ort mit mehreren Liegewiesen, einem Kinderbecken, einem Sportbecken und einem Drei-Meter-Turm. Hier spielte er manchmal mit anderen aus seiner Schule, wenn die es zuließen, Wasserball oder auf dem Rasen Fangen.
Wegen des Wetters hatten sich an dem Tag nur wenige Gäste und überhaupt kein Mitschüler ins Freibad verirrt. So lag Björn am Anfang noch etwas gelangweilt auf seinem Handtuch und beobachtete die Jugendlichen aus dem Schwimmsportverein, wie sie ihre Salti vom Ein-Meter-Brett übten. Seine Aufmerksamkeit wanderte dann weiter zum Sportbecken. Dort zogen die Vereinsschwimmer unter der strengen Aufsicht des Trainers ihre Bahnen. Allesamt erwachsene Männer mit breiten Schultern, die mit ihren Armen das Wasser durchpflügten.
Wieder zurück zum Brett: Als er einen der Wasserspringer mit seinen Blicken länger beobachtete, fing sein Herz an, heftig zu klopfen. Björn spürte plötzlich ein Kneifen und Zwicken seiner Badehose, die ihm plötzlich irgendwie zu eng geworden zu sein schien. Als er das Kleidungsstück zurechtrücken wollte, geriet er in Panik. Sein Penis war angeschwollen und durch eine gewisse Steife nicht mehr zu biegen.
Sein erster Gedanke: sofort damit zum Notarzt oder zumindest zu den Lebensrettern der DLRG. Dabei hatte er gar nicht mitbekommen, dass er an irgendetwas gestoßen oder sich sonstwo verletzt hätte. Außerdem tat sein Pimmel überhaupt nicht weh. Und da war ja der Wasserspringer, den er zwanghaft weiter beobachten musste, wie er ins kühle Nass tauchte. Trotzdem: diese Veränderung an seinem Körper war Björn einfach zu unheimlich. Vielleicht hatte sein Penis wegen einer Krankheit auch seine Größe verändert. Und was wäre, wenn das Glied jetzt abstürbe, wie bei Leprakranken oder nach Erfrierungen? Wie sollte er dann in Zukunft Wasser lassen? Sollte er sich doch untersuchen lassen? Der Wasserspringer kletterte aus dem Becken. Wasserperlen auf der Haut, die in der Sonne glänzten. Björn hörte sein eigenes Herz pochen. Aber wenn es nichts Ernsthaftes mit seinem Schwanz wäre, würde man ihn nur auslachen. Das wollte er auch nicht. Bei Schwellungen hilft ausgiebige Kühlung, hatte ihm seine Mutter schon als Kleinkind beigebracht. Er konnte nur eins machen: ab ins kalte Wasser!
Nach einer Stunde im Schwimmbecken war Björn ausgekühlt. Er traute sich noch immer nicht heraus, und er traute sich nicht, zu prüfen, ob an seinem Schwanz die Schwellung abgeklungen war. Das Freibad leerte sich merklich. Kurz vor Schließung war Björn einer der letzten im Wasser. Die Jungs aus dem Schwimmverein begannen bereits das Freibad aufzuräumen.
»Du solltest rauskommen. Deine Lippen sind schon ganz blau.«
Die Aufforderung kam von einem Jugendlichen, bei dem schon der erste Bartflaum über der Lippe zu erkennen war. Gerade der Wasserspringer, den er beobachtete, reichte Björn die Hand, sodass er leichter am Beckenrand herausklettern sollte.
»Nur Mut!«, forderte er ihn auf. Dann zog er ihn mit einem herzlichen Lächeln heraus. Schon dieses wärmte Björn auf. Der Jugendliche aus dem Schwimmverein war aber niemand anderes als Jan.
Der konnte sich zwar nicht mehr erinnern, dass er Björn einmal aus dem Wasser gezogen habe. Aber immerhin gehört sein Freund dadurch zu den wenigen, die sich an eine ihrer ersten bewussten Erektionen erinnern können, und er selbst hat sie ausgelöst. Das verbindet!
»Aber diese Unwissenheit … wie niedlich! Und das in einer Zeit, wo schon die Vorschulkinder mehr Wissen über Sex haben als ihre Urgroßmütter am Ende eines erfüllten Lebens. Beim Sexualkundeunterricht in der Schule muss er so etwas von gefehlt haben.«
Der strahlende Sonnenschein fällt in die letzten Meter des hässlichen Kolonnadengangs.
Iris fragt etwas verwirrt: »Kann denn ein Junge von zehn oder elf Jahren überhaupt schon eine Erektion haben?«
Wolfgang, typisch Oberlehrer: » Unter Umständen kann sogar schon der Penis eines Säugling sich aufrichten, habe ich mal gelesen. Aber natürlich kommt es erst mit der Pubertät zu Ejakulationen. Vorher übt der Körper nur ein wenig. Noch völlig ohne sexuellen Hintergedanken und meistens im Schlaf.«
Iris: »Ach ja.«
Wolfgang: »Richtiger Sex würde ein Kind in dem Alter vor allen Dingen seelisch völlig überfordern. Darum ist er zu Recht verboten.«
Iris: »Schon gut.«
Wolfgang: »Aber rechtzeitige Aufklärung und der Sexualkundeunterricht sind schon wichtig. Damit ein
Kind nicht in Panik verfällt, nur weil während der Pubertät mit seinem Körper etwas passiert, von dem er nicht vorgewarnt wurde. Stellt euch nur vor, ein Mädchen wüsste nicht, dass irgendwann die Blutung einsetzt.« Ich: »Es reicht, Wolfgang! Iris wollte doch nur wissen, ob ein Kind schon vor der Pubertät eine Erektion bekommen kann. Mehr nicht!«
Wolfgang zögernd: »Wie Björn geraten manche Jungs schon mit zehn Jahren in die Pubertät.«
Björn protestiert: »Ich war da schon etwas älter!«
Aber es scheint doch noch mehr Fragen zu geben. Mit Mühe können wir Iris davon abhalten, in das Erotik-Museum, das sich am Ende des dunklen Gang an der Ecke zur Kantstraße befindet, zu gehen. In das wollte sie schon immer einmal. Dort wird nicht im Sinne des großen Philosophen, sondern im Namen von Beate Uhse Aufklärung betrieben, auch wenn auf eine sehr kommerziellen Weise.
Ronny ist von der Idee begeistert: »In dieser Art von Völkerkundemuseum lernt man bestimmt viel über die Riten und Sitten heterosexuell veranlagter Menschen kennen.«
Kathleen vermutet dagegen, dass Iris sich nur kundig machen wollte, wie das mit dem Geschlechtsverkehr mit einem Mann funktioniert.
»Schatz, das ist wie mit deinem Sex-Spielzeug, nur dass bei dem Mann noch klebrige Flüssigkeit rausläuft.
Iris: »Also ist der Mann das Auslaufmodell unter den Dildos?«
Kathleen: »Aber wer will wirklich so etwas Unpraktisches und Unerotisches wie einen Mann in sich haben?«
Wir, die Schwulen, kreischen wie wild, protestierend und einfordernd, drauf los: »Wir, selbstverständlich!«
Endlich kommen wir am Kurfürstendamm an. Der Straßenrand ist bereits gesäumt von vielen Schwulen, Lesben und vielen Touristen aus aller Herren und Damen Länder, die auf die Parade warten. Auf dem Rasen des Grünstreifens zwischen den Fahrbahnen finden wir noch etwas Platz und postieren uns neben einer kleineren Coming-Out-Truppe von der Küste.
Iris und Thomas setzen sich sofort auf die Bordsteinkante, wischen sich den Schweiß von der Stirn. Wenigstens bieten hohe Bäume genügend Schatten. Björn öffnet die nächste Sektflasche. Jeder nimmt gierig einen Schluck.
Wolfgang stapft zur Apotheke auf der gegenüberliegenden Seite. Er hat seine Ohrstöpsel vergessen, sein Schutz vor der lauten Musik, die während des Zuges von den Wagen dröhnt. Ronny macht sich derweil mit seinen Tüten auf den Weg ins Café Kranzler.
»Bis gleich«, sind seine letzten Worte.
»… und wir sehen dich hoffentlich erst in ein paar Stunden wieder,« ergänze ich und will es auch glauben, denn Ronny, den mag ich nicht wirklich. Aber das ist ja bereits allen bekannt.
Jeden Morgen brachte ihn seine Mutter von der Landwirtschaft, die die Familie in einem der umliegenden Dörfer betrieb, mit dem schwarzen Fiat Panda zum Gymnasium. Nach der letzten Stunde holte sie ihn wieder ab. Danach nahm ihn sein Vater mit zur örtlichen Freiwilligen Feuerwehr und zum Schützenverein, also dorthin, wo die alteingesessenen Dorfbewohner unter sich blieben. Ronny sollte schon früh in das Gemeindeleben eingeführt werden. Ganz im Sinne seines konservativen Erzeugers übernahm er die ganze Stammtisch-Rhetorik, die er dann zu unserem Leidwesen in den Schulpausen zum Besten gab.
Ich daddelte auf meiner Spielkonsole. Gerade als ich das nächste Level erreichte, stieß Ronny auf mich zu: »Dieser kleine italienische Klempner ist doch nur was für Kinder und Mädchen, da gibt es gar keine geilen Tussis.«
»Super Mario spiele ich nur zu Hause. Das ist hier einfach nur Tetris«, antwortete ich ihm und bemühte mich, den Mr.-Möchtegern-Boombastic zu ignorieren.
Ronny versuchte es erneut: »Hast du auf MTV schon das geile Video von Shaggy gesehen – mit den Frauen, die so sexy tanzen?«
»Ich dachte, du stehst nur auf Madonna?«
»Ja auch, aber ihre Videos sind ja schon uralt. Das Geilste überhaupt ist aber Gangsta Rap. Die Musikclips musst du dir mal anschauen! Was für Weiber man da sehen kann! Wow«, quiekte seine noch vom Stimmbruch verschonte, kindliche Stimme, bei der man nicht sagen konnte, wie viel Ronny in ihr tatsächlich steckte. Wahrscheinlich hatte man wieder in den dörflichen Männerrunden davon geschwärmt.
»Im Schützenverein schießt man sich jetzt also auf Hip-Hop und Rap ein?«
Ronny ging drüber hinweg: »Das sind richtige Kerle, die auf niemanden Rücksicht nehmen, nicht mal auf sich selbst. Aber die haben immer scharfe Bräute.«
»Hat das dir auch dein Vater erzählt?«
Heute mag ich die Songs von Shaggy oder Sean Paul schon eher, aber trotzdem gilt für mich noch immer, was ich damals erwiderte: »Wollen die Rapper nicht doch auch nur Stars sein und viel Geld machen? Mit den Frauen – das ist doch alles nur eine Verkaufsmasche.«
Der Einwand schien Ronny nicht zu interessieren: »Ja und? Echte Männer wollen schließlich auch finanziell erfolgreich sein. Außerdem wissen die Rapper, was sich Frauen wirklich wünschen. Die müssen einfach nur richtig durchgefickt werden.«
Diese Phrasendrescherei hatte mich damals schon angewidert, wobei ich heute nicht einmal weiß, ob es einen Unterschied zwischen den Stammtischparolen und vielen Hip-Hop-Texten gibt. Wahrscheinlich ist der Rapper der neue Schützenbruder – im Herzen gleich spießig und langweilig. Ich ließ Ronny einfach stehen und verkrümelte mich auf eine andere Stelle des Schulhofes. Ungerührt spielte ich dort weiter mein Tetris, später zu Hause dann mit Super Mario. Da erreichte man wenigstens auch einmal eine höhere Ebene und blieb nicht auf diesem miesen, niedrigen Niveau hängen.
Zum neunten Schuljahr haben seine Eltern ihn urplötzlich auf ein Internat in Süddeutschland geschickt. Keiner wusste so recht, warum. Ronny war zwar ein Streber, auch wenn nicht Klassenbester, der aber das Abitur ohne weiteres auf unserem Gymnasium geschafft hätte. Auf die wenigen Nachfragen stieß man nur auf eine massive, undurchdringliche Mauer des Schweigens. Das Dorf, in dem Ronny lebte, hielt dicht.
Vor zwei Jahren stellte uns Iris und Kathleen ihren liebsten, schwulen Freund vor, den sie in ihrer Nachbarschaft kennengelernt hatten und der ursprünglich sogar aus unserer Gegend stammt. Ich fiel aus allen Wolken. Ausgerechnet Ronny brachte sie mit. Der gehörte zu denen, die ich mir nicht schwul hätte vorstellen können und wollen. Ich konnte es nicht fassen, und die Geschichte, die ich dann hörte, war einfach nur unglaublich: Seine Eltern hatten ihn damals von der Schule genommen, weil ausgerechnet Ronny mit einem gerade verheirateten Feuerwehrmann in flagranti erwischt wurde. Er war da gerade einmal fünfzehn Jahre alt, auch wenn man ihn wegen der vorhandenen Scham- und Körperbehaarung für wesentlich älter hätte halten können, und die Initiative ist nachweislich und massiv von ihm ausgegangen. Inspiriert sei er von irgendeiner Folge einer amerikanischen TV-Serie gewesen oder von einem Porno, den er irgendwo heimlich gesehen hatte. In dieser Vorlage zog eine etwas ältere Frau in einem Gerätehaus des New York Fire Departments vor einigen der uniformierten Kerle völlig blank. Die Firekeeper fand auch Ronny begehrenswert, sodass er sich schon einmal bei der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr etwas genauer umschaute, bis er die Szene bei einem Mann nachspielen konnte … Diese frühreife Schlampe!
Sein Vater wollte ihn lange Zeit nicht mehr sehen. Die Ehe des Feuerwehrmanns wurde geschieden. Der Gutachter im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren konnte bei ihm nicht einmal im Ansatz pädophile Neigungen feststellen. Trotzdem sollte er sich in Therapie begeben. Das war die einzige Auflage der Staatsanwaltschaft, um ihn glimpflich davonkommen zu lassen. Ronny ließ das alles scheinbar ungerührt und er ertrug das Internat geduldig. Nach dem Abitur machte er dann auch noch die berufliche Karriere, gerade dieses Miststück, das mich in der Schule mit Macho-Sprüchen nervte!
Der CSD-Zug hat sich noch immer nicht vom Savigny-Platz in Bewegung gesetzt. Mittlerweile ist es am Straßenrand kaum noch möglich, einen Stehplatz in der ersten Reihe zu kriegen. Kathleen reicht mir die Sektflasche. Ich nehme dankend zwei, drei Schluck und frage die edle Spenderin: »Sag mal, ist das mit dem Kinderkriegen ernst gemeint?«
»Iris redet seit mindestens zwei Wochen nur noch davon Wenn das noch länger dauert, dann muss der Wunsch wohl doch sehr, sehr groß sein.«
»Und du?«
»Es gibt Schlimmeres als ein Kind«, antwortet Kathleen mir.
Dann nach einem Moment sehr nachdenklich: »Es ist wirklich ihr größter Wunsch. Trotzdem erscheint mir das elende Leiden eines Menschen schon mit der Zeugung zu beginnen. Vatersuche, Sex mit einem Mann … Du verstehst schon, was ich meine.«
Ihre liebste Gattin hat sich derweil auf den Rasen hinter der letzte Zuschauerreihe gelegt, dort, wo die Bäume keinen Schatten mehr werfen. Mit der aufgeschlagenen SIEGESSÄULE schützt sie ihr Gesicht vor der prallen Sonne. Wofür Szeneblätter alles gut sein können. Mit einem reinen Internet-Blog wäre das zum Beispiel nicht möglich.
»Noch wehre ich mich ja gegen Nachwuchs, aber ein Kind täte unserer Beziehung ganz gut. Wir sind schon zu lange auf den eingefahrenen Bahnen.«
Kathleen betrachtet Iris voller Hingabe. Dabei wird mir klar, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es eine weitere Regenbogenfamilie mit einem kleinen Sohn oder Tochter geben wird. Es fehlt nur noch der richtige Anstoß.
»Wer soll das Kind austragen?« frage ich.
Kathleen: »Keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich es wohl sein. Bin ja beruflich flexibler. Meine Chefin erlaubt einer beschäftigten Mutter ausdrücklich, ihren Säugling mit in die Kanzlei zu bringen. Sie will es dann zwar in erster Linie selbst verhätscheln, aber damit hätte ich kein Problem. Aber der Akt, der erst einmal zur Schwangerschaft führt, ist für mich egal in welcher Form einfach nur unvorstellbar. Vielleicht wird dann doch Iris die Schwangerschaft auf sich nehmen müssen.«
Durch die Menschenreihe auf der anderen Straßenseite des Kurfürstendamms zwängelt sich Wolfgang. Mit Ohrstöpseln in den Händen kommt er wieder zu uns zurück. Mit dem Allheilmittel gegen betäubenden Lärm durch schnarchende Liebhaber, Autos, Techno-Beats auf dem CSD oder auch kreischende Kinder.
»Künstliche Befruchtung mit Sperma eines anonymen Samenspenders kommt übrigens nicht in Betracht. Der Sprößling soll später einmal wissen, wer sein biologischer Vater ist!« stellt Kathleen klar.
»Habt ihr euch denn schon einen Vater ausgeguckt?«, frage ich deshalb diesmal ernsthaft, da ja für die beiden Lesben Kinder auf keinen Fall vom Pizza-Lieferservice gebracht werden sollen.
»Nö, es soll aber schon ein echter Mann sein, der beruflich erfolgreich ist. Kein Weichei. Jemand, der nicht auf jeden und alles Rücksicht nimmt. Sportlich und gut aussehend. Wir wollen ja mit dem Kind nachher auch richtig angeben können.«
Kathleen grinst mich an. Irgendwo her kenne ich doch dieses Männerbild: »Also Ronny?«
Kathleen lacht laut auf. »An den habe ich überhaupt nicht gedacht. Der ist uns dann doch wieder etwas zu schwul!«
»Aber homosexuell sollte der Vater doch sein!«
»Klar, Schwule und Lesben müssen doch zusammenhalten.«
Verstehe die beiden Lesben, wer will. Die wollen tatsächlich einen Schützenbruder als Kind erzeugt von einer kerligen Schwuppe?
Und wieder grinst sie mich so auffordernd an.