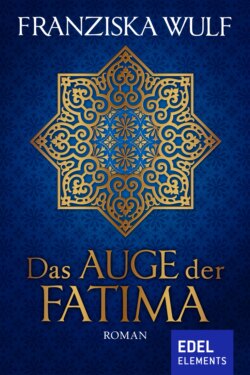Читать книгу Das Auge der Fatima - Franziska Wulf - Страница 8
4
ОглавлениеEin Diener nahm Saddin im Speisezimmer den schweren langen Reisemantel ab. Als Ali nun seinen unerwarteten Gast ohne dieses Kleidungsstück vor sich sah, drückte ihm die Angst die Kehle zu. Unter der dichten Wolle des Umhangs verborgen war der Nomade bewaffnet, als ob er sich auf einem Kriegszug befände. Zwei schimmernde Säbel und nicht weniger als fünf schlanke Dolche hingen an seinem Gürtel. Der Diener warf Ali einen erschrockenen Blick zu.
»Willst du die nicht auch ablegen?«, fragte Ali und deutete auf die Waffen.
»Nein. Es könnte sein, dass ich sie noch brauche.«
Ali spürte, wie ihm bei diesen Worten der Schweiß aus allen Poren ausbrach. War der Nomade etwa gekommen, um ihn zu töten?
»Nun, dann setz dich«, zwang er sich zu sagen und deutete auf eines der am Boden liegenden Polster.
Eine Weile saßen sie einander gegenüber, schweigend, und taxierten sich mit Blicken wie zwei Löwen, von denen einer in das Revier des anderen eingedrungen war. Es war noch nicht entschieden, ob sie gegeneinander kämpfen würden. Ali versuchte, Saddins forschendem Blick standzuhalten. Trotzdem war er erleichtert, als endlich ein Diener mit einem Krug herbeieilte und ihnen Wasser in zwei Becher einschenkte.
Während Saddin den Becher nahm und trank, ließ Ali ihn nicht aus den Augen. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder an ihn gedacht. Er hatte versucht, sich vorzustellen, was aus dem Nomaden geworden war. Er hatte sich dabei ausgemalt, dass er durch unsteten Lebenswandel fett und hässlich geworden war, mit schütteren, glanzlosen Haaren, schlechter, fleckiger Haut, einem teigigen Gesicht und einem Mund voller Zahnlücken. In Wirklichkeit jedoch hatte sich Saddin kaum verändert. Sein schwarzes, im Nacken zusammengebundenes Haar war immer noch genauso voll und dicht, sein glatt rasiertes Gesicht war ebenso schön wie bei ihrer letzten Begegnung. Seine Hände wie auch seine Gestalt waren schlank und seine Bewegungen so geschmeidig, als wäre seit damals keine Zeit verstrichen. Vielleicht stand Saddin ja unter dem Zauber eines Dämons, der ihm zu ewiger Jugend verhalf? Doch beim näheren Hinsehen merkte Ali, dass auch an Saddin das Alter seine Spuren hinterlassen hatte. Sein schwarzes Haar war von silbernen Fäden durchwirkt, und feine Linien zogen sich um seinen Mund und seine schönen dunklen Augen. Die Erkenntnis traf Ali wie ein schmerzhafter Faustschlag in den Bauch. Während er selbst alt geworden war und langsam, aber sicher den unausweichlichen Verfall seines Körpers spürte, machte den Nomaden das voranschreitende Alter nur noch attraktiver. Natürlich, er hätte es wissen müssen. Luzifer sorgte für seine Söhne.
»Verzeih mir meine Unhöflichkeit«, sagte Ali schließlich und wandte den Blick ab. Er wollte nicht, dass Saddin seine Eifersucht bemerkte. »Ich sollte dich wohl freudiger begrüßen, dich unterhalten und sogleich mit dir ein Gespräch über die vergangenen Jahre beginnen, so wie es eben unter Männern üblich ist, die sich gut gekannt und lange nicht gesehen haben.« Er holte tief Luft. »Doch es tut mir leid, ich bin noch viel zu überrascht über deinen unerwarteten Besuch, um allen Regeln der Höflichkeit und Gastfreundschaft gerecht zu werden.«
Saddin schüttelte den Kopf und lächelte. Seine makellosen Zähne schimmerten wie weiße Perlen, und Ali spürte, wie nicht einmal er sich dem Charme und dem Zauber dieses Mannes entziehen konnte. Dabei hatte er wohl mehr Gründe, Saddin zu hassen, als jeder andere Mensch auf der Welt. In der Tat, der Nomade war in den vergangenen Jahren noch gefährlicher geworden.
»Glaube mir, Ali, du hast mir bereits jetzt mehr Höflichkeit und Gastfreundschaft erwiesen, als ich jemals erwartet habe«, sagte er mit seiner samtenen Stimme. »Wir waren nicht gerade Freunde, als wir uns das letzte Mal gesehen haben.«
Welch wahres Wort!, dachte Ali. Tatsächlich hatte er Sad-din damals nichts weniger als den Tod gewünscht. Und wäre Beatrice nicht gewesen, er hätte ihn bestimmt einfach krepieren lassen.
»Aber wir waren ehrlich zueinander«, fuhr der Nomade fort. »Eine Eigenschaft, die ich über alles schätze. Außerdem sind wir keine Jünglinge mehr. Wir werden weder Floskeln noch Regeln brauchen. Schließlich weiß jeder von uns, wo der andere steht.«
Ali nickte. Saddin wollte also, dass sie ganz offen miteinander sprachen, ohne den Mantel der Höflichkeit, den der Koran als Zeichen der Gastfreundschaft von den Gläubigen forderte. Und das konnte nur bedeuten, dass er nicht vorhatte, ihn zu töten. Wenigstens nicht heute Abend.
»Nun gut, keine höflichen Phrasen mehr. Weshalb bist du hier, Saddin?«, fragte er und sah den Nomaden forschend an. »Warum kommst du ausgerechnet zu mir? Geht es um das Mädchen?«
Saddin neigte den Kopf.
»Ist sie deine Tochter?«, fragte Ali barsch und goss sich erneut Wasser ein. Mit einem Mal verspürte er das dringende Bedürfnis zu trinken, viel zu trinken. Vermutlich würde er an diesem Abend einen ganzen Krug allein leeren. Und doch würde das Wasser aller der Stadt Qazwin zur Verfügung stehenden Brunnen wahrscheinlich nicht ausreichen, um jenes Feuer zu löschen, das in ihm brannte; diese schmerzhafte Erinnerung, die bereits den ganzen Tag in ihm geschwelt hatte und durch Saddins unwillkommenes Auftauchen zu einem Inferno entfacht worden war. »Braucht sie die Hilfe eines Arztes? Wenn dies der Fall ist, warum hast du nicht jemand anderen aufgesucht? Es gibt Hunderte von Ärzten in allen Städten der Gläubigen. Warum bist du nicht nach Bagdad, Isfahan oder Gazna gegangen? Wieso bist du ausgerechnet zu mir gekommen? Und warum hast du von Verfolgern gesprochen? Bist du etwa mit dem Mädchen auf der Flucht?«
Saddin antwortete nicht sofort. Er sah Ali lange an, ernst und nachdenklich.
So als ob er sich plötzlich nicht mehr sicher wäre, ob er mir vertrauen kann, dachte Ali nicht ohne Bitterkeit. So, als ob er seine Entscheidung, mich um Hilfe zu bitten, noch einmal überdenken müsste.
»Auf welche Frage soll ich dir zuerst eine Antwort geben?«, erwiderte Saddin schließlich und starrte auf den Boden. Seine schlanken, lediglich mit zwei silbernen Ringen geschmückten Hände drehten unablässig den schweren Messingbecher hin und her. »Zuerst möchte ich mich bei dir für mein unerwartetes Erscheinen entschuldigen. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, ich hätte dir einen Boten gesandt, um meinen Besuch anzukündigen und dir die Gelegenheit zu geben, einen anderen, einen besseren Zeitpunkt für unser Treffen zu wählen. Aber es ging nicht. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste schnell handeln.« Er blickte auf. »Dieser Besuch, Ali al-Hussein, ist kein Besuch, wie er unter Geschäftspartnern üblich ist. Und sofern ich eine Möglichkeit gesehen hätte, dich nicht in dieser Angelegenheit zu belästigen, hätte ich diese ergriffen. Glaube mir, ich habe lange darüber nachgedacht, aber es gab keine Alternative. Ich kam zu dir, weil du, Ali al-Hussein, der einzige Mann auf der Welt bist, zu dem ich gehen konnte.«
Ali spürte, wie sich seine Nackenhaare zu sträuben begannen. Etwas in der Stimme des Nomaden verriet ihm, dass dies hier eine überaus ernste Sache war, etwas, bei dem es um mehr als Leben und Tod ging. Falls es so etwas überhaupt gab.
»Sprich«, sagte er und hoffte, dass Saddin seine innere Spannung nicht bemerkte. »Worum geht es?«
»Ich werde weiter ausholen müssen, damit du es verstehst. Es dreht sich in der Tat um das Mädchen, das bei mir ist«, antwortete Saddin. »Ihr Name ist Michelle. Und, um eine deiner zahlreichen Fragen zu beantworten, sie ist nicht meine Tochter. Sie stammt noch nicht einmal aus diesem Teil der Welt. Obwohl sie noch klein ist, ist sie schon weit gereist, sehr weit. Weiter als du oder ich jemals reisen werden.« Er sah an Ali vorbei in die Ferne. »Vor etwa einem Monat fand ich Michelle mitten in der Wüste. Mein Pferd stolperte beinahe über sie. Sie war allein, weit und breit gab es keinen Menschen, keine Spuren, gar nichts. Sie lag einfach dort im Staub und schlief, als hätte ein Engel sie auf seinem Weg durch die Wüste aus seinen Armen verloren. Damit das Mädchen nicht verdurstete oder gar Sklavenhändlern oder einem Raubtier zum Opfer fiel, entschloss ich mich, es mitzunehmen.«
»Die Kleine lag einfach so in der Wüste?«, fragte Ali mit heiserer Stimme. Sein Herz klopfte bis zum Hals. Er hatte schon einmal eine ähnliche Geschichte gehört. Damals, als der Emir von Buchara eine Sklavin für seinen Harem gekauft hatte, die Sklavenhändler mitten in der Wüste »gefunden« hatten. Ali hatte den Befehl bekommen, sie zu untersuchen. Diese Sklavin war Beatrice gewesen. »Bist du sicher?«
Saddin nickte. »Ja. Ich weiß, woran es dich erinnert. Auch ich musste sofort an...«, er brach ab und schloss kurz die Augen, »... an sie denken. Und tatsächlich hat Michelle ebenfalls einen Stein bei sich. Es ist wieder ein Saphir...«
»Ein Saphir?« Ali sprang erregt auf. »Etwa einer der Steine der Fatima? Du willst also damit sagen, dieses kleine Mädchen ist auch mit einem Stein der Fatima gereist?«
Wieder nickte Saddin, langsam und bedächtig.
»Es ist kein Zweifel möglich. In den vergangenen Jahren habe ich mich überall nach den Steinen der Fatima umgehört. Ich bin zwar kein Gelehrter wie du, und viele Quellen des Wissens stehen mir nicht zur Verfügung, dafür höre ich die Sagen und Legenden der Alten, die Geschichten der Mönche und Wahrsager. Ich weiß mittlerweile, dass diese Steine die Macht haben, ihre Hüter auf seltsame Reisen zu schicken. Und ich weiß auch, woran man einen Stein der Fatima von einem gewöhnlichen Saphir unterscheiden kann. Jener Stein, den Michelle in ihrer Hand hielt, als ich sie weitab von jeder menschlichen Siedlung in der Wüste fand, trug alle Merkmale.« Er machte erneut eine Pause. »Außerdem sind bereits die Häscher auf der Spur des Steins. Allah allein weiß, auf welchen dunklen Wegen diese Ratten vom Stein der Fatima Wind bekamen, denn ich war allein, als ich Michelle fand, und du bist der Erste, mit dem ich darüber spreche. Dennoch tauchten nur wenige Tage später Fidawi in meinem Lager auf. Es kam zu einem heftigen Kampf. Es gelang mir zwar, zwei von ihnen zu töten, doch die anderen beiden konnten leider entkommen. Daraufhin beschloss ich, mit dem Kind zu fliehen, um es in Sicherheit zu bringen. In Sicherheit bei dem einzigen Mann, von dem ich weiß, dass ich ihm in diesem Fall vertrauen und ihm die Wahrheit erzählen kann – bei dir, Ali al-Hussein.«
Ali räusperte sich. »Diese Fidawi, was sind das für Männer?«
»Sie sind Mitglieder eines geheimen Ordens«, antwortete Saddin.
»Mönche?«, fragte Ali ungläubig. »Du willst damit sagen, dass es Mönche waren, die euch angegriffen haben?«
»Wenn du sie so nennen willst, ja. In gewisser Weise kann man sie wirklich als Mönche bezeichnen. Sie fasten, sie beten, sie haben den Verlockungen der Welt entsagt und lehnen sogar die Beziehung zu Frauen ab. Aber sie sind auch bereit, den Koran zu verteidigen. Ihrem Großmeister, dessen Namen und Gesicht außer ihnen niemand kennt, schulden sie blinden Gehorsam. Er wählt sie persönlich aus, und er oder einer seiner engsten Vertrauten bereitet sie auf ihre Aufgabe vor -für den Koran zu töten und dabei, falls nötig, selbst zu sterben. Für manch einen sind sie Heilige, Märtyrer.« Saddin zuckte gleichmütig mit den Schultern. »Wenn du jedoch meine ehrliche Meinung über sie hören willst, ich glaube, sie sind nichts weiter als in allen Kampfkünsten ausgebildete Mörder. Fanatisch bis zum Wahnsinn und beseelt von dem einzigen Gedanken, die Welt von den Menschen zu befreien, die sie selbst als Ungläubige bezeichnen, schrecken sie vor nichts zurück. Gerüchten zufolge nehmen sie sogar freudig ihren eigenen Tod in Kauf. Angeblich soll Allah sie zur Belohnung sofort in das Paradies aufnehmen und ihre Namen im Buch der Gerechten aufzeichnen.« Er schnaubte verächtlich. »Meinen Informationen nach muss ihr Schlupfwinkel hier irgendwo in den Bergen von Qazwin liegen. Aber leider weiß ich nichts Genaues.« Er sah träumerisch in die Ferne. »Ich würde mein Leben geben, wenn es mir gelänge, diese Bande auszuräuchern und ihnen das Handwerk zu legen, bevor sie sich über die ganze Welt ausbreiten können wie die Pest. Aber wer weiß, vielleicht gelingt es ja einem anderen.«
Ali griff an seinen Kragen und lockerte sein Gewand. Es schien mit einem Mal merkwürdig eng zu sein.
»Und diese Fidawi sind deine Verfolger.«
»Ja. Wie ich vorhin sagte, sind zwei von ihnen leider entkommen. Dass es mir gelungen ist, diese Ratten zu vertreiben, bedeutet nämlich nicht, dass sie ihre Verfolgung auch aufgeben werden. Fidawi sind unerbittlich. Nur der Tod kann sie davon abhalten, eine einmal begonnene Jagd zum Ende zu bringen.« Saddin runzelte die Stirn. »Sie werden unsere Spur finden, Ali. Früher oder später. Sie werden uns verfolgen, bis sie ihr Ziel erreicht haben.«
»Bis sie uns alle getötet haben?«, flüsterte Ali.
Saddin nickte. »Es sei denn, es gelingt uns, ihnen zuvorzukommen.«
Ali wurde still. Er sollte also das Mädchen vor den Fidawi beschützen. Verlangte Saddin etwa, dass er angesichts der ihm zugedachten Aufgabe in Jubel ausbrach? Das war wirklich zu viel verlangt. Immerhin ging es hier nicht um irgendetwas. Wenn Saddin sich nicht geirrt hatte, wenn dem Mädchen wirklich diese Fidawi auf den Fersen waren und diese Männer das waren, was Saddin befürchtete, wurde es mehr als nur gefährlich. Dann konnte allein die Tatsache, dass er das Mädchen beherbergte, seinen Tod bedeuten.
»Und nur, weil ich auch schon mal etwas vom Stein der Fatima gehört habe, soll ich mich jetzt um dieses Mädchen kümmern?«, fragte er schwach.
»Nein. Du kannst mir nichts vormachen, Ali al-Hussein, du weißt viel mehr, als du jetzt zugeben willst. Denn auch du hast in den vergangenen Jahren nach den Steinen geforscht. Du kennst ihre Macht, auch wenn du sie vielleicht noch nicht verstehst.«
»Woher...« Er brach ab und riss die Augen auf, als er begriff. »Du hast mich beobachten lassen? All die Jahre hindurch? Natürlich. Ich hätte es mir ja gleich denken können. Wie hättest du mich sonst hier in Qazwin finden sollen.«
»Ja, ich gebe zu, dass ich zu jeder Zeit wusste, wo du dich gerade aufhältst.« Saddin lächelte und machte eine Geste, als wollte er sich entschuldigen. »Keiner von uns beiden hat sich in den vergangenen Jahren geändert, Ali. Dich beschäftigen weiterhin die Sterne, die Wissenschaften und deine Bücher. Mich hingegen interessieren immer noch Informationen.«
»Dann musst du ja auch wissen, was du da von mir verlangst«, rief Ali aufgebracht. Er sprang auf und begann im Zimmer hin und her zu gehen. »Ich habe diesen Fidawi nichts entgegenzusetzen, Saddin. Ich bin kein Krieger oder Schwertkämpfer, ich bin Arzt! Noch dazu einer, der wegen seiner Ideen und Ansichten ohnehin immer wieder mit Herrschern und Geistlichen aneinandergerät, sogar mit solchen, die ich nicht als Fanatiker bezeichnen würde. Oder warum habe ich wohl in den vergangenen Jahren so oft meinen Aufenthaltsort gewechselt? Oft genug war ich selbst schon auf der Flucht, und so mancher Fürst in den Städten der Gläubigen wünscht sich meinen Tod. Die Fidawi werden sich alle Finger danach lecken, mich zu töten – eine weitere Sprosse auf ihrer Leiter zum Paradies. Es wird ihnen eine Freude sein, mich in Stücke zu schneiden und über dem Feuer zu rösten.«
»Natürlich blieben mir deine Schwierigkeiten keineswegs verborgen, Ali«, erwiderte Saddin ruhig. »Ich kenne die Gründe für deine rastlosen Wanderungen sehr gut. Trotzdem ist Michelle bei dir am sichersten. Denn falls ihre Mutter kommt, um nach ihr zu suchen, wird sie zuerst zu dir gehen.«
Ali sah Saddin verständnislos an.
»Und wieso?«
»Weil ihre Mutter dich kennt, und weil...« Er fixierte Ali mit seinem Blick. »Weil sie dich einst geliebt hat.«
Ali zuckte zusammen, als hätte Saddin ihm einen Kübel eisig kaltes Gebirgswasser über den Kopf geschüttet. Er begann zu zittern.
»Du meinst...« Seine Stimme erstarb. Er weigerte sich, den Gedanken weiterzuspinnen, aus Angst, Saddin würde seine zart keimende Hoffnung mit einer einzigen Geste, einem einzigen Wort wieder zunichtemachen.
»Ja, Ali. Ihre Mutter ist Beatrice.«
Ali ließ sich wieder auf sein Polster fallen und sank kraftlos in sich zusammen.
»Hast du...«, er stockte und fuhr mit seiner Zunge über seine trockenen Lippen. »Hast du sie gesehen? Beatrice? Bist du ihr begegnet?«
Saddin schüttelte den Kopf. »Nein. Ich sah sie das letzte Mal an jenem Tag, als ich Buchara verlassen habe.«
»Woher weißt du dann, dass dieses Mädchen ihre Tochter ist?«, fuhr Ali ihn an. »Wie kannst du so etwas wissen?«
Ein Lächeln überzog das Gesicht des Nomaden, ein Lächeln voller Zärtlichkeit.
»Du brauchst diesem Kind nur in die Augen zu sehen. Sie ist Beatrices Tochter. Sie hat die gleichen Augen, das gleiche Lächeln, das gleiche goldene Haar. Wenn man sie beobachtet, haben sogar ihre Gesten Ähnlichkeit.«
Ali schloss die Augen. Ihm wurde plötzlich schwindlig. Sollte es tatsächlich wahr sein? Sollte Saddin recht haben und dieses Mädchen, das jetzt auf den Strohsäcken in seinem Besucherzimmer lag und friedlich schlief, Beatrices Tochter sein? Das war schier unvorstellbar. Mit zitternder Hand griff er nach dem Wasserkrug, schenkte sich den Becher bis zum Rand voll und stürzte ihn in einem Zug hinunter. Das kalte Wasser rann durch seine ausgedörrte Kehle, doch das Schwindelgefühl blieb. Er bekam kaum noch Luft. Das konnte alles nicht wahr sein. Saddin trieb lediglich sein Spiel mit ihm, so wie er es schon immer getan hatte. Das Spiel einer Katze mit einer Maus.
»Du lügst«, stieß er hervor. Und in diesem Augenblick, da er die Worte ausgesprochen hatte, wurde es ihm zur Gewissheit. Der Nomade hatte ihn angelogen. Das Märchen vom Stein der Fatima, von rätselhaften Verfolgern und Geheimorden hatte er sich nur ausgedacht. Es konnte gar nicht anders sein. Erfolgreich unterdrückte er jene innere Stimme, die ihm etwas anderes zuflüstern wollte. Der Dattelschnaps half ihm dabei. »Du lügst mit jedem Wort, das aus deinem Mund...«
»Ich habe dich noch nie belogen, Ali al-Hussein«, unterbrach ihn Saddin scharf. »Weshalb sollte ich es ausgerechnet jetzt tun?«
»Wirklich?« Ali lachte auf. »Du hast mich doch vom ersten Tag an belogen, als wir uns begegnet sind. Du hasst mich. Du hast mich schon immer gehasst, weil Beatrice mich geliebt hat und nicht dich. Weil sie bei mir geblieben ist. Und jetzt willst du mir dieses Kind unterschieben. Und du hast diese... diese Fidawi auf meine Spur gelockt, falls sie überhaupt existieren. Du hast sie auf meine Fährte geführt, damit sie endlich das vollbringen, was du selbst nicht geschafft hast – mich zu töten. Du willst...«
Saddin erhob sich. Sein Gesicht war weiß vor Zorn. »Du gehst zu weit, Ali al-Hussein«, sagte er, und seine Stimme zitterte vor mühsam unterdrückter Wut. »Selten hat ein Mann es gewagt, mich derart zu beleidigen. Jeder andere würde jetzt bereits mit durchschnittener Kehle zu meinen Füßen liegen. Du solltest deinem Schöpfer dankbar sein.« Saddin ging mit langen Schritten durch das Speisezimmer. »Wenn es jemals meine Absicht gewesen wäre, dich zu töten, Ali al-Hussein, hätte ich es schon längst getan. Schon vor Jahren. Und ich habe es gewiss nicht nötig, dir zu erklären, dass ich dazu nicht auf die Hilfe der Fidawi angewiesen bin.«
Ali spürte, dass er zu weit gegangen war. Dennoch hob er trotzig sein Kinn.
»Und warum bist du dann bei mir aufgetaucht?« Saddin fuhr herum. »Dummkopf!«, herrschte er ihn an. »Ich dachte, das hätte ich dir eben erklärt. Hast du mir nicht zugehört? Hast du nicht ein Wort von dem verstanden, was ich dir gerade gesagt habe? Michelle braucht deine Hilfe. Die Fidawi sind ihr auf den Fersen, weil sie einen Stein der Fatima besitzt. Und sie ist Beatrices Tochter. Wenn Beatrice kommt, um nach ihr zu suchen, wird sie es natürlich zuerst bei dir tun. Hast du es jetzt begriffen?« Er machte eine Pause. Es schien ihn große Mühe zu kosten, nicht endgültig die Kontrolle über sich zu verlieren. Die Muskeln an seinen Schläfen arbeiteten. »Vermutlich fällt es dir schwer, mir zu glauben, aber ich habe dich nie gehasst, nicht einen Augenblick lang. Vielleicht hätte ich dich aus Eifersucht töten können, damals, in jenen Tagen, bevor ich Buchara verließ. Aber es hätte ohnehin nichts genützt. Beatrice war eine Frau, wie sie mir weder vorher noch nachher jemals wieder begegnet ist. Sie hatte ihren eigenen Willen, sie war frei und unabhängig wie ein Mann. Sie konnte zwischen uns beiden entscheiden, und ihre Wahl ist auf dich gefallen. Hätte ihr Entschluss anders gelautet, keine Macht der Welt hätte sie daran hindern können, mit mir zu kommen.« Saddin sah Ali an. Plötzlich glätteten sich die zornigen Falten auf seiner Stirn, und Erstaunen trat auf sein Gesicht. »Jetzt verstehe ich. Du hast es nicht gewusst. Nie warst du dir sicher, ob es wirklich der Stein war oder ob sie nicht doch mit mir fortgegangen ist.«
»Ich... ich...«, stammelte Ali. Er war verwirrt. Saddin hatte ausgesprochen, was er bislang nicht einmal vor sich selbst zugegeben hatte. »Beim Barte des Propheten!«, rief er schließlich aus. »Woher hätte ich es denn wissen sollen?«
Der Nomade ließ sich wieder auf sein Polster sinken. Er stützte den Kopf auf die Knie und strich sein Haar zurück.
»O Ali al-Hussein, was bist du doch für ein Narr, ein blinder, tauber Narr! Die Zeit, die du mit ihr verbracht hast, die Jahre des Forschens, dein Wissen über die Steine der Fatima -das alles hat nicht ausgereicht, um dir Gewissheit zu geben? Die vergangenen Jahre müssen für dich die Hölle gewesen sein.« Er sah Ali an, und in diesem Blick lag Verständnis. »O Ali! Hast du denn nie gemerkt, wie sehr sie dich geliebt hat? Beatrice hätte dich niemals verlassen. Nicht für alles Gold der Welt und für keinen anderen Mann. Auch nicht für mich.«
»Aber was war dann mit euch beiden?«, fragte Ali sofort. »Erzähle mir nicht, dass zwischen euch nichts gewesen ist, dass ihr euch nicht geliebt habt. Ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Sie hat dich geküsst! Noch dazu in meinem Haus!«
»Ja, Ali. Und doch... Was zwischen mir und Beatrice war, ist etwas ganz anderes. Es lässt sich nicht vergleichen. Wir haben von Anfang an gewusst, dass es nur von begrenzter Dauer sein würde. Es war wie ein Sprung in den kühlen See einer Oase nach einem langen, heißen Ritt durch die Wüste. Doch niemand kann für immer in kaltem Wasser baden, ohne irgendwann zu frieren. Und so wäre es auch uns beiden ergangen. Eines Tages hätten wir genug voneinander gehabt.« Saddin lächelte. »Allah hat uns in seiner unendlichen Güte genau so viel gemeinsame Zeit geschenkt, wie wir ertragen konnten.«
Ali spürte, wie sich sein Magen verkrampfte. Der Nomade war wie ein Mann, der einen Blick auf einen sagenumwobenen Schatz hatte werfen dürfen und diesen aus eigenem Willen abgelehnt hatte, weil er erkannt hatte, dass das Gold und die Juwelen ihm kein Glück bringen konnten.
»Du bist zu beneiden, Saddin«, sagte Ali leise.
Der Nomade zuckte mit den Schultern. »Jeder trägt das Schicksal, das Allah ihm zugedacht hat.«
»Ja, nur scheint es, als ob manche Menschen schwerere Lasten zu tragen hätten als andere.«
»Wirklich?« Saddin warf Ali einen kurzen Blick zu und sah dann auf seine Hände hinab. Er zog seine Augenbrauen zusammen, als ob er plötzlich Schmerzen hätte. »Ich habe dir nicht erzählt, dass bei den Kämpfen mit den Fidawi auch zwei Kinder gestorben sind. Einer meiner Söhne und meine Tochter. Sie war kaum älter als Michelle. Ich konnte sie nicht mehr retten. Die Fidawi waren zu schnell.« Er rieb sich die Stirn. »Natürlich hätte ich Michelle einfach dort lassen können, wo ich sie gefunden habe. Ich hätte uns – meiner Familie, meinen Männern und ihren Familien – viel Leid ersparen können. Aber ich tat es nicht. Soll ich mich jetzt etwa darüber grämen, mir die Haare raufen und vor Verzweiflung gegen die Brust schlagen, weil Allah mir einen Verstand und einen freien Willen gegeben hat und ich beides genutzt habe, um eine Entscheidung zu treffen? Eine Entscheidung, die mich vermutlich ebenfalls mein Leben kosten wird?« Er sah Ali an, und ein seltsames Lächeln umspielte seine Lippen. »Ich bitte dich nicht darum, mir zu helfen, Ali al-Hussein. Ich werde dein Haus noch vor dem Morgengrauen wieder verlassen und hoffen, dass es mir gelingt, die Fidawi von Qazwin fort auf meine Spur zu locken. Ich bitte dich für Michelle, die Tochter von Beatrice. Nimm das Mädchen auf und gib ihm ein Zuhause, als wäre es dein eigenes Kind.«
Ali wurde erneut schwindlig. Vielleicht lag es an dem Dattelschnaps, der immer noch seine Wirkung in seinem Körper entfaltete, vielleicht aber auch an dem Sturm, der in seinem Innern tobte, ausgelöst durch all das, was er an diesem Abend erfahren hatte.
»Lass uns nach oben gehen, auf den Turm«, keuchte er. »Ich brauche frische Luft. Ich muss nachdenken, ich muss...«
»Ich kann dich verstehen«, sagte Saddin, erhob sich leichtfüßig und half Ali auf die Beine. »Doch ich flehe dich an, denke nicht zu lange nach. Die Zeit ist knapp.«
Ali stützte sich auf den Nomaden wie ein altersschwacher, vom Leben gebeugter Greis. In diesem Augenblick hätte sicherlich niemand vermutet, dass sie in Wahrheit gleichaltrig waren. Langsam und bedächtig stiegen sie die Stufen zum Turm empor. Saddin öffnete die Tür, und sie traten gemeinsam auf die Plattform hinaus. Über der Stadt lag die Stille der Nacht. Nur vereinzelt waren an der nahe gelegenen Palastmauer die Feuer der Wachen zu sehen. Schwarz und drohend wie ein mahnender Finger erhob sich das Minarett der Moschee in den klaren Nachthimmel.
Hier stehe ich immer, dachte Ali und atmete gierig die kühle Luft ein. Hier stehe ich mit meinem Fernrohr und beobachte die Sterne, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Wenn mich Träume wecken oder die Gedanken an Beatrice mich keinen Schlaf finden lassen. Beatrice. Immer wieder Beatrice.
»Was wirst du tun, wenn ich das Kind nicht in meinem Haus aufnehme?«, fragte Ali.
Saddin sog hörbar die Luft ein.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte er leise. »Ich... Ehrlich gesagt habe ich darüber gar nicht nachgedacht, weil ich fest damit gerechnet habe...« Er brach ab und stützte sich auf die hüfthohe Mauer, welche die Plattform umgab. Es hatte fast den Anschein, als ob ihm jetzt zur Abwechslung schwindlig wäre. »Ich hatte angenommen, dass ich dich überzeugen könnte.« Er sah Ali an. »Ich konnte dich doch überzeugen, oder?«
Ali starrte in den Sternenhimmel hinauf, nur um Saddins Blick nicht erwidern zu müssen. In den dunklen Augen des Nomaden lag keine Verachtung, kein Zorn, sondern nur Fassungslosigkeit und abgrundtiefe Verzweiflung.
»Verstehe mich nicht falsch, Saddin, aber ich habe Schwierigkeiten, in die ich kein Kind hineinziehen möchte. Diese Kleine hat das nicht verdient. Wer weiß, vielleicht muss ich schon nächsten Monat Qazwin wieder verlassen, vielleicht sogar noch früher. Sie würde ein rastloses Leben führen, nirgendwo wäre sie zu Hause. Ich lebe wie auf Treibsand. Sobald dem Emir meine Nase nicht mehr gefällt oder ich ein falsches Wort sage, gehöre ich zu den Verrätern und werde verfolgt. Ich...« Er holte tief Luft und versuchte das bohrende Gefühl in seinem Bauch zu ignorieren, bei dem es sich ohne Zweifel um sein Gewissen handelte. »Ich fürchte einfach, ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen.«
Saddin schloss die Augen.
»Es tut mir leid«, sagte Ali und legte dem Nomaden eine Hand auf die Schulter. »Wirklich. Aber du weißt ja, wie so etwas ist. Immer auf dem Sprung. Nie kann ich sicher sein. Jederzeit bin ich bereit, meine Sachen zu packen und die Stadt zu verlassen. Abgesehen davon bin ich kein Krieger, Saddin. Bei dir ist die Kleine wirklich besser aufgehoben.« Er zog seine Hand wieder zurück. Sein Gewissen schien ihm ein Loch in den Leib brennen zu wollen. »Was wirst du jetzt tun? Gehst du zu deinen Leuten, zu deiner Familie zurück?«
Saddin schüttelte den Kopf. Er wirkte ein wenig benommen, so als müsste er sich erst von einem Faustschlag erholen. Dem gewaltigen Faustschlag eines Riesen.
»Die Fidawi haben bereits vier meiner Männer getötet, sie haben meiner eigenen Familie großes Leid zugefügt. Ich kann sie nicht noch einmal dieser Gefahr aussetzen.« Er sah hinauf in den Sternenhimmel, und Ali hatte den Eindruck, dass in den Augen des Nomaden Tränen schimmerten. Dieser Anblick war kaum zu ertragen. Doch was sollte er tun? Er hatte wirklich keine Wahl. »Wahrscheinlich werde ich mit Michelle einfach weiterreiten. Kreuz und quer durch die Wüste und keine zwei Tage am selben Ort verbringen. Wer weiß, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht ist Allah gnädig, und die Fidawi verlieren irgendwann unsere Spur. Oder es gelingt mir, sie rechtzeitig zu töten.«
»Saddin, ich...«
Ali brach ab. Er hörte hinter sich ein leises Klatschen, als ob etwas auf den Steinboden des Turms gefallen wäre. Saddin fuhr herum, und im selben Augenblick kletterten zwei Schatten geschickt und nahezu lautlos über die Turmmauer.
»Fidawi!«, zischte der Nomade grimmig und zog seine Schwerter. »Diese Söhne einer räudigen Hündin haben uns gefunden. Falls du mir jetzt immer noch nicht glaubst, Ali, so gehe auf sie zu. Wer weiß, vielleicht gelingt es dir sogar, einfach durch diese Trugbilder hindurchzugehen.«
Ali schluckte. Er wusste, dass er im Grunde seines Herzens keinen Augenblick an der Wahrheit von Saddins Worten gezweifelt hatte.
»Was sollen wir jetzt tun?«, flüsterte er verzweifelt.
»Lauf zu dem Kind. Verriegle die Tür von innen. Ich versuche die beiden aufzuhalten.«
»Und du? Was ist...«
»Denk an Michelle! Beeile dich!«
Zögernd trat Ali auf die Tür zu. Er sah noch einmal zurück. Das Licht des Mondes schimmerte auf Saddins schwarzem Haar, seine gekreuzten Schwerter funkelten. Seine Kleidung leuchtete so strahlend weiß, als wäre er ein Engel, gesandt, um gegen die finsteren Geschöpfe der Hölle zu streiten, die sich ihm lauernd näherten. Dann zog Ali die Tür zu und verriegelte sie.
So schnell ihn seine Beine trugen, rannte er die steile Treppe hinunter. Er stolperte und hätte fast Mahmud umgestoßen, der gerade heraufgestiegen kam.
»Herr, das Nachtmahl ist...« Der Diener brach ab und schien erst jetzt den Ausdruck auf Alis Gesicht zu bemerken. »Herr, was ist? Und wo ist Euer Gast?«
»Er ist oben auf dem Turm. Komm mit, wir müssen zu dem Mädchen«, antwortete Ali keuchend.
»Zu dem Mädchen? Aber warum denn, Herr? Es schläft doch, und...«
Aber Ali lief schon weiter und zog den Diener am Ärmel hinter sich her. Er hatte keine Zeit, Mahmud alles genau zu erklären. Nicht jetzt, da er wusste, dass Saddin oben auf dem Turm um sein Leben kämpfte und dass das Mädchen, die Kleine, die er noch nicht einmal kannte, in tödlicher Gefahr schwebte.
Als Ali im Besucherzimmer ankam, war er außer Atem. Seit Langem, seit vielen Jahren war er nicht mehr so schnell gelaufen.
Doch die Angst, dass die Fidawi ihm zuvorgekommen sein könnten, dass sie bereits in sein Haus eingedrungen waren und Michelle entweder entführt oder gar getötet hatten, verlieh seinen Schritten Flügel. Aber als er die Tür öffnete, war alles friedlich. Das Kind schlief.
Ali beugte sich über das kleine Mädchen und sah ihm zum ersten Mal ins Gesicht. Es war das Gesicht eines Engels, umrahmt von feinem goldenem Haar. Dieser Anblick schnitt ihm tief ins Herz. Ein heilsamer Schnitt, wie er ihn manchmal selbst anwendete, um Eiter aus einer Wunde abfließen zu lassen. Ja, Saddin hatte recht. Dieses Kind war wirklich und wahrhaftig Beatrices Tochter. Und plötzlich wusste er, was er zu tun hatte. Das Kind würde bei ihm bleiben, egal was noch geschehen mochte. Ali berührte das Mädchen sachte an der Schulter.
»Michelle!«, sagte er. »Wach auf!«
Das Mädchen bewegte sich, schlug die Augen auf und blinzelte ihn verschlafen an. Und da fiel Ali ein, dass ihn die Kleine vermutlich gar nicht verstehen konnte, dass sie wahrscheinlich kein Arabisch sprach. Wie sollte er ihr klarmachen, dass sie mit ihm kommen und sich verstecken musste?
»Ali«, sagte er und deutete mit dem Zeigefinger auf sich. Dann streckte er seine Hand aus. »Komm mit. Schnell.«
Das Mädchen runzelte die Stirn.
»Saddin?«, fragte es und sah Ali mit denselben blauen Augen an, mit denen auch Beatrice ihn immer angesehen hatte.
»Er kommt bald. Du musst dich jetzt verstecken.«
Ob sie ihn wirklich verstanden hatte, konnte Ali nicht sagen. Vielleicht hatte sie auch auf ihrer Flucht mit Saddin bereits so viele Erfahrungen gesammelt, dass sie ahnte, um was es hier ging. Sie ergriff Alis Hand mit ihrer kleinen und sah ihn mit ihren großen blauen Augen an. In diesem Blick lag so viel Vertrauen, dass es Ali förmlich die Kehle zuschnürte, und ihm kamen die Tränen. Gleich würde er es Saddin sagen.
Er würde ihm sagen, dass er sich keine Sorgen mehr zu machen brauche. Michelle würde bei ihm bleiben. Zur Not für immer.
Gemeinsam liefen sie quer durch das Haus zu seinem Arbeitszimmer. Dort gab es eine alte Truhe, groß genug, um sogar einem ausgewachsenen Mann als Versteck dienen zu können. Hastig warf Ali ein paar Kissen hinein. Ohne dass er auch nur ein Wort zu sagen brauchte, kletterte die Kleine in die Truhe und duckte sich. Ali breitete eine Decke über sie und legte beschwörend seinen Finger auf die Lippen. Sie nickte.
Dann hauchte er einen Kuss auf die Stirn des Mädchens und klappte schweren Herzens den Deckel zu. Er konnte nur hoffen, dass dieses Versteck sicher war. Dass, sollten die Fidawi in sein Haus eindringen, keiner von ihnen auf die Idee käme, in einer alten, wurmstichigen Truhe, in der er Tücher und anderes Verbandsmaterial aufbewahrte, nach dem Mädchen zu suchen.
Hastig holte Ali aus einem Schrank einen etwas angestaubten Säbel heraus, ein Erbstück seines Großvaters, und machte sich wieder auf den Weg zum Turm. Er wusste zwar noch nicht, wie er Saddin helfen sollte, aber eines war klar, er konnte den Nomaden nicht einfach allein gegen zwei dieser Fidawi kämpfen lassen. Das bohrende Gefühl in seinem Magen war verschwunden. Jetzt, da er wusste, was er zu tun hatte, hatte er kein schlechtes Gewissen mehr. Er hatte nicht einmal mehr Angst. Und mit jedem Schritt wurde er sich seiner Sache sicherer.
Trotzdem wurden Alis Knie weich, als er langsam und so leise er konnte die Treppe zum Turm emporstieg. Atemlos lauschte er an der geschlossenen Tür. Es war nichts zu hören. Keine Stimmen, kein Waffengeklirr, kein Laut. War der Kampf etwa schon beendet? Stellten die Fidawi ihm eine Falle? Behutsam zog er den Riegel zurück und öffnete die Tür einen Spalt, sodass er gerade eben hindurchspähen konnte. Eine schwarze Gestalt hing quer über der Turmmauer, als gäbe es in der zehn Meter tiefer liegenden Straße etwas besonders Interessantes zu beobachten. Ali versuchte die Tür ganz zu öffnen, doch etwas Schweres versperrte ihm den Weg. Mit aller Kraft schob und drückte er, bis der Spalt breit genug war, sodass er sich, wenn auch nur mit Mühe, hindurchzwängen konnte. Dabei wäre er fast über ein Paar regloser Beine gestolpert. Fassungslos sah er auf den Körper des Mannes hinab, der ihm zu Füßen lag. Er war ganz in Schwarz gekleidet. Der Blick seiner weit aufgerissenen Augen in seinem bärtigen Gesicht war entsetzlich. Überrascht und voller ungläubiger Bestürzung starrte er in den Himmel hinauf, als hätte Allah selbst in seinem Zorn das Schwert gegen ihn erhoben. Unter seinem Kinn klaffte eine entsetzliche, ohne Zweifel tödliche Wunde. Trotzdem kniete sich Ali neben ihm nieder. Nicht einmal jetzt konnte er vergessen, dass er Arzt war, dass er diesem Mann, sofern in ihm noch ein Hauch von Leben steckte, helfen musste. Er tastete nach dem Herzschlag des Mannes. Doch auf seiner Brust war nichts außer klebriges, im Mondlicht schwarz glänzendes Blut. Der Fidawi war tot. Ali wischte seine blutigen Finger an der schwarzen Kleidung des Mannes ab und erhob sich. Leise, auf Zehenspitzen schlich er zu dem anderen Mann, der immer noch bewegungslos über der Mauer hing. Dabei merkte er zu seinem großen Entsetzen, dass er sich nichts sehnlicher wünschte, als dass auch dieser Mann tot wäre. Seine Hoffnungen wurden erfüllt. Der Bauch des Mannes war aufgeschlitzt, sodass sich seine Eingeweide auf der Mauer verteilten wie die eines Opfertiers in einem abscheulichen, barbarischen Ritus. Angewidert wandte Ali sich ab. Die beiden Fidawi waren also tot, gestorben durch die Hand des Nomaden. Aber wo war Saddin?
In diesem Moment hörte Ali ein leises Stöhnen und drehte sich um. Und da sah er ein helles Bündel im Schatten neben dem Eingang zur Treppe liegen. Sein Magen verkrampfte sich. Langsam, als würde eine unsichtbare Kraft seine Beine am Boden festhalten, trat er näher.
Tatsächlich, es war Saddin. Er lag zusammengesunken, beide Hände auf den Bauch gepresst und mit geschlossenen Augen, gegen die Wand gelehnt da. Seine Kleidung war zerrissen und blutdurchtränkt.
Ali kniete neben ihm nieder und legte ihm behutsam eine Hand auf die Brust. Sein Herzschlag war erschreckend schwach. Zahlreiche Schnittwunden bedeckten seine Arme und Beine, doch keine von ihnen schien gefährlich zu sein. Wenigstens auf den ersten Blick nicht.
»Ali!« Saddin schlug die Augen auf, griff nach Alis Schulter und zog sich mühsam hoch. Sein Gesicht war bleich im Mondlicht, seine Augen glänzten fiebrig. »Was ist... mit... Michelle? Ist sie...?«
»Die Kleine ist in Sicherheit. Ich habe sie gut versteckt.«
Saddin schloss erleichtert die Augen und ließ sich wieder zurücksinken.
»Allah sei Dank!«, flüsterte er. Dann sah er Ali an, und ein grimmiges Lächeln umspielte seine Lippen. »Diese Ratten haben bezahlt. Diesmal habe ich sie alle erwischt. Sie sind tot, Ali.«
»Ich weiß, ich habe sie gesehen«, erwiderte Ali und zog Saddins Hände behutsam zur Seite. Sofort sprudelte Blut aus einer klaffenden Wunde hervor, als hätte sich im Leib des Nomaden eine Quelle geöffnet. Ali schluckte. Er war ein erfahrener Arzt. Er erkannte eine tödliche Verletzung, wenn er sie sah.
Instinktiv presste er seine Hand auf den Bauch des Nomaden, obwohl er genau wusste, wie sinnlos es war. Diese Blutung würde niemand stillen können. Vermutlich nicht einmal Beatrice mit all ihren erstaunlichen Künsten aus einer fernen Zukunft. »Saddin, du solltest jetzt nicht...«
Doch der Nomade schüttelte den Kopf. »Du brauchst mir nichts vorzumachen. Ich habe dem Tod oft genug in die Augen gesehen, ich kenne sein Gesicht. Ich werde sterben.«
Ali erinnerte sich an das seltsame Lächeln, das er vorhin auf Saddins Gesicht gesehen hatte. Der Nomade hatte geahnt, was geschehen würde. Bereits zu jenem Zeitpunkt hatte er es geahnt.
»Was wird jetzt aus Michelle?«
»Sie wird bei mir wohnen«, antwortete Ali. »Ich wollte es dir gerade sagen. Ich habe mich anders entschieden. Sie wird bei mir bleiben, und ich werde sie aufziehen, als wäre sie mein eigenes Kind.«
Saddin schloss die Augen, und eine einzelne Träne rann über seine Wange.
»Du hast ihr in die Augen gesehen. Habe ich recht?« Saddin lächelte. »Du hast in ihrem Gesicht gesehen, was ich gesehen habe – Beatrice.«
Ali nickte. »Ja, ich...«
»Herr«, Mahmuds Stimme unterbrach Ali. »Kann ich Euch...«
Der Blick des Dieners fiel auf Saddin und die Blutlache, die ihn umgab, und er wurde bleich. Voller Entsetzen presste er eine Hand auf den Mund.
»Herr«, keuchte er schließlich. »Allah sei uns gnädig! Seid Ihr... seid Ihr unversehrt?«
»Ja, das bin ich«, sagte Ali und spürte plötzlich wieder dieses dumpfe, bohrende Gefühl in seiner Magengrube. Saddin würde sterben. Der Nomade hatte sein Leben für die Sicherheit des Mädchens – und letztlich auch für ihn – gegeben. Und was hatte er getan? Er war im Haus herumgelaufen wie ein aufgeschrecktes Weib und hatte nach einem sicheren Versteck gesucht, statt ebenfalls zu kämpfen. Saddin verblutete vor seinen Augen, und er selbst hatte nicht einmal einen Kratzer davongetragen.
»Allah sei gelobt und gepriesen, dass Er in Seiner großen Güte und Gnade Euer Leben verschont hat!«, stieß Mahmud mit deutlichem Zittern in der Stimme hervor. »Aber, Herr, was ist mit Eurem Gast? Sollen wir ihn hinuntertragen, damit Ihr seine Wunden versorgen könnt?«
Ali sah auf seine Hand hinab, die er immer noch auf den Leib des Nomaden gepresst hatte. Blut quoll zwischen seinen Fingern hervor, frisches, warmes Blut. Und in diesem Moment war ihm klar, dass Saddin das Patientenzimmer nie erreichen würde.
Es blieb ihm nicht mehr viel Zeit. Er musste sich entscheiden. Rasch.
»Nein«, sagte er. »Aber bringe eine Decke und einen Krug mit Wasser. Und beeile dich!«
Während Mahmud sich auf den Weg machte, um die Befehle seines Herrn auszuführen, wandte sich Ali wieder Saddin zu. Das Gesicht des Nomaden war jetzt geradezu erschreckend blass.
»Ich muss dir noch vieles sagen, Ali«, meinte Saddin und versuchte erneut sich aufzusetzen. »So vieles. Du musst...«
»Nicht jetzt, Saddin, bleib liegen«, wehrte AH ab und drückte ihn sanft auf den Boden zurück. »Du solltest deine Kräfte schonen.«
Doch da begann Saddin zu lachen. Er lachte und verzog gleichzeitig das Gesicht vor Schmerz.
»Wofür sollte ich jetzt noch Kräfte sparen, Ali al-Hussein? Auf ein paar Atemzüge mehr oder weniger kommt es doch wahrlich nicht mehr an, oder?«
Ali öffnete den Mund, um zu widersprechen, um, wie es seine Gewohnheit war, trostreiche Worte für den Patienten zu finden, im letzten Augenblick des Lebens noch Hoffnung zu spenden. Doch ihm fiel ein, was Saddin an diesem Abend zu ihm gesagt hatte. Sie waren immer ehrlich zueinander gewesen.
»Du hast recht«, antwortete er schließlich. »Es kommt nicht mehr darauf an. Was willst du mir sagen?«
Saddin ergriff seinen Arm.
»Höre mir gut zu, denn möglicherweise bleibt mir weder die Zeit noch die Kraft, es dir ein zweites Mal zu erzählen. Hier in Qazwin lebt ein Mann namens Moshe Ben Levi. Er ist Ölhändler...«
»Ein Jude?«, fragte Ali überrascht. Saddin sprach so leise und hastig, dass er schon glaubte, er hätte sich verhört.
»Ja, ein Jude. Doch Name und Geschäft sind nur Tarnung. In Wahrheit heißt er Rabbi Moshe Ben Maimon. Auch er ist ein Reisender. Ein Reisender und Gelehrter. Er hat die Geheimnisse der Steine der Fatima erforscht wie kein anderer. Er weiß mehr über sie, als jemals ein Mensch wissen wird. Gehe zu ihm. Sage ihm, Saddin schickt dich. Er kennt mich. Ich traf ihn schon oft und habe mit ihm über die Steine gesprochen. Er wird dir und Michelle helfen. Obendrein wird er dir vieles erklären können, was du noch nicht weißt.« Saddin machte eine Pause und rang nach Atem. »Außerdem will ich dich warnen. Die Fidawi trachten dir und Michelle nach dem Leben. Von dem Ziel, euch beide zu töten, werden sie nicht ablassen, bis sie den Stein in ihren Händen haben. Deshalb traue keinem Menschen. Niemandem. Nicht einmal denen, die du schon seit Jahren zu kennen glaubst. Sogar Weiber und Kinder stehen in den Diensten der Fidawi. Nirgendwo seid ihr beide wirklich sicher, weder auf dem Basar noch beim Barbier, noch in der Wohnung eines angeblichen Freundes.« Er schloss die Augen. Ein Zittern durchlief seinen Körper. »Lass Michelle niemals allein, nicht für einen einzigen Augenblick. Hörst du? Versprich mir das!«
»Ich verspreche es dir«, sagte Ali und drückte zur Bekräftigung Saddins Hand.
Ein Lächeln huschte über das Gesicht des Nomaden.
»Trage stets einen Dolch bei dir, Ali al-Hussein. Du musst jederzeit darauf vorbereitet sein, dich und Michelle zu verteidigen. Die Fidawi sind wahre Meister in der Kunst der Tarnung. Hinter dem Gesicht eines harmlosen Händlers, Bettlers oder Dieners können sie sich ebenso gut verbergen wie in den Schatten der Dunkelheit. Versprichst du mir, dass du immer daran denken wirst?«
Ali nickte.
»Gut.« Der Nomade sank zurück. Er wirkte erleichtert. »Allah war gnädig. Ich habe dir alles gesagt, was es zu sagen gibt. Nur eines noch: Hüte dich vor den Herrschern von Gazna, Ali al-Hussein. Sie sind Fanatiker und auf der Suche nach dir. Meinen Informationen nach haben sie engen Kontakt zu den Fidawi. Möglicherweise ist der Emir selbst sogar jener Großmeister, den die Fidawi ›den Alten vom Berg‹ nennen. Sie sind gefährlich. Hüte dich vor ihnen. Wenn du Schutz suchst, gehe nach Isfahan. Der dortige Emir ist ein kluger und vernünftiger, ein vertrauenswürdiger Mann. Ich habe mit ihm gesprochen. Er ist bereit, dich an seinem Hof aufzunehmen und dir Schutz zu gewähren, wenn für dich die Zeit gekommen ist, Qazwin zu verlassen.«
Ali lächelte. In diesem Augenblick vermochte er nicht zu verstehen, wie er jemals Saddin für seinen erbittertsten Feind hatte halten können.
»Ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast wirklich an alles gedacht.«
»Ich bemühe mich nach Kräften«, erwiderte Saddin und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Auf seiner Stirn standen Schweißperlen.
»Gibt es etwas, das ich für dich tun kann?«, fragte Ali. »Möchtest du, dass ich deine Familie benachrichtige?«
»Nein. Sie wissen, dass sie mich nicht wiedersehen werden. Wenigstens nicht in dieser Welt.«
Mahmud kehrte mit der Decke und einem Krug Wasser zurück.
»Herr, soll ich...«
»Nein, lass uns allein. Und sorge auch dafür, dass uns niemand stört«, sagte Ali zu seinem Diener, während er die Decke über Saddin breitete, seinem Freund. Sein Freund? Ali war nicht mehr überrascht. Vielleicht war Saddin sogar der einzige wahre Freund gewesen, den er je in seinem Leben gehabt hatte.
Diese Erkenntnis kam spät, doch es war noch nicht zu spät. Noch konnte er etwas tun, um seine Freundschaft zu beweisen. Und er wollte nicht, dass ein Unbeteiligter dieses zarte Band durch seine Anwesenheit zerstörte. Ihnen blieb ohnehin nicht mehr viel Zeit. »Ich werde dich rufen, falls ich deine Hilfe doch noch benötigen sollte.«
Ob Mahmud verstand, worum es hier ging, konnte Ali nicht sagen. Doch er verneigte sich widerspruchslos und ging.
»Hast du Durst?«, fragte Ali.
»Nein, mir ist nur kalt. Entsetzlich kalt.«
Ali wickelte die Decke enger um ihn, obwohl er wusste, dass es nicht mehr viel nützen würde. Die Kälte, die der Nomade jetzt spürte, war ohne Zweifel eine Folge des Blutverlustes, einer der Vorboten des nahen Todes.
»Ich bin so müde«, flüsterte Saddin. »So unendlich müde.«
»Dann solltest du versuchen, ein wenig zu schlafen.«
Doch Saddin schüttelte heftig den Kopf. »Ganz gewiss nicht. Ich werde noch genug schlafen können«, sagte er, und seine Stimme klang beinahe wie sonst – klar und selbstbewusst. Doch es war offensichtlich, dass dies ein letztes Aufbäumen seiner Kräfte war. »Nein, ich will die Sterne sehen, solange ich dazu in der Lage bin. Ich will ihren Anblick dorthin mitnehmen, wohin ich bald gehen werde.«
Ali spürte einen Kloß in seiner Kehle. Das Gesicht des Nomaden wirkte fast durchsichtig, so als würde er nicht einfach sterben, sondern allmählich vor seinen Augen verschwinden.
»Gibt es etwas, dass du dir noch von der Seele reden möchtest?«
»Beichten, solange ich noch dazu in der Lage bin?« Saddin lachte und verzog erneut das Gesicht vor Schmerz. »Nein. Allah hat mir ein reiches, ein erfülltes Leben geschenkt. Nie musste ich mich vor einem anderen beugen. Ich bereue nichts, keinen Augenblick. Was auch immer ich getan habe an Gutem oder Schlechtem, Allah wird mein Richter sein.«
Ali nickte. Er konnte nichts mehr sagen. So gern er auch etwas für seinen Freund getan hätte, es gab nichts mehr zu tun. Er bettete den Kopf des Nomaden auf seinen Schoß, und schweigend blickten sie gemeinsam in den Sternenhimmel hinauf. Er spürte, wie Saddin mit jedem Atemzug schwächer und schwächer wurde. Es ging jetzt sehr schnell. Viel zu schnell.
»Es ist so weit, Ali«, sagte Saddin nach einer Weile. Seine Stimme war kaum mehr zu hören. Und dann lächelte er. Es war ein so schönes Lächeln, dass Ali den Eindruck hatte, der Flügel eines Engels hätte seine Wange gestreift. »Hättest du jemals gedacht, dass ausgerechnet ich in deinen Armen sterben würde, so als wären wir Zeit unseres Lebens Freunde gewesen?«
Die Augen des Nomaden weiteten sich, als wollte er noch einmal den ganzen Sternenhimmel mit einem einzigen Blick umfassen. Sein Brustkorb hob sich in einer letzten, sanften Bewegung. Dann war er still. Ali schluckte.
»Wir waren immer Freunde«, sagte er leise, obwohl Saddin es nicht mehr hören konnte. »Auch wenn wir beide das die meiste Zeit nicht gewusst haben.«
Er strich dem toten Mann in seinen Armen das Haar aus der Stirn und sah ihm in die Augen. Sie wirkten nicht so starr und gebrochen wie bei den meisten Toten, die er bisher gesehen hatte. Und nicht so entsetzt wie die der beiden Fidawi. In den schönen dunklen Augen des Nomaden spiegelte sich das Licht der Sterne, als hätte er seinen Wunsch, ihren Anblick in den Tod mitzunehmen, erfüllt bekommen. Und ein Sternbild erstrahlte ganz besonders hell – es hatte die Form eines großen leuchtenden Auges.