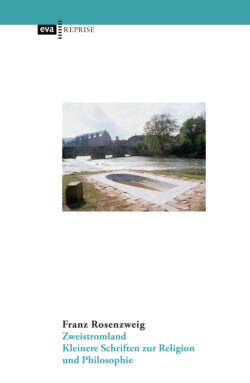Читать книгу Zweistromland - Franz Rosenzweig - Страница 10
An Eduard Strauß „Wünsche sind die Boten des Vertrauens“
ОглавлениеAls ich vor nunmehr drei Jahren an unsern großen seither verstorbenen Lehrer Hermann Cohen meinen Aufruf richtete, es sei „Zeit“, daß etwas Gründliches geschehe für das jüdische Bildungswesen auf deutschem Boden, schloß ich mit den Worten: das jüdische Bildungsproblem auf allen Stufen und in allen Formen ist die jüdische Lebensfrage des Augenblicks. Der Augenblick ist verstrichen. Das Problem ist geblieben. Die Not fordert die Tat, so gebieterisch wie je. Und es genügt nicht, den Samen auszustreuen, der vielleicht erst in ferner Zukunft aufgeht und Frucht bringt. Heute drängt die Not, heute muß das Heilmittel gefunden werden. Eine Therapie künstlicher Umwege ist nicht am Platz. Wer helfen will, muß sich sputen, sonst findet er den Patienten nicht mehr am Leben.
Es ist des Büchermachens kein Ende, sagt der Prediger. Der Gedanke, den ich damals Hermann Cohen vorlegte und den dieser mit dem ganzen Feuer seiner letzten Tage ins Leben führte, der Gedanke, den jüdischen Lehrerstand in Deutschland gesellschaftlich und geistig zu erneuern, indem man ihm ein Zentrum schaffe in einer Akademie für Wissenschaft des Judentums, ist inzwischen der Absicht Hermann Cohens weit entfremdet worden. Das Forschungsinstitut, das in Berlin als Keimzelle der zukünftigen Akademie entstanden ist, verfolgt unmittelbar und zunächst andere Zwecke, Zwecke, von deren Berechtigung man durchaus überzeugt sein kann, ohne deswegen doch unter den heutigen Umständen ihre Dringlichkeit zuzugeben. Das Gesicht der Welt sieht heute so aus, daß man sich wohl wird entschließen müssen, manches an sich Wünschenswerte auf – nicht bessere Tage, sondern bessere Jahrhunderte zu vertagen. Und daß es dringlich – wohlverstanden: momentan dringlich – wäre, die Wissenschaft des Judentums zu organisieren, Menschen also, einerlei ob Juden oder Nichtjuden, zum endlosen Büchermachen über jüdische Gegenstände anzuhalten, das wird wohl schwerlich jemand behaupten. Weniger als je bedürfen wir heut der Bücher. Mehr als je – nein, aber so sehr wie je bedürfen wir heut der Menschen. Der jüdischen Menschen: um denn einmal das Schlagwort auszusprechen, das es heute von dem Parteigeruch zu reinigen gilt, der ihm anhaftet. Denn nicht in dem nur scheinbar weiten, in Wahrheit viel zu engen, ich möchte sagen: kleinjüdischen Sinn darf das Wort verstanden werden, in dem es ein nichts-als-politischer oder selbst noch ein nichts-als-kulturnationaler Zionismus wohl verstehen möchte. Hier ist es vielmehr gemeint in einem Sinne, der gewiß jenen zionistischen mit umgreift, aber außer ihm noch viel mehr. Der jüdische Mensch – das bedeutet hier keine Abgrenzung gegen andere Menschlichkeiten; keine Scheidewand soll sich hier aufrichten; selbst innerhalb des Einzelnen mögen sich mehrere Kreise berühren oder schneiden; nicht anders zeigt es ja die Wirklichkeit, die nur ein verbohrter Eigensinn leugnen kann. Freilich dieser Eigensinn und sein Gegenstück, die feige Verleugnung – diese beiden scheinen das Antlitz der jüdischen Gegenwart zu zeichnen. Und wenn das Problem so gestellt wird, wie es heute die extremen Parteien von beiden Seiten, Zionisten und Assimilanten, sich stellen: Judentum und Deutschtum – so kann die Lösung freilich nur das Entweder-Oder des Eigensinns und der Verleugnung sein. Aber es geschieht der Jüdischkeit des jüdischen Menschen Unrecht, wenn man sie auf eine Linie mit seinem Deutschtum stellt. Deutschtum grenzt sich notwendig ab gegen andere Volkstümer. Das Deutschtum des jüdischen Menschen schließt sein gleichzeitiges Franzosenoder Engländertum aus. Der Deutsche ist eben nur Deutscher, nicht zugleich auch Franzose, auch Engländer. Die Sprache selber sträubt sich bezeichnenderweise, von einem deutschen Menschen zu reden. Der Deutsche ist Deutscher, nicht „deutscher Mensch“. Zwischen seinem Deutschtum und seinem Menschentum bestehen wohl Zusammenhänge, Zusammenhänge, über denen Geschichtsphilosophen grübeln mögen und die zu verwirklichen das Werk der lebendigen, schreitenden Geschichte selber sein mag. Aber zwischen seiner Jüdischkeit und seinem Menschentum bestehen keine „Zusammenhänge“, die erst entdeckt, ergrübelt, erst erlebt, erschaffen werden müßten. Hier ist es anders: als Jude ist er Mensch, als Mensch Jude. Ein „jüdisch Kind“ ist man mit jedem Atemzug. Da ist etwas, was die Adern unsres Lebens durchpulst, in schwachem oder starkem Strömen, aber jedenfalls sie durchpulst bis in die Fingerspitzen. Sehr schwach kann dieser Strom sein. Aber jeder spürt, daß der Jude nicht ein abgegrenztes Stück in ihm ist, sich abgrenzend gegen andres Abgegrenztes, sondern eine seis nun große seis geringe Kraft, die sein ganzes Wesen trägt und durchströmt.
Dieser Kraft aber, wie sie sich innerhalb des einzelnen Juden nicht begrenzt, grenzt auch ihn selber nicht ab nach „außen“. Sie macht ihn ja grade zum Menschen. Sonderbar genug für ein nationalistisch vernageltes Gehirn: dies Judesein ist keine Schranke, die den Juden abgrenzt gegen irgend etwas, was sich selber abgrenzt. Nur Begrenztes kann an Begrenztem seine Grenze finden. Unbegrenztes begrenzt sich nur an Unbegrenztem. Der jüdische Mensch findet seine Grenze nicht am Deutschen oder Franzosen, er findet sie einzig an dem Menschen, der ebenso unbegrenzt, ebenso – menschlich ist wie er selber: am christlichen, am heidnischen Menschen. Mit ihnen allein dürfte der jüdische Mensch auf eine Linie treten. In ihnen erst begegnen ihm Menschen, die ebenso allumfassend zu sein beanspruchen und es auch – über alle Scheidungen der Völker und Staaten, der Begabungen und Charaktere (denn auch die grenzen Mensch gegen Mensch) – sind. Nicht minder umfassend, nicht minder alldurchdringend und nicht minder allem sich verbindend wie das Christentum des menschlichen Christen, das Heidentum des humanen Heiden muß dem jüdischen Menschen sein Judentum sein.
Wie also? Dennoch und trotz allem wieder die alte, jetzt ein gutes Jahrhundert lang abgespielte Melodie vom Judentum als „Religion“, gar als „Konfession“? Die alte Auskunft eines Jahrhunderts, das die Einheit des jüdischen Menschen säuberlich auseinanderzulegen versuchte in eine „Religion“ für einige hundert Rabbiner und eine „Konfession“ für einige Zehntausende wohlsituierter Staatsbürger! Verhüte Gott, daß wir diese Platte, die schon keinen reinen Ton mehr gibt – gab sie ihn je? –, wieder auflegen wollten. Nein, was uns Judentum heißt, das Judesein des jüdischen Menschen, das ist nichts, was sich in einer „religiösen“ „Literatur“, selbst nicht in einem „religiösen Leben“ fassen ließe, und ist auch nichts, was man vor dem Standesbeamten als „Konfession“ „bekennen“ kann. Es ist ja eben überhaupt kein Etwas, ist kein Fach unter Fächern, keine Lebenssphäre unter Lebenssphären, zu welch allem die Kulturseligkeit des Emanzipationsjahrhunderts es hatte herabdrücken wollen, sondern es ist in dem Menschen, den es zum jüdischen Menschen macht, etwas unwägbar Kleines und doch unermeßlich Großes, sein unzugänglichstes Geheimnis und doch hervorbrechend aus jeder Gebärde und aus jedem Wort, und aus dem unbeachtetsten am meisten. Das Jüdische, das ich meine, ist keine „Literatur“. Im Büchermachen wird es nicht ergriffen. Im Bücherlesen auch nicht. Es wird noch nicht einmal – mögens mir alle modernen Geister verzeihen! – „erlebt“. Es wird höchstens ge-lebt. Vielleicht nicht einmal das. Man ist es.
Man ist es. Aber freilich: auch es ist. Und weil es ist, weil es schon da ist, schon da war, ehe ich war, und sein wird, auch wenn ich nicht mehr bin, deshalb – aber auch nur deshalb – ist es auch Literatur. Nur deshalb gibt es Fragen der jüdischen Bildung. Alle Literatur ist ja nur um der Werdenden willen geschrieben. Und um dessen willen, was in einem jeden immer noch an Werdendem bleibt. Die jüdische Sprache, die kein „Lesen“ kennt, das nicht „Lernen“ hieße, plaudert dies Geheimnis aller Literatur aus. Denn ein Geheimnis, obwohl ein ganz hüllenloses, ists diesen bildungsbesessenen und bildungserstickten Zeiten, daß Bücher nur dasind, um Gewordenes dem Werdenden zu vermitteln, daß aber, was zwischen Gewordenem und Werdendem steht, der Tag, das Heute, die Gegenwart, das – Leben, keiner Bücher bedarf. Wenn ich bin, was frage ich nach dem, was mich „bilden“ könnte? Ich bin ja. Aber Kinder kommen und fragen, und in mir selber erwacht das Kind, das noch nicht „ist“, das noch nicht „lebt“, und es fragt und will gebildet werden, will werden: wozu denn? Nun, zum Lebendigen, zu dem, was – ist. Und da hat das Büchermachen ein Ende.
Denn das Leben steht zwischen zwei Zeiten, der Augenblick zwischen Vergangenheit und Zukunft. Der lebendige Augenblick selbst ist des Büchermachens Ende. Aber hart an ihn stoßen zwei Reiche des Büchermachens, zwei Reiche der Bildung. In ihnen ist des Büchermachens kein Ende. Kein Ende kennt die Erforschung des Vergangenen, sie, der auch der Augenblick nichts gilt, bevor sie ihn sich nicht in den Schmetterlingskasten des Vergangenen aufgespießt hat, und die von der Zukunft nur wissen mag, was sie sich von ihr nach dem Gleichnis der Vergangenheit ausmalen kann. Und kein Ende kennt die Belehrung der Künftigen, sie, die den Augenblick nur braucht, um mit seiner Glut die unerwachten Seelen der Werdenden aufzuschließen, und die von der Vergangenheit nur nimmt, was lehrbar ist, was in den aufgeschlossenen Seelen des neuen Geschlechts Raum findet. Kein Ende also kennt die Wissenschaft, kein Ende kennt die Lehre. Aber zwischen beiden brennt die Flamme des Tags; sie nährt sich nur aus dem begrenzten Stoff des Augenblicks, aber ohne ihre Glut bliebe die Zukunft unerschlossen, ohne ihre Leuchte die Vergangenheit unsichtbar. Nur aus dem buchstabenfreien Geiste des Augenblicks kommt den Welten, die ihm angrenzen, der Welt der Forschung und der Welt der Lehre, kommt der Wissenschaft und dem Unterricht Kraft und Leben.
Forschung und Lehre, Wissenschaft und Unterricht: unter uns sind sie gestorben. Das Wort mag viele Ohren verletzen, aber ich weiß mich, wenn ich es spreche, eins mit den Besten unter den Jungen und – Gott sei Dank! denn sonst würde ich mir nicht trauen – auch unter den Alten. Unsre Wissenschaft hat seit Mendelssohn und Zunz nicht mehr den Mut zu sich selber, sondern läuft in achtungsvollem Abstand hinter der Wissenschaft der „andern“ her. In achtungsvollem Abstand. Was bei jenen schon vieux jeu ist, wird bei uns – in dem, mit Recht, sehr engen Kreis derer, die überhaupt diesem Schattentanz zuschauen – noch bereitwillig als dernier cri angestaunt. Und was im geistigen Deutschland schon die Spatzen von allen Dächern pfeifen, das gilt unter uns noch als unerhörte Ketzerei. Wir haben uns, indem wir aus dem alten Ghetto heraustraten, schleunigst in ein neues gesperrt. Nur daß wir es diesmal selber nicht wissen wollen, und daß wir eine Wissenschaft treiben, die, sehr wenige Ausnahmen abgerechnet, genau so wenig deutsch u n d genau so wenig jüdisch ist wie – nun, wie etwa die „deutschen“ Zunamen, mit denen sich unsere Urgroßväter im ersten Rausch der Emanzipation behängten.
Und nicht besser stehts mit der Lehre. Ich will nicht wiederholen, was ich vor drei Jahren ausführlicher gesagt habe. Man hat sich an meine damalige bewußt über das zunächst Erreichbare hinausschießende Lehrplan-Utopie gehalten und vielfach geglaubt, damit auch die Kritik am jetzigen Betriebe des Unterrichts abzutun. Aber die bleibt bestehn, und wenn alle meine Reformvorschläge Unsinn wären – was sie nicht sind. Meine Kritik aber sagte: die Taufbewegung, die uns Jahr für Jahr nicht, wie immer wieder gelogen wird, die Schlechtesten, sondern die Besten entführt, fällt unserm Religionsunterricht zur Last. Die Verse von Max Brod über diesen Gegenstand in seinem großen Gedicht „An die getauften Juden“ sind wahr wie Prosa. Aber freilich, der Einzelne ist meist unschuldig. Es hängt in solchen Dingen alles zusammen. Wir haben keine Lehrer, weil wir keinen Lehrerstand haben, wir haben keinen Lehrerstand, weil wir keinen Gelehrtenstand haben; wir haben keinen Gelehrtenstand, weil wir keine Wissenschaft haben. Unterricht und Forschung sind beide verkümmert. Sie sinds, weil uns das fehlt, wodurch Wissen wie Lehre erst lebendig werden: das – Leben.
Das Leben. Zwischen den beiden Reichen der Bildung und ihrer endlosen Büchermacherei klafft eine Lücke, unausgefüllt seit mehr als hundert Jahren. Es fehlt in der emanzipierten deutschen Judenheit eine Plattform jüdischen Lebens, auf der die bücherlose Gegenwart zu ihrem Rechte käme. Bis zur Emanzipation war diese Plattform das Dasein in den Schranken des altjüdischen Gesetzes, im jüdischen Hause, im synagogalen Dienst. Die Emanzipation hat diese Plattform gesprengt. Wohl sind die Teile alle drei noch da, aber eben weil nur noch Teile, deshalb nicht mehr das, was sie in ihrem Zusammenhang bis da waren: die eine Plattform des einen wirklich und gegenwärtig gelebten Lebens, dem Wissenschaft und Unterricht nur zu dienen hatten und aus dem sie hinwiederum ihre besten Kräfte zogen.
Wo heute das Gesetz im Westjudentum noch gehalten wird, da ist es nicht mehr die gewissermaßen bloß auf Paragraphen gezogene, übrigens aber nur selbstverständliche „Jüdischkeit“ des Lebens, sondern es hat eine Spitze bekommen, und zwar – ganz seinem echten Sinn zuwider – eine Spitze, die sich nicht vornehmlich nach außen kehrt, sondern die sich innerhalb der Judenheit gegen die große Mehrzahl derer richtet, die sich an das Gesetz nicht mehr halten. Das Gesetz unterscheidet heute bei uns den Juden vom Juden mehr als den Juden vom Nichtjuden.
So wie das Gesetz, weil losgesprengt aus der Einheit mit Haus und Kult, nicht mehr ist, was es war, so auch die beiden anderen Stücke. Auch das jüdische Haus ist heute, wo es noch aufrecht erhalten wird, nicht mehr das Herz, aus dem der Blutstrom alles jüdischen Lebens hervorgetrieben wird und in das er wieder zurückkehrt; die Familie hat, langsam aber sicher, ihre Machtstellung im jüdischen Dasein verloren. Das Leben kommt von draußen, es stellt seine eigenen Anforderungen: das jüdische Haus kann und wird wohl versuchen, sich der Außenwelt gegenüber durchzusetzen; aber das Höchste, was es noch erreicht, ist: sich zu behaupten. Die Einheit von häuslichem und beruflichem Leben ist hoffnungslos gestört; wie auch die strammste Orthodoxie ihre Zöglinge in zwei Bildungswelten einzuführen gezwungen ist und den für das Altjudentum wenig bedeutsamen Gegensatz von „Tauroh“ und „Derech erez“ zu ganz neuer positiver Wichtigkeit übertreiben mußte, so ist auch das Haus nur noch höchstens das „eine“ im Leben und hat ein „anderes“ neben und – außer sich; das andere, der Beruf, die öffentliche Tätigkeit, ist nicht mehr die natürliche Ausstrahlung des Hauses ins Draußen, sondern es untersteht eigenen Ansprüchen, eigenen Gesetzen; das Haus bindet nicht mehr das jüdische Leben zur Einheit.
Endlich die Synagoge – von ihr her scheint, wenn auch mit kümmerlich dünnem Fließen, noch am ehesten ein Strom jüdischen Lebens den Juden von heute wo nicht zu umspülen, so doch zu durchrinnen. Auch der assimilierteste Assimilant pflegt ja meistens noch, und sei es nur zur einen Stunde der „Seelenfeier“, oder doch wenigstens durch seine Heirat oder allermindestens sein Begräbnis, an ihrem Leben teilzunehmen. Und wer da weiß und etwa an sich selber erfahren hat, was selbst in einem bloßen, ich möchte sagen, Jomkippur-Judentum, wie es heute viele als einziges vollwichtiges Goldstück aus dem ererbten Schatze sich aufbewahren, für Kräfte schlummern können, der wird sich hüten, geringschätzig von der Synagoge zu sprechen. Aber daß sie unserer Gesamtheit werden kann, was sie ihr war, das ist aus dem gleichen Grunde ausgeschlossen, aus dem es auch für Haus und Gesetz ausgeschlossen war. Mag es selbst möglich sein – ich meine, es ists! –, aus dem kleinen Rest, der vielen hier als Einziges geblieben ist, nach und nach Stück auf Stück wieder den Anschluß an das Ganze zu gewinnen, dies Ganze ist selber – kein Ganzes mehr. Denn es sitzt eben nicht mehr als ergänzendes Glied im Leibe eines lebendigen Lebens; der Gemeindediener klopft eben nicht mehr an die Haustüren „in Schul“; und wie viele Synagogen in deutschen Städten haben wohl heute noch das Lernzimmer mit den schweren Folianten des Gesetzes und seiner Kommentare unmittelbar neben dem Betraum? Sondern die Synagoge ist, recht im Sinne des kulturseligen, alles in Schubfächer unterbringenden 19. Jahrhunderts, zur „Stätte“ „religiöser“ „Erbauung“ geworden (oder behauptet, es geworden zu sein); die „Religion“, der das Leben – mit Recht! denn es wehrt sich mit Recht gegen solche tote Teilansprüche! – die Stätte verweigert, sucht sich da ein sicheres, ungestörtes Eckchen; wirklich ein Eckchen: das Leben flutet unbekümmert daran vorüber. Auch die Synagoge vermag heute nicht, was Gesetz und Haus nicht vermochten: der deutschen Judenheit eine Plattform jüdischen Lebens zu geben.
Was also hält denn oder was hielt seit der beginnenden Emanzipation die deutsche Judenheit zusammen? Worin zeigt sich die Gemeinsamkeit des gegenwärtigen Lebens, die allein die überkommene Vergangenheit in die Zukunft des Werdenden hinüberleiten könnte? Die Antwort ist zum Erschrecken. Es gibt nur eins, was das Leben der deutschen Juden von heute seit dem Anbruch der Emanzipation zu einem sozusagen „jüdischen Leben“ eint: die Emanzipation selber, der jüdische Kampf ums Recht. Er allein umschließt alle deutschen Juden, und er allein umschließt nur die Juden. Von ihm müßten also die Gegenwartskräfte ausgehen, die das Vergangene dem schauenden Forscherauge, die Zukunft dem führenden Manneswillen aufschließen könnten. Jeder weiß, wie es in Wahrheit damit bestellt ist. Tatsächlich liegt hier der letzte Grund, weshalb unsere Wissenschaft, weshalb unsere Lehre im Argen liegen müssen. Denn tatsächlich ist dieser Kampf ums Recht, ums staatsbürgerliche wie ums gesellschaftliche, die einzige „belebende“ Kraft gewesen, die der Wissenschaft wie dem Unterricht aus dem wirklichen Leben zuströmte. So hat sich jene wie diese nie von den Scheuklappen des Apologetischen befreien können. Statt Freude am Eigenen zu spüren und zu lehren, haben sie beide das Eigene stets nur entschuldigen wollen. Und so sind wir dahin gekommen, wo wir heute stehen.
Der Zionismus, genialer Diagnostiker, aber sehr mittelmäßiger Behandler, hat das Übel erkannt, aber die falsche Therapie angegeben. Was er erkannte, ist jener Mangel an eigenem gegenwärtigen jüdischen Leben, einem Leben, das noch andere Gemeinsamkeiten aufweisen müßte als den gemeinsamen Besitz einer, noch dazu von niemandem gekannten, toten Buchgelehrsamkeit, genannt „Wissenschaft des Judentums“, und die gemeinsame „Abwehr des Antisemitismus“. Was er weiter erkannte und worin er sich schon geradezu als Pathologe, nicht mehr bloß als Diagnostiker bewährte, ist dies, daß das einzig Gesunde, das einzig noch Ganze am jüdischen Menschen – der jüdische Mensch selber ist. Der Zionismus hat das ausdrücklich wie unbewußt wieder und wieder ausgesprochen, was in Wahrheit seit je uns zusammenhält und was allein der feste Boden ist, auf dem sich die jeweiligen historischen Träger des jüdischen Lebens – in früheren Zeiten Land, Staat und Recht, in späteren Gesetz, Kult und Haus – haben einwachsen können: die Einheit des jüdischen Menschen. Aber in dem Augenblick, wo die große Frage ausgesprochen wird, was denn nun geschehen solle und wie auf diesem verwüsteten und unverwüstlichen Boden statt der verdorrten neuen Stämme jüdischen Gemeinschaftslebens angesetzt werden könnten, auf die aufgepfropft die Einzelnen wieder die Säfte des alten, ewig unerschöpflichen Stroms durch ihre Adern kreisen spürten – in diesem Augenblick versagt der Zionismus. Er glaubt, die europäischen Nöte der jüdischen Gegenwart zu heben, indem er einen Ausweg in eine palästinensische Zukunft eröffnet. Indem er aber wie verzaubert auf diesen Ausweg aus Europa starrt, gerät er für den jüdischen Menschen der „Zwischenzeit“ – und Gegenwart ist immer „Zwischenzeit“ – immer wieder auf Versuche, ihn möglichst zu isolieren. Da alles Heil in der Errichtung eines isolierten Staats gesehen wird, so isoliere man – rechnet der Zionismus – zunächst einmal schon hier den jüdischen Menschen. Man schaffe ihm künstlich in Europa innere wie äußere Formen der Exterritorialität. Man gebe ihm Gelegenheit, jüdisch zu wandern, jüdisch zu turnen, jüdisch zu sprechen, jüdisch zu lesen – obwohl er in Deutschland lebt. An Stelle des „portativen Vaterlands“, wie man das einstige Ganze aus Gesetz, Haus, Kult sehr gut genannt hat, gebe man ihm eine portative Vaterlandslosigkeit; denn tatsächlich kann ja dies alles, dies ganze neujüdische „Jüdisch-leben-wollen-obwohl-und-trotzdem …“ nicht weiter führen als bis zum Gefühl des in Europa jedenfalls nicht Zuhauseseins; und es soll nach zionistischer Absicht auch gar nicht weiter führen; es wäre sehr gegen den Sinn dieser zionistischen „Galuthpolitik“, wenn auf diese Weise etwa in jüdischen Gartenstädten in der Mark oder landwirtschaftlichen Siedlungen in Franken nun plötzlich ein wirkliches, nicht mehr portatives jüdisches Heimatgefühl entstünde.
So ist der jüdische Mensch, wie ihn die Galuthpolitik des Zionismus allein kennen will, schließlich trotz aller Durchgestaltung im einzelnen, die sie ihm angedeihen lassen möchte, doch etwas durchaus Negatives, etwas sich Abgrenzendes und dadurch selber nur Beschränktes. Die Universalität, die Ganzheit, die auch der Zionismus, wenigstens in seinen reifsten Denkern, dem jüdischen Menschen für wesentlich eigen erkennt, soll ihm erst in einer andern Zeit und an einem andern Ort wiederkommen. Der Zionismus würde sich selber verleugnen, wenn er seiner Galuthpolitik diesen Charakter des Provisoriums nähme. Wer für den Augenblick, das Heute, arbeiten will, ohne die Hauptlast der Arbeit auf ein unsicheres Morgen abzuschieben, der kann darum nicht in den zionistischen Geleisen gehen. Er muß mit dem jüdischen Menschen, dem ganzen in seiner Ganzheit, hier und heute Ernst machen. Aber wie das?
So wie man allein anfangen darf mit allem ganz Großen, mit allem, wovon man gewiß ist, daß es nur allumfassend oder überhaupt nicht sein kann: ganz bescheiden. Was nur auf begrenzten Umfang angelegt ist, das mag man nach begrenztem, klar ausgeführtem Plane errichten, man mag es „organisieren“. Das Unbegrenzte versagt sich der Organisation. Das Fernste läßt sich nur ergreifen beim Nächsten, beim jeweils Nächsten des jeweiligen Augenblicks. Jeder „Plan“ ist hier schon von vornherein falsch, weil er – ein Plan ist. Denn das Höchste läßt sich nicht planen. Ihm gegenüber ist Bereitsein wirklich alles. Nur Bereitsein, nichts anderes können wir dem jüdischen Menschen in uns, den wir meinen, entgegenbringen. Nur den ganz leisen Ruck des Willens – schon im Wort „Willen“ liegt beinahe zu viel; wirklich nur jenen ganz leisen Ruck, den wir uns geben, wenn wir in einer wirren Welt einmal still vor uns hin „wir Juden“ sagen und damit zum ersten Mal jene unendliche Bürgschaft übernehmen, die der alte Spruch meint, der jeden Juden für jeden Bürge sein läßt. Nichts anderes als dieser einfache Entschluß, einmal zu sagen: „nichts Jüdisches ist mir fremd“, wird vorausgesetzt, – auch das wieder kaum ein Entschluß, sondern fast nur ein „kleiner Ruck“, ein Umsich- und Insichschauen. Was der einzelne schauen wird, wer wollte ihm das voraussagen!
Nur so viel wage ich ihm vorauszusagen: er wird das Ganze erschauen. Denn wie es unmöglich ist, das Ganze anders zu erschwingen, als indem man bescheiden beim Nächsten ansetzt, so gilt es doch nun auch umgekehrt, daß es dem Menschen unmöglich ist, das Ganze, das ihm bestimmte Ganze, nicht zu erreichen, wenn er nur wirklich die Kraft zu jenem schlichten, bescheidensten Anfang gefunden hat. Wer einmal sich frei gemacht hat von all jenen albernen Ansprüchen, die ihm das Juden- „tum“ als einen Kanon von bestimmten, abgrenzbaren „jüdischen Pflichten“ – Vulgärorthodoxie –, oder „jüdischen Aufgaben“ – Vulgärzionismus –, oder gar (Gott behüte!) „jüdischen Ideen“ – Vulgärliberalismus – aufdrängen wollen, wer sich ganz einfach bereit gemacht hat, alles was ihm begegnet, von außen und von innen begegnet, seinen Beruf, sein Deutschtum, seine Ehe, und meinetwegen auch, wenn es denn sein muß, sein Juden- „tum“, sich jüdisch begegnen zu lassen, der darf die Gewißheit haben, daß er mit der einfachen Aufsichnahme dieser grenzenlosen „Bürgschaft“ auch wirklich „ganz Jude“ werden wird. Ja, es ist kein andrer Weg, es ganz zu werden. Auf keinem andern Weg entsteht der jüdische Mensch. Alle Rezepte, das orthodoxe wie das zionistische wie das liberale, erzeugen, je rezeptmäßiger sie befolgt werden, um so lächerlichere Karikaturen von Menschen. Und eine Karikatur von Mensch ist auch eine Karikatur des jüdischen Menschen; man kann als Jude das eine nicht vom andern lösen. Es gibt nur das eine Rezept, das den Menschen zum jüdischen und damit, da er Jude ist und also zum jüdischen Leben bestimmt, zum wahren Menschen macht: das Rezept der Rezeptlosigkeit, so wie ichs eben mit – ich fühls! – schwachen Worten zu stammeln versuchte. Unsre Alten haben ein schönes Wort dafür gehabt, worin alles steckt: Vertrauen.
Vertrauen ist das Wort der Bereitschaft, der Bereitschaft, die nicht nach Rezepten fragt, nicht ein „Was soll ich denn nun dann“ und „Wie mache ichs denn“ zwischen den Zähnen hat. Vertrauen erschrickt nicht vor dem Übermorgen. Es lebt im Heute, es geht mit sorglosem Fuße über die Schwelle, die aus dem Heute ins Morgen führt. Vertrauen weiß nur vom Nächsten. Und gerade deshalb gehört ihm das Ganze. Vertrauen geht nur geradeaus. Aber ihm rundet sich unvermerkt die dem Ängstlichen ins Unendliche sich verlierende Straße zum ganz durchmeßbaren und doch unendlichen Kreis.
So brauchts zum jüdischen Menschen nichts als Bereitsein. Wer ihm helfen will, kann ihm nichts geben als die leeren Formen des Bereitseins, leere Formen, die sich von selber und nur von selber füllen dürfen. Wer ihm mehr gibt, gibt ihm weniger. Nur die leeren Formen, in denen etwas geschehen kann, lassen sich bereithalten, nur – „Raum und Zeit“. Wirklich nichts andres als dies: ein Sprechraum, eine Sprechzeit. Das ist das einzige, was sich vorweg „organisieren“ läßt. Also sehr wenig. Sozusagen gar nichts. Unsre neuen jüdischen Zeitschriften, die in den letzten Jahren mehr und mehr einen sprechsaalhaften Charakter annahmen, haben dies Bedürfnis fein herausgefühlt. Sie sind so, insbesondere die beste, der Bubersche Jude, wirklich Mächte in unserem Leben geworden, vielleicht die lebendigsten überhaupt. Die jüdische „Volkshochschulbewegung“ – ein schlechtes Wort, weil es eine unzutreffende Vergleichung mit der deutschen Volkshochschulbewegung heraufbeschwört, die doch ganz andersartige Ziele verfolgen muß – diese neueste und vielleicht wichtigste Bewegung im heutigen deutschen Judentum, muß sich klar werden, was sie will. Sie kann den Weg gehen, den die Berliner Gründung nicht ohne äußern Erfolg beschritten hat: sie kann unter Ausnutzung des schrankenlosen Vortragshungers des Großstadtpublikums versuchen, die ungeheure Lücke im jüdischen Bildungswesen zu stopfen, nachzuholen, was der „Religions“-Unterricht versäumte, was die Universität nicht bietet. Dann wird sie nach Möglichkeit ein komplettes System von Kursen anbieten müssen, einen Lehrplan möglichst enzyklopädischen Charakters, kurzum – Bildung. Und sie wird dann letzten Endes, wie heute die Dinge liegen, beim besten Willen, den sie – im Gegensatz zu dem verkümmerten Unterricht – sicher hat, eben nur Ersatz werden für etwas, was normaler Weise an andrer Stätte gegeben werden sollte und was dort nicht gegeben werden kann, weil die lebendige Kraft fehlt, an der die endlose Bücherwelt der Bildung ihr Ende erfahren müßte und aus der sie daher allein ihren lebendigen bücherlosen Anfang nehmen könnte: der Mittel- und Keimpunkt für das jüdische Leben des jüdischen Menschen.
Oder sie versucht, dieser Punkt zu werden. Sie versucht, die Form, gewiß nur die leere, erste, – nächste Form für ein solches Leben zu sein. Sie versucht, Anfang zu sein. Statt ein planvoll inhaltlich durchgeführtes Ganzes hinzustellen, dem sich die Wißbegierigen nähern, um es schrittweise zu durchmessen – gleichwie auf Universitäten ein im ganzen fertiges, im einzelnen werdendes Gebäude einer Wissenschaft dem Schüler gegenübersteht, etwas was nicht er selber ist, sondern etwas worin er sich heimisch machen will und soll – statt ein solches Ganzes hinzustellen, macht sie sich bescheiden zum bloßen Anfang, zur bloßen Gelegenheit anzufangen. Und sie fängt an mit ihrem eigenen bloßen Anfang: mit Sprechraum und Sprechzeit.
Wie denn? Weiter nichts? Ja, weiter nichts. Man habe einmal „Vertrauen“. Man verzichte einmal auf alle Pläne. Man warte einmal ab. Es werden Menschen kommen, Menschen, die eben dadurch, daß sie ins Sprechzimmer der jüdischen Volkshochschule – wer gibt ein besseres Wort?! – kommen, schon bezeugen, daß in ihnen der jüdische Mensch lebendig ist. Denn sonst kämen sie nicht. Man biete einmal zunächst – garnichts. Man höre. Und aus dem Hören werden Worte wachsen. Und die Worte werden zusammenwachsen und werden zu Wünschen. Und Wünsche sind die Boten des Vertrauens. Wünsche, die sich zusammenfinden: Menschen, die sich zusammenfinden: jüdische Menschen – und man versucht, ihnen zu schaffen, was sie verlangen. Ganz bescheiden auch dies. Denn wer weiß, ob solche Wünsche – gewachsene, wirkliche Wünsche, nicht nach irgend einem Schema von Bildung künstlich gezüchtete – ihre Erfüllung finden können. Aber wer es versteht, die Stimme solcher wirklichen Wünsche zu hören, der wird vielleicht dann auch verstehen, ihnen den Weg zu weisen, auf den sie verlangen. Das wird das Schwerste sein. Denn der Lehrer, der solchen gewachsenen Wünschen entgegenkommen kann, darf ja so gar nicht Lehrer nach irgend einem Schema sein; er muß viel mehr sein und viel weniger: ein Meister zugleich und zugleich ein Schüler. Es genügt garnicht, daß er selber „weiß“, noch daß er selber „lehren kann“. Er muß etwas ganz andres „können“: selber – wünschen. Lehrer muß hier sein, wer „wünschen kann“. Im gleichen Sprechzimmer und in der gleichen Sprechstunde, wo sich die Schüler finden, werden auch die Lehrer entdeckt werden. Und es wird vielleicht der Gleiche in der gleichen Sprechstunde als Meister und als Schüler erkannt. Ja eben erst wenn dies geschieht, ist es ganz gewiß, daß er zum Lehrer taugt.
Voraussetzung ist, daß der Sprechraum ein einziger Raum ist, ohne ein – Wartezimmer. Die Sprechstunde muß „öffentlich“ sein. Wer kommt, wartet im Sprechraum selbst. Er wartet, bis für ihn der Augenblick kommt, wo er mitspricht. Die Sprechstunde wird zum Gespräch. Wer sich da findet und will sein Gespräch allein mit dem andern fortsetzen, der kann sich verab-reden. Die Sprechstunde führt jeden mit jedem zusammen. Denn sie vereinigt jeden mit jedem in dem, was jeder mit jedem gemein hat: das noch so keimhafte, noch so verborgene Bewußtsein, jüdischer Mensch zu sein. Daß er sich daraufhin mit andern zusammenfinden kann, daß er – gemeinsam wünschen kann, das wird ihm zum Erlebnis werden, auch wenn es geschieht, daß der Wunsch ohne Erfüllung bleibt. Denn damit ist zu rechnen. Genau wie beim umgekehrten, beim „Berliner“ System es sein kann, daß Vorlesungen aus Mangel an Beteiligung nicht zustandekommen, so muß es hier geschehen können, daß Wünsche aus Mangel eines Lehrers unbefriedigt bleiben. Das schadet nichts. Denn so tot eine Vorlesung bleibt, die bloß als Vorlesungsanzeige im Programm stand – denn sie bleibt in der Absicht eines Einzelnen stecken –, so lebendig ist ein gemeinsamer Wunsch, der unerfüllt bleibt, denn er verbindet viele. Und darauf, eigentlich nur darauf, kommt es an: auf die Lebendigkeit.
Eben die „Öffentlichkeit“ der Sprechstunde verbürgt sie uns. Denn diese Öffentlichkeit ist eine mörderische Atmosphäre für die Macht des Todes, die unsrer deutschen Judenheit und – ehrlich gesprochen – insbesondere der nichtzionistischen im Nacken sitzt: das Bonzentum. Alle jene Verbonzten und alle, die es werden wollen, jene jungen und alten Greise, sie werden sich einfach nicht hinwagen. Denn hier wird gefragt. Und sie wollen Kundgebungen. Hier wird gezweifelt. Und sie wollen Programme. Hier wird gewünscht. Und sie wollen Forderungen. Der Bonze wird sich genau so wenig unter die Schüler verirren – es sei denn, er „kehre um“ und tue sein Mandarinenkleid von sich – wie der Vortragslöwe unter die Lehrer. Es ist genug gebrüllt. Das Vortragskatheder ist genug unter uns zur schlechten Kanzel umgefälscht worden, – die gerechte Strafe für einen Rabbinerstand, der in seiner Mehrheit bestenfalls aus der Kanzel ein schlechtes Katheder zu machen verstand. Den Brustton neunmalweiser Überzeugung muß verloren haben, wer hier von diesen wünschenden Schülern zum Lehrer gewünscht werden soll. Denn wer dieses Brusttons nicht satt und übersatt ist, wird schwerlich den Weg zu uns finden.
Aber wer denn sonst? Ich höre schon die Stimmen, die sprechen: „wie vag, wie unbestimmt, wie nebelhaft“. Wer so spricht, der bleibe ruhig im Festen, Bestimmten, im hellen Licht seines Alltags, in dem er sich so wohl fühlt. Denn es hilft ihm wenig, wenn er zu der Nüchternheit, die er schon hat, sich noch ein ebenso nüchtern-alltägliches „Judentum“ dazu aufhängen läßt; und nichts andres als das wird ihm werden, wenn er so fragt.
Ich höre auch schon die Stimme derer, die sprechen: „wie wenig!“ Wer so spricht, der bleibe ruhig in dem „Vielen“, das er besitzt. Denn es hilft ihm garnichts, wenn er in die Raritätensammlung seines Vielerlei noch ein kleines Allerlei hineinstellt und klebt ein Zettelchen daran: „mein Judentum“; und nichts andres als dies wird er finden, wenn er so fragt.
Aber vielleicht wünscht auch dieser und jener: „wie schön“ und fragt nur zweifelnd: „ja wenn es das gäbe“. Und ihrem Zweifel gebe ich recht. Sie sollen zweifeln. Aber sie sollen kommen. Sie sollen versuchen, ob es „das gibt“. Denn es liegt an ihnen und einzig an ihnen, daß es das gibt. An ihrer Kraft zu wünschen, an ihrem Drang zu fragen, an ihrem Mut zu zweifeln. Unter ihnen sind die Schüler, sind die Meister. Sie sollen kommen. Kommen sie nicht, dann freilich behält der alte Prediger auch für unsre Generation einmal wieder recht – und es ist des Büchermachens kein Ende.