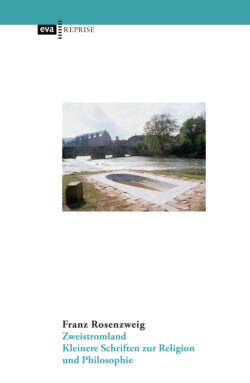Читать книгу Zweistromland - Franz Rosenzweig - Страница 8
An Hermann Cohen
ОглавлениеHochverehrter Herr Geheimrat,
wenn ich mich mit den folgenden Gedanken und Meinungen schriftlich an Sie wende, so geschieht es, weil die Aussicht, sie Ihnen in näherer Zeit mündlich vorzutragen, gering und ungewiß ist. Zurückhalten mag ich sie nicht länger; das Leben ist kurz und der Augenblick kostbar. In Ihre Hand aber lege ich sie, als in die Hand eines Mannes, den der bislang noch weit überwiegende Teil der deutschen Judenheit, welcher sein Judentum irgendwie im Rahmen der deutschen Volks- und Staatsgemeinschaft auszuwirken gedenkt, als seinen geistigen Führer ehrt. Denn mag diese Ansicht des Judentums bejaht oder verneint werden – zur Erkenntnis dessen, was der Augenblick verlangt, ist sie die allein taugliche Voraussetzung. Nur auf dem „Boden der gegenwärtigen Zustände“ läßt sich machen, was die hier vorgelegten Gedanken eingestandenermaßen machen wollen und sollen: Politik.
Das Problem einer jüdischen Erziehung verengert sich auf dem Boden der, mindestens bisher, herrschenden deutschen Zustände zu dem Problem des jüdischen Religionsunterrichts. Dieses wiederum verengert sich bei der überwiegenden Stadtsässigkeit und der ungewöhnlichen Gesellschaftsschichtung der deutschen Judenheit wesentlich zur Frage nach dem jüdischen Religionsunterricht auf der höheren Schule, dem Gymnasium, Realgymnasium und der Ober-Realschule. In weiten und gerade den einflußreichsten Kreisen haben sich die Dinge so entwickelt, daß die beiden meist nur einige Jahre lang besuchten „Religionsstunden“ neben einigen Predigten zu den hohen Feiertagen die beinahe einzige Quelle für das „jüdische Wissen“ des künftigen Justiz-, Sanitäts-, Kommerzienrates bilden. Die Aufgabe, hier Abhilfe zu schaffen, ist längst erkannt und seit einiger Zeit ernstlich in Angriff genommen. Allerdings, wie mir scheint, nicht im vollen Gefühl ihrer Eigentümlichkeit und infolgedessen nicht in grundsätzlicher Klarheit und Einsicht.
Die Beschlüsse der Rabbinerversammlung, die im Sommer 1916 über diese Dinge verhandelte, legen bewußt oder unbewußt die Vorstellung zugrunde, als ob hier, abgesehen von den äußeren organisatorischen Mißständen, hauptsächlich nur die Schwierigkeit bestünde, die für den christlichen Religionsunterricht allerdings die eigentliche ist: die Schwierigkeit, eine Entwicklung des Gemüts durch, man mag sich stellen wie man will, immer letzthin lehrhafte Mittel, kurz gesagt durch Beeinflussung des Verstandes zu erreichen. In Wahrheit ist aber das Problem des jüdischen Religionsunterrichts ein ganz anderes. Es geht nicht um die Schaffung eines gefühlsmäßigen Mittelpunkts für den Kreis der Weltdinge, in den die übrigen Lehrfächer den Schüler einführen, sondern um nichts Geringeres, als um die Einführung in eine eigene, der übrigen Bildungswelt gegenüber wesentlich selbständige „jüdische Sphäre“. Diese Sphäre ist für die hier in Frage kommenden Teile der deutschen Judenheit, die den bewußt jüdischen Charakter des Hauses allermeist schon in einer der letzten drei Generationen preisgegeben haben, einzig noch gegeben in der Synagoge. Die Aufgabe des Religionsunterrichts kann hier also nur die sein, zwischen den Institutionen des öffentlichen Gottesdienstes und dem Einzelnen die von selber, d. h. „von Haus aus“, überhaupt nicht mehr vorhandene Fühlung herzustellen.
Die Aufgabe erscheint zunächst, dem hohen Begriff einer „religiösen Erziehung“ gegenüber, kleinlich und beschränkt. Wer aber eine Vorstellung davon hat, wie sehr unsere gottesdienstlichen Einrichtungen Filter und Sammelbecken zugleich bedeuten für alles, was sich in unserer dreitausendjährigen Geistesgeschichte im innersten jüdischen Sinn als fruchtbar und kräftig erwiesen hat, der wird wissen, daß in dem scheinbar eng gezogenen Kreis der Aufgabe alles Wünschbare beschlossen ist. Mag, um bei den literarischen Zeugnissen zu bleiben, mag das biblische Schrifttum des Altertums Quelle und Grund alles lebendigen Judentums sein, mögen wir im talmudischrabbinischen der späteren Zeit seine Enzyklopädie, in dem philosophischen seine feinste Sublimierung sehen, – Extrakt und Kompendium, Handbuch und Gedenktafel dieses ganzen geschichtlichen Judentums bleiben dennoch der Siddur und die Machsorim. Wem diese Bände kein versiegeltes Buch bedeuten, der hat das „Wesen des Judentums“ mehr als erfaßt, er besitzt es als ein Stück Leben in seinem Innern, er besitzt eine „jüdische Welt“.
Dies Wort wird uns weiter führen. Er kann eine jüdische Welt besitzen, aber ihn umfängt in jedem Fall eine andere, eine unjüdische. Am zweiten, an der Tatsache, ist nichts zu ändern, soll wenigstens nach dem Willen unserer Mehrheit nichts geändert werden; das erste, die Möglichkeit, soll nach dem Willen dieser selben Mehrheit wirklich, aufs neue wirklich werden. Aber eine Welt „besitzen“ bedeutet nicht: sie innerhalb einer anderen, die den Besitzer selbst umschließt, besitzen; so ist es für den Deutschen möglich, eine fremde, antike oder moderne Kultur zu besitzen, eben weil und insofern sie der Gesamtwelt, die ihn umschließt, gleichfalls angehört; deswegen wird er sie, ohne aus seiner eigenen Welt herauszutreten, sich aneignen können, etwa auch ohne ihre Sprache zu verstehen; denn er wird sie, geistig verstanden, immer nur in einer Übersetzung aufnehmen, nämlich eben übersetzt in die „Sprache“ seiner Welt; und alte wie neue Erfahrung zeigt, daß es durchaus nicht gerade die Sprachkenner im Wortverstande sind, die fremde Kulturen in diesem Sinne „besitzen“. Anders, ganz anders bei unserer Frage. Zwar gehört die Welt, die hier anzueignen ist, in gewissem sehr bedeutendem Sinn auch zu den Grundkräften der umgebenden Welt, aber gerade in diesem Sinne soll sie hier nicht angeeignet werden. Nicht als Vorstufe, nicht als Element jener anderen umschließenden Welt dürfen wir unsere ureigene jüdische Welt erfahren. Ein jeder andere darf und soll das, wir nicht. Uns ist das Judentum mehr als eine Kraft der Vergangenheit, eine Merkwürdigkeit der Gegenwart, uns ist es das Ziel aller Zukunft. Weil aber Zukunft, darum eine eigene Welt; unbeschadet und ungeachtet der Welt, die uns umgibt. Und weil eine eigene Welt, darum auch in der Seele des Einzelnen verwurzelt mit einer eigenen Sprache. Der Deutsche, auch der Deutsche im Juden, kann und wird die Bibel deutsch – luthersch, herdersch, mendelsohnsch – lesen; der Jude kann sie einzig hebräisch verstehen. Und mag hier noch ein Nebeneinander von Möglichkeit gelten, eben weil hier der gemeinsame Besitz der beiden liegt, – für die Sprache des jüdischen Gebets gilt es ganz zweifellos und eindeutig: sie ist unübersetzbar. So wird es hier nie sein Bewenden haben können mit der Vermittlung des literarischen Stoffs; das Schulzimmer wird immer nur der Vorraum sein, aus dem der Weg zur Teilnahme am Kult der Gemeinde führt. Das lebendige tätige Verständnis des Gottesdienstes ist der Faden, an den kristallgleich sich ansetzen kann, was dem Judentum zu seiner Fortdauer allezeit nottut: eine jüdische Welt.
Von solchen Voraussetzungen aus sei nun zunächst ein Bild entworfen, wie dieser Unterricht sich gestalten und gliedern möge. Nicht daß ich dächte, hier irgend Endgültiges zu geben; aber nur eine entschlossen einseitige, wenn auch bloß vorläufige, Wahl zwischen dem Mancherlei des Möglichen kann die Deutlichkeit gewährleisten, die zur Verständigung erforderlich ist. Das Bild gehe voran; alles was zu seiner Verwirklichung unter den heutigen Umständen gehört – und wir werden sehen, daß es nichts Geringes ist –, wird ihm folgen.
Wir legen zunächst weiter nichts zugrunde als das, was bisher schon ziemlich allgemein besteht: zwei Wochen –, also 80 Jahresstunden und eine neunjährige Schulzeit vom neunten bis achtzehnten Lebensjahr. Eine erste sehr wichtige Neuforderung rein äußerlicher Art, die einzige, die wir unter allen Umständen dem bestehenden öffentlichen Schulwesen gegenüber durchsetzen müssen, wird gleich genannt werden. Da weiter das deutsche Schulwesen schwerlich so bald eine allgemeine innere Umgestaltung erfahren wird, so setzen wir die jetzt bestehende höhere Schule voraus, in der, was hier vor allem in Betracht kommt, gleich im ersten Jahr eine Fremdsprache gelehrt wird. Wir nehmen ferner an, daß der Sextaner von der Vorschule her höchstens eine gewisse Kenntnis der „biblischen Geschichte“ mitbringt, so daß also unser Unterricht ziemlich voraussetzungslos beginnen muß. Das Rückgrat des Unterrichts auf Sexta und in den folgenden Jahren wird dann jene Ordnung sein, in der sich die Selbständigkeit der jüdischen Welt heut am sinnfälligsten ausdrückt: der jüdische Kalender, das eigene „Kirchenjahr“. Indem das Kind in die jüdische Woche und das jüdische Festjahr eingeführt wird, kann ihm hier anschließend eine Reihe der wichtigsten kultischen Gebräuche erklärt werden und wieder im unmittelbaren Anschluß an diese eine Darstellung der biblischen Geschichte in ganz frei aus Schrift und Agada geschöpften Einzelbildern folgen. Was die Pesachhagada in der Zeit ihrer Entstehung geleistet haben muß, das oder etwas Ähnliches hat hier der Lehrer im Zusammenhang der Behandlung des Sabbats und der Festtage zu geben. Vollständigkeit verschlägt dabei wenig, auf die Lebendigkeit allein kommt es an. Es ist unnötig und auch kaum möglich, im einzelnen Vorschriften zu geben. Ganz sachte und allmählich, noch möglichst ohne grammatische Erklärungen, rein nach der alten schlecht und rechten Weise des Wort-um-Wort-Übersetzens sind diesem Unterricht von Anfang an kleine hebräische Stücke beizugeben; es genügt, wenn der Schüler im ersten Halbjahr Teile vom Sch’ma, die Eingangs- und Schlußgruppe der Sch’mone esre, einzelne Segenssprüche insbesondere aus der Feier des Freitagabends, einiges aus den Stücken beim Aus- und Einheben, und, je nachdem es ein Sommer- oder Winterhalbjahr ist, kleine Hauptstücke zu den betreffenden Festen, sei es ein Stück Moaus Zur, sei es das Mah nischtanno, die Zehn Worte, die Akeda, das Owinu malkenu in dieser primitivsten Weise „übersetzt“ hat. Daß nicht gleich mit dem weit rationelleren grammatischen Verfahren begonnen wird, hat einen doppelten Grund. Einmal empfiehlt es sich, die natürlichen Schwierigkeiten der ersten Fremdsprache möglichst schon im allgemeinen Unterricht überwunden sein zu lassen und nicht den Religionsunterricht damit zu belasten. Ferner aber hat jene überlieferte Weise trotz ihrer Umständlichkeit und der geringen Dauerhaftigkeit ihrer Ergebnisse den einen gar nicht zu unterschätzenden Vorzug, daß das Kind hier in die heilige Sprache nicht als in ein totes grammatisches Lehrgebäude, sondern gewissermaßen wie in eine lebendige Sprache, durch den Gebrauch, eingeführt wird und daß dem grammatischen Unterricht schon ein gewisser Vorrat von Belegen zur Verfügung steht. Eben dies ist ja der Unterschied vom grammatischen Betrieb der eigenen und der fremden Sprache, daß in dieser der Schüler von der Regel zur Anwendung, in jener hingegen von der Anwendung zur Regel fortschreitet. So ist es unser Wunsch, daß der Schüler etwa beim Erlernen der Konjugation sich an den schon, wenn auch grammatisch unverstanden, seinem Gedächtnis einverleibten Sprachschatz erinnern kann, also etwa, um im Rahmen der oben gegebenen Beispiele zu bleiben, der Reihe nach an: „der ich dich herausgeführt habe“, „und du sollst lieben“, „der uns gegeben hat“, „wir haben gesündigt“, „und dienet fremden Göttern“, „da gingen sie beide zusammen“. Immerhin, etwa in der zweiten Hälfte des ersten Schuljahrs dürfte es ratsam sein, mit dem grammatischen Unterricht zu beginnen und bis zum Ende dieses ersten Jahres das Wichtigste von Hauptwort und Fürwort sowie das regelmäßige Zeitwort einzuüben. In der ersten Hälfte des zweiten Schuljahrs würde dann mit dem noch Fehlenden, vor allem mit dem unregelmäßigen Zeitwort, abgeschlossen werden. Was durch die vorangegangene kurze Epoche rein mechanischen Übersetzens an Zeit verloren ist, wird sich durch die Erleichterung des beispielgetragenen Grammatikunterrichts leicht wieder einbringen. Im ganzen darf man hier überhaupt keine übergroßen Schwierigkeiten sehen; vorausgesetzt nur, daß auf alles Beiwerk von Ausnahmen und Abweichungen verzichtet wird und man nur das nackte Gerüst der Regeln und Schemata systematisch darbietet; alles weitere tut die Übung. So wird es auch nicht als übermäßige Inanspruchnahme erscheinen, daß diese ganze systematische Grammatik hier auf einen Teil, sagen wir je eine Viertelstunde, von höchstens zweimal 40 Stunden zusammengedrängt wird; der Stoff läßt sich bei der eben vorgeschlagenen Beschränkung bequem auf 70 bis 80 solche „Zwerglektionen“ verteilen.
Das zweite Schuljahr findet so den Schüler schon mit einem gewissen Schatz hebräischer Kenntnisse, die es erlauben, in allmählich gesteigertem Tempo das erste Buch der Thora, natürlich in Auswahl, zu lesen. Daneben wird sich Zeit finden, alle wesentlichen Teile des Siddur, wenigstens die täglichen und sabbatlichen Gebete, zu lesen; Stücke, die besondere sprachliche oder sachliche Schwierigkeiten enthalten, wie einzelne Psalmen, die Sprüche der Väter u. a., bleiben fort. An diesen Stoff läßt sich alles, was man etwa sonst wünscht, anknüpfen. Eine gesonderte „biblische Geschichte“ wird sich ja ohne weiteres erübrigen, wenn dem Kind die ehrwürdigen Gestalten der Väter schon in ihrer eigenen Sprache entgegentreten; es werden ihm die großen Momente dieser Erzählung nicht in abgeblaßter Nachbildung, sondern in ihrer starken Echtheit sich einprägen, statt eines lahmen „Wo bist du?“ in der Paradieserzählung, eines „Hier bin ich“ in der Akedah die ewige Gedrungenheit des hebräischen Urlauts. Wie sinnlos, wie zweckwidrig ist es überhaupt, jüdischen Kindern die Kernsprüche ihres Glaubens in deutscher Übersetzung ins Leben mitgeben zu wollen. An der Sprache hängt der Sinn, und es ist wahrhaftig eine Unterschätzung der Innigkeit, mit der sich Christentum und deutsche Sprache seit Luther und länger schon vermählt haben, wenn man glaubt, jüdische Inhalte in deutscher Sprache ohne fremdgläubigen Beiklang mitteilen zu können. Am schlimmsten, wenn gar das Gedächtnis systematisch mit solchem Aufguß vollgefüllt wird; es ist wirklich nicht schwerer, einen Psalm im ursprünglichen Wortlaut einem frischen unbelasteten Kindergedächtnis einzuprägen als in dem meist noch dazu recht fragwürdigen „Deutsch“ der gegenwärtig zu diesem Zweck bei uns beliebten Übersetzungen.
Das Kalendarische wird bei der angegebenen Stoffverteilung in diesem zweiten Schuljahr zurücktreten; die Notwendigkeit eingehenderer Behandlung sowohl der Vätergeschichte wie des täglichen und wöchentlichen Gebetszyklus macht das notwendig. Vom dritten Jahr an aber tritt es beherrschend hervor. Der Unterricht folgt von jetzt ab nach Möglichkeit dem Wochenabschnitt. Der Elfjährige wird nach den beiden vorausgegangenen Jahren schon zu einigermaßen geläufiger Durchnahme der Thora imstande sein; auch jetzt ist selbstredend Vollständigkeit noch durchaus nicht am Platze; es wird sich nur um eine Auswahl handeln; wieweit es ratsam ist, diese Auswahl durch eine eigene Schülerausgabe des Textes dem Lehrer vorzuschreiben, könnte ich nicht sagen. An den Siddur schließen sich in diesem Jahr, den Festzeiten entsprechend, ausgewählte Stücke aus den Machsorim und natürlich die Pesachhagada. Wesentlich nun ist, daß von jetzt an, nachdem der Schüler genügend vorbereitet ist und überdies der Zeitpunkt der Barmizwah in Sicht kommt, ihm Gelegenheit gegeben wird, am sabbatlichen Gottesdienst teilzunehmen. Es bedarf dazu allerdings eines Entgegenkommens von seiten der Schule. Die höheren Schulen der Stadt oder, in sehr großen Städten, eines Stadtbezirks müssen eine gewiß nicht ganz leichte Stundenplanvereinigung vornehmen, durch welche eine der zwei oder drei Wochenstunden in christlicher Religion auf eine Stunde des Samstagvormittags gelegt wird, und zwar vom dritten Schuljahr aufwärts mindestens bis zum fünften, wenn möglich – es wird dies von der Anzahl der christlichen Religionslehrer abhängen, die an der Schule tätig sind – auch noch weiter. Dadurch wird für die jüdischen Schüler eine Stunde, also bei entgegenkommender Einteilung der Pausen leicht 5/4 Stunden, zum Besuch des Gottesdienstes frei, und nun muß die jüdische Gemeinde für zweierlei sorgen: einmal müssen, falls die Verhältnisse nicht schon von selbst so liegen, Gottesdienste in einer Räumlichkeit eingerichtet werden, die von sämtlichen Schulen des Ortsbezirks nicht weiter als 10 Minuten entfernt ist, und ferner müssen die in Betracht kommenden Gottesdienste so gelegt werden, daß in diese knappe Stunde, wie es durchaus möglich ist, sowohl Ausheben wie Einheben zu liegen kommt. Ist es angängig, daß dieser Gottesdienst der Hauptgottesdienst der Gemeinde ist – um so besser; geht das nicht, so wird ein kleiner Nebengottesdienst bei dem durchaus zu „demokratischer“ Schlichtheit neigenden Charakter unseres Kults auf die jungen Seelen kaum weniger Eindruck machen wie der große „offizielle“, und jedenfalls einen größeren als ein künstlich zurechtgemachter „Jugendgottesdienst“, der gerade das, worauf es ankommt, die Einführung in das Leben der Gemeinde, nicht leistet. Ein Zwang zum Besuch soll natürlich keinesfalls ausgeübt werden. Aber der Antrieb dazu soll vom Unterricht ausgehen und die Möglichkeit von der Schule gegeben werden. Es versteht sich übrigens bei dem geschilderten nahen Zusammenhang zwischen Unterricht und Synagoge ganz von selbst, daß die Aussprache des Hebräischen, die im Unterricht eingeübt wird, sich nach der Synagoge richten muß; nur dann kann jenes Gefühl des Heimischseins entstehen, aus dem das Bewußtsein des Besitzes einer eigenen jüdischen Welt entspringt.
Der kalendarische Zusammenhang wird nun im nächsten Schuljahr – Untertertia – auf einer neuen Stufe wieder aufgenommen. Lernte der Elfjährige bloß Thora, so der Zwölfjährige jetzt Thora mit Raschi; ich brauche nicht mehr zu sagen, daß auch hier wieder nur eine Auswahl gemeint ist. Der große volkstümliche Kommentator, der den aufgespeicherten Schatz des ersten Exiljahrtausends dem zweiten übermittelt hat, wird den Schüler unvermerkt in die geistige Welt des talmudischen und midraschischen Schrifttums hineinspinnen, die für die jüdische Eigenart, mehr als wir wissen und zugeben, selbst bis in unsere Gegenwart hinein bestimmend geworden ist. Es bleibt Sache des Lehrers, schon auf dieser Stufe hier und da mit Vorsicht und Ehrfurcht das Gespinst etwas zu zerteilen und dem Schüler Durchblicke zu öffnen auf die Kräfte des Judentums, die, großenteils erst nach Raschi erstarkt, diesem noch fremd waren. Die in diesem vierten Jahr vom Schüler erreichte Sprachsicherheit wird ihn befähigen, ziemlich bald von dem anfangs gebrauchten punktierten Text zum unpunktierten überzugehen. Kursorische Lektüre der wichtigsten Stücke aus den erzählenden Büchern von Josua bis Nehemia wird außerdem nebenher in diesem Schuljahr ihren Platz finden und so die biblische Geschichte abschließen. Es ist, um auch das noch hinzuzufügen, durchschnittlich an der Wende von diesem zum nächsten Schuljahr, daß der Schüler als Barmizwah in die Gemeinde tritt. Man wird zugeben, daß das bis hier bezeichnete Maß von Vorbereitung dem Akt, der in seiner feierlichen Einfachheit und seiner Unbeschwertheit von intellektuellen und moralischen Examensnöten wahrhaftig verdient erhalten zu werden, wieder die Bedeutung sichern wird, die ihm seit den letzten Jahrzehnten in den betreffenden Kreisen rapid verlorenging.
Die zwei Jahre, die nun folgen – Obertertia und Untersekunda – müssen unter den heutigen Umständen, wo mit der Einjährigenberechtigung, hier eine bei uns sehr bedeutende Gruppe, die künftigen Geschäftsleute, abzuschwenken pflegt, als eine Art Abschluß gestaltet werden. Im ersten dieser beiden Jahre wird die Anlehnung an den jährlichen Kreislauf der Sabbate gegeben durch den Zyklus der Haftaroth. Im Anschluß an diese, insbesondere an einige Prophetenabschnitte, wird sich hier leicht eine wenn auch nur primitive Erörterung unseres Standpunkts gegenüber dem Christentum geben. Auch die Sprüche der Väter wären auf dieser Stufe durchzunehmen; diese Kernworte jüdischer Ethik einerseits und, mit ausgesuchten Abschnitten aus der Mischnah und hie und da auch aus den Kodifikatoren, die klassischen Belege für eine Reihe der wichtigsten Gebräuche andrerseits werden so die Kenntnis des praktischen Judentums zu einem ersten Abschluß bringen. Das zweite dieser beiden Jahre – Untersekunda – wird in ähnlicher Weise die Kenntnis des geistigen Judentums abschließen. Vor allem die Psalmen, soweit sie noch nicht aus dem Siddur bekannt sind, und auch sonst, nach Ermessen des Lehrers, bisher noch nicht gelesene Stücke der Schrift haben hier den Ausgangspunkt zu bilden. Ferner gehört hierher ein gedrängter Überblick – mehr nicht – über die jüdische Geistesentwicklung im Zusammenhang der allgemeinen Schicksale des Volks. Und schließlich soll, wie mir scheint, der Schüler nicht entlassen werden, ohne daß er nicht auch einen eigenen Einblick getan hat in das eigentümlichste und in mancher Hinsicht bedeutsamste Erzeugnis dieses Geistes: den babylonischen Talmud. Ich bin mir der Kühnheit dieses letzten Verlangens wohl bewußt. Dennoch scheint es mir nicht zu umgehen. Es wird auf die Dauer ein mindestens ungesunder Zustand, daß unserer Gemeinschaft oder wenigstens ihren nach außen führenden Kreisen nahezu gänzlich jede lebendige Fühlung mit diesem Buch, dem sie äußerlich gesehen ihren Zusammenhalt und Bestand bis in die neueste Zeit dankt, verlorengegangen ist, soweit daß man vielleicht von der Mehrheit unserer jüdischen Gebildeten ohne Übertreibung behaupten kann, daß sie das Buch wissentlich nicht einmal von außen je gesehen haben. Andrerseits ist die Übermittlung einer solchen allgemeinen Kenntnis innerhalb des beschränkten Raums von rund 25 Unterrichtsstunden – wenn wir 40 auf Bibellektüre und 15 auf den Überblick der jüdischen Geschichte rechnen – nicht so schwierig, wie es zunächst scheint. Die bisher erreichte Sicherheit im Hebräischen erlaubt es, die sprachliche Eigenart des talmudischen Aramäisch, dem man ohnedies noch durch Lektüre der aramäischen Teile der Bibel zu Hilfe kommen kann, als „Abweichungen vom Hebräischen“ sehr kurz zu behandeln; es genügt dann, wenn einige möglichst zugleich leichte und charakteristische Proben aus verschiedenen Gebieten dieser klassischen „Jüdischen Enzyklopädie“ durchgegangen werden; genug, wenn der Schüler einen Begriff von dem Besonderen der talmudischen Lehrart und eine entfernte Vorstellung von dem Umfang der behandelten Gegenstände erhält. Der Talmud gehört, eben durch seine Fremdartigkeit gegenüber dem heutigen Denken und Wissen, zu den Dingen, bei denen der Sprung vom Nichtkennen zur oberflächlichen Bekanntschaft größer und bei guter Leitung ausblicksreicher ist als der von dieser oberflächlichen Bekanntschaft zu gründlicher Vertrautheit.
Was nach dem Scheideweg der Einjährigenberechtigung noch auf der Schule bleibt, darf als ein in gewisser Weise noch weiter gesiebtes Schülermaterial angesehen werden. Während aus jener abschwenkenden Gruppe vielfach die tätigen Erhalter des materiellen Daseins unserer Gemeinschaft hervorgehen, bleibt jetzt der Rest, der auf die Ansichten, auf die „öffentliche Meinung“, soweit man von einer solchen innerhalb der Gemeinde reden kann, zu wirken bestimmt ist. So wird sich der Unterricht der drei letzten Jahre eindeutiger als bis dahin auf ein Schülerpublikum von künftigen Akademikern einstellen. Im ersten – Obersekunda – mag die zuletzt gewonnene Ansicht des Talmuds noch etwas vertieft werden; zugleich läßt sich hier durch eine Heranziehung der im weiteren Sinn talmudischen Literatur, insbesondere der Midraschim, der im vorhergehenden Jahre verlorene Anschluß an das jüdische Jahr wiedergewinnen; die Kenntnis dieser ganz eigentümlichen, man möchte sagen, wissenschaftlichen Mythologie ist ja für das tiefere Verständnis des jüdischen Geistes geradezu Voraussetzung. Neben dieser gewissermaßen volkstümlichen Quelle der jüdischen Weltanschauung wird nun auf dieser Klassenstufe vor allem Raum zu schaffen sein für eine gründliche Übersicht über ihren klassischen Ausgangspunkt, die Prophetie. Zu den einzelnen Prophetenabschnitten, die schon der Obertertianer und Untersekundaner gelesen hat, kommt jetzt eine zusammenhängende Auswahl von Amos und Hosea bis zu Maleachi und Daniel; mindestens die Hälfte der Zeit dieses Jahres ist darauf zu verwenden; ich rechne, daß dann etwa ein Fünftel des ganzen Textes durchgelesen werden kann; bei guter Auswahl genug. An diesem Hauptstück unseres Schrifttums als an dem eigentlich kritischen Punkt und wahren religionsgeschichtlichen Scheideweg mag dann auch das schon früher gelegentlich erörterte Verhältnis zum Christentum gründlich dargestellt werden.
Nachdem so die geistigen Grundlagen weitschichtig gelegt sind, mag nun das nächste Jahr – Unterprima – eine Art anthologischen Überblicks über die ganze exilische Literatur bringen. Von Philo und Saadja über Gabirol und Ibn Esra, Juda ha-Levi und Maimonides, Gersonides und Albo weiter zu Caro und Isserles bis hin zu Mendelssohn und Zunz und je nach der Neigung des Lehrers auch noch weiter in unsere Zeit mag der Schüler geführt werden. Hier endlich liegt ein Stoff vor, der ihm großenteils, wenn auch nicht ausschließlich, in Übersetzung vorgelegt werden kann; denn der geheime Zauber des hebräischen Worts ist diesen Produktionen meist, und gerade vielfach den größten unter ihnen, nicht an der Wiege gesungen; so wird hier die Weiterübersetzung ins Deutsche wenig verschlagen. Es läßt sich sehr viel in so einem Jahr zusammendrängen; 80 Stunden sind eine lange Zeit, die Zeit einer zweisemestrigen dreistündigen Universitätsvorlesung; man darf sie ruhig voll rechnen; denn ein Lehrer, der bei Sechzehn- und Siebzehnjährigen und einem solchen Stoff noch glaubt „Pensen abfragen“ zu müssen, disqualifiziert sich selber.
Dem Überblick folgt die Vertiefung. Das letzte Schuljahr sei wesentlich der Philosophie gewidmet. Hier muß der persönlichen Liebe des Lehrers freie Bahn gelassen werden; es ist seine Sache, ob er hier ein Stück Kusari oder Ikkarim oder More oder Choboth halebaboth lesen will oder gar es wagen möchte, den Schülern einen Einblick in den Sohar oder in Lurja zu öffnen. Nicht auf den eindrucksvollen Reichtum des literargeschichtlichen Gesamtbildes, wie im vorhergehenden Jahre, kommt es hier an, sondern auf sachliche Vertiefung am einzelnen Punkt oder an einzelnen Punkten. Auch Hiob oder Koheleth mag mancher Lehrer hier lesen wollen; es sei ihm unbenommen. Die stärksten und tiefsten Eindrücke sind gerade recht für den künftigen Abiturienten; er soll das Judentum nicht bloß als eine ihm eigene Welt, sondern auch als eine geistige Macht erkennen und im Leben behüten.
Dies der Plan. Verlockend zunächst, aber wie es scheint aussichtslos, was die Verwirklichung anlangt. Auf ein erstes Bedenken wird schon die vorausgesetzte wirkliche Neunklassigkeit stoßen. Denn dies allerdings ist hier ganz entschieden verlangt, daß jede Klasse wirklich für sich unterrichtet wird. Das System (wenn man ein reines Verlegenheitserzeugnis so nennen will), das System der Zusammenlegung mehrerer Klassen zu einer „Stufe“ ist geradezu der Tod jedes lebendigen Unterrichts, der eben, im Ideal, eine ständige Wechselwirkung zwischen dem Lehrer und sämtlichen anwesenden Schülern voraussetzt; die zwei Drittel Unbeteiligte im Klassenzimmer müssen gerade für den guten Lehrer, d. h. für den Lehrer, der sein Lehren aus den auf ihn gerichteten Augen der Schüler schöpft, ein Bleigewicht sein; ganz abgesehen davon, daß die eine Lehrergehaltsersparnis erkauft wird durch eine vielfache Schülerzeitverschwendung. Und dabei ist gerade dieser Mißstand bei etwas gutem Willen verhältnismäßig leicht zu beheben. Es ist weiter nichts erforderlich als eine Zusammenlegung der Unterrichtsstunden von sämtlichen höheren Schulen der Stadt oder des Stadtbezirks, allenfalls bis zu 30 und mehr Schülern, eine Zahl, die sich ja in den Oberklassen automatisch verkleinern würde. Geeignete Nachmittagsstunden wenigstens hierfür freizuhalten, wäre kein übermäßiger Anspruch an die Schulen; zur Not müßte man eben weniger günstige Zeiten wählen; auf Vormittagsstunden wird sowieso kaum zu hoffen sein. Überhaupt wird man gut tun, sich nicht allzuviel auf Entgegenkommen der öffentlichen Mächte zu verlassen und nach Möglichkeit in diese ganzen Überlegungen nur die eigene Kraft als Faktor einzustellen. So wird man vor allem sich zunächst auch auf ein staatsgesetzliches Obligatorischwerden unseres Unterrichts nicht versteifen dürfen; gewiß wäre es ein sehr wünschenswertes Stück „Gleichberechtigung“; aber andrerseits würde der staatliche Einfluß in einem Maße verstärkt, wie es einer so jungen Einrichtung nicht zuträglich wäre. Verlassen wir uns lieber zunächst sowohl in der Finanzierung wie in der Schülerheranziehung auf die eigenen materiellen und pädagogischen Leistungen. Gerade die Stellung des Hebräischen im Mittelpunkt des Unterrichts wird vielfach, obwohl die Sprache hier ja keineswegs Bildungsziel, sondern durchaus nur notwendiger Bildungsträger ist, den Behörden ein Dorn im Auge sein; man wird trotz der wirklich bescheidenen Zeitbeanspruchung – zwei Wochenstunden! während etwa der übliche private Musikunterricht durchschnittlich mit „Üben“ vier bis sechs Wochenstunden wegnimmt – den Überbürdungseinwand machen, ein Einwand, der ohnehin bei „jüdischen Köpfen“ weniger stichhält als im allgemeinen; und man wird vielleicht im Grunde noch weitergehende nicht auszusprechende Besorgnisse haben. Denn verhehlen wir es uns nicht: gerade der liberalgerichtete Flügel der deutschen Judenpolitik hat – von Dohm und Hardenberg und Humboldt an – stets den Leitgedanken gehabt: die Emanzipation sei das Mittel zur Lösung der Judenfrage im Sinne einer Assimilation, die auch der entschiedenste Assimilant, der sich noch zu uns zählt, nicht unter dem Wort mitbegreifen würde. Deswegen können wir hier nur auf vorsichtige Unterstützung rechnen und selbst auf diese eher aus – freilich unsere Ziele und Gründe mißverstehenden – konservativen als aus liberalen Kreisen. Wie in den schulorganisatorischen Fragen, so auch in der Frage der Stellung des Lehrers im Lehrerkolleg. Auch hier möge auf den Kampf ums Recht nicht zuviel nützlicher zu verwendende Kraft verpulvert werden. Hier wie überall ist es besser, vom Keller und aus Eigenem zu bauen; steht einmal erst ein Gebäude eindrucksvoll da, so wird die öffentliche Gewalt sich schon von selbst und in ihrem eigenen Interesse bereitfinden, ihm öffentliche Rechte und dadurch sich selber geregelten Einfluß zu begründen.
Mit der Lehrerfrage haben wir nun allerdings den Kern aller Ausführungsfragen angeschnitten. Hier liegt der Sitz des Übels und damit die Stelle, an der die Pflege ansetzen muß. Es soll hier nichts gegen den Stand unserer jüdischen Elementarlehrer gesagt werden. Der Verfasser dieses Aufsatzes hat persönlich und auf Grund seiner Kindheitserfahrungen alle Achtung vor dem ernsthaften und nicht erfolglosen Bildungsstreben, das unter ihnen verbreitet ist; sie haben ihre Sache nicht schlecht gemacht. Dennoch muß gesagt und soll im folgenden, und zwar ebensosehr, ja noch mehr aus allgemein judenschaftlichen Gesichtspunkten als aus den besonderen pädagogischen, begründet werden: der Unterricht, wie wir ihn uns denken, muß soweit irgend möglich von akademisch gebildeten Lehrern gegeben werden. Und zwar genügt es nicht, diesen Unterricht etwa nebenher von jüdischen Mathematikern oder Neuphilologen geben zu lassen; abgesehen davon, daß auch nach dem Krieg schwerlich eine genügende Zahl vorhanden sein wird, um, noch dazu nebenher, diesen immerhin achtzehnstündigen Unterricht mitübernehmen zu können. Ganz abgesehen davon brauchen wir einen Stand von eigens theologisch gebildeten Lehrern; wir brauchen eine wissenschaftlich gebildete Theologie unabhängig von der Rücksicht auf Pflichten eines geistlichen Amts.
Es ist kaum zu bestreiten, daß das moderne westjüdische Rabbinertum innerhalb der jüdischen Entwicklung etwas Neues darstellt. Wohl ist der Zusammenhang mit dem Alten auch jetzt noch hinlänglich zu erkennen, aber mehr und mehr haben sich Züge hervorgedrängt, die den beamteten Gelehrten, gewissermaßen den theologischen Syndikus seiner Gemeinde von einst zu dem Geistlichen, ja in gewissen Funktionen namentlich in den „liberalen“ Gemeinden geradezu Priester von jetzt umschufen. Es soll an dieser Entwicklung nicht gemäkelt werden; das Neue entspricht in gewissem Umfang neuen Bedürfnissen; verhängnisvoll ist bloß, daß das Alte beseitigt ist, ohne seinerseits ein Fortleben neben dem Neuen gesichert zu bekommen. Gänzlich verschwunden ist von dem früheren Zustand gerade das Allerwesentlichste: der Rabbiner von einst war wie noch heute im Osten zwar in seinem Amt, nicht aber in seiner Bildung (geschweige in seiner Lebenshaltung) einzigartig in seiner Gemeinde. Abgesehen von der Amtsverantwortung war er als Gelehrter einer von mehreren, meist sogar von vielen; seinen Gelehrtentitel hatte er wohl überall gemeinsam mit einer ganzen Anzahl seiner Gemeindemitglieder, so wie heute den Doktortitel. Aber während der Doktortitel keinerlei besondere Gruppe innerhalb der Gemeinde hervorhebt, welcher der Rabbiner durch ihn angehörte, schuf die Morenu-Würde innerhalb der Gemeinde einen Kreis von jüdischen Gelehrten, innerhalb der Judenschaft den Kern eines Publikums. Und eben dies, ein jüdisches Publikum in einem äußeren Umfange, der einigermaßen der ungewöhnlichen Breite unserer allgemein geistig interessierten Schicht entspräche, fehlt. Dieser Mangel macht sich schmerzlich bemerkbar. Das spezifisch Jüdische ist in unseren Gemeinden statt Sache Aller Spezialität Weniger, ja geradezu Einzelner geworden. Das jüdische Interesse bezieht sich wesentlich auf äußere Gemeindeangelegenheiten und auf das den inneren Fragen gegenüber gleichfalls äußerliche Verhältnis zu Staat und Gesellschaft. Das Niveau unserer spezifisch jüdischen Zeitschriften war so, wie es diesem Zustand entsprechend sein mußte; wenn sich hier neuerdings eine Wandlung bemerkbar macht, so ist die eine der beiden allein in Frage kommenden Erscheinungen doch nur Äußerung einer wenn auch hochbedeutsamen Minderheitsgruppe, die andere in ihrem auffallenden Mangel eines gemeinsamen Untertons geradezu ein Spiegelbild jenes Zustands der Publikumslosigkeit, von dem wir sprachen. Ein Blatt von der Einheitlichkeit des Tons und dennoch Vielheit der darin zu Gehör kommenden Stimmen, wie etwa die „Christliche Welt“, findet sich bei uns nicht und ist auf Grund des heutigen Zustandes auch nicht zu schaffen. Die geistige Verflachung der Vereinigungen, die sich die Aufgabe setzen, ein solches jüdisches Publikum herzustellen und zu kräftigen, wie die Literaturvereine und in gewisser Weise auch die Logen, ist kaum zu leugnen; mit Vorträgen über alle Dinge „und“ die Juden ist keine Vertrautheit in der eigenen jüdischen Sphäre zu erreichen; ihnen daraus einen Vorwurf zu machen, wäre ganz unangebracht; sie versuchen Unmögliches; was sie wollen, ist mit Vorträgen und Vereinen überhaupt nicht zu erreichen, wenn der Unterbau, die Schule, fehlt. Soweit das Problem von der Seite des aufnehmenden und in Widerhall und Wechselwirkung die Entwicklung weitertreibenden Publikums.
Die andere Seite liegt bei der wissenschaftlichen Produktion selbst. Sie ist augenblicklich, da 100 Jahre um sind, seit der Begründer der „Wissenschaft des Judentums“ auf die Universität zog, glücklich so weit, daß ihr unmittelbar die Gefahr droht, selbst von diesem ihrem eigensten Gebiet durch nichtjüdischen Wettbewerb verdrängt zu werden, dem sie auf dem Gebiet der biblischen Forschung sowieso nie gleichgeachtet entgegengetreten ist. Sowenig das vom allgemeinen Standpunkt der Wissenschaft ohne weiteres ein Unglück wäre – bei näherer Betrachtung würde auch das anders erscheinen – so gefährlich ist es für uns. Man braucht hierüber nicht viel zu sagen. Die Erfahrungen, die wir in einem Jahrhundert protestantischer Behandlung des „Alten Testaments“ gemacht haben, sprechen laut. Soll auch für das „nachbiblische Judentum“ das modernisierte Christentum der anerkannte Maßstab der Betrachtung werden, so braucht man die Dinge nur sich selber zu überlassen; die Entwicklung des wissenschaftlichen Interesses in protestantisch theologischen Kreisen ist reif dafür. Gelehrte, denen bei allem Scharf- und Feinsinn dennoch die Eigentümlichkeiten jüdischen religiösen Denkens nie ins Gefühl übergehen können, werden dann an Halacha und Hagada, Philosophie und Kabbala ihre Methoden anwenden und uns ähnliche Wunder der sondernden Kritik bescheren, wie sie uns solche mit der Trennung des „unvereinbaren“ „jüdischen Chauvinismus“ und „prophetischen Universalismus“ im 72. Psalm oder mit der Herauslösung des leidenden Knechts Gottes aus der großen messianischen Weissagung der Volks- und Menschheitsgeschichte von Jes. 40 ff. beschert haben; es gibt auch auf dem bisher noch der Wissenschaft des Judentums eingeräumten Sondergebiet genug Erscheinungen, die bloß auf die protestantische Entdeckung ihrer „Unvereinbarkeit“ harren. Nicht daß wir die Leistungen dieser Wissenschaft nicht auch bewunderten; wenn wir wie soeben von „Jes. 40 ff.“ sprechen, bekennen wir uns ja, trotz Ibn Esras Andeutungen, als ihre Schuldner; und daß unsere eigene Beschäftigung mit der Schrift hier nichts Gleichwertiges hervorgebracht hat, bleibt uns ein Anlaß der Scham; um so mehr als wir uns klar sein müssen, daß es uns wahrhaftig nicht an „voraussetzungsloser Kritik“ gefehlt, daß sie sich nur auf andere Gebiete ergossen hat. Aber mindestens neben der protestantischen Wissenschaft müssen wir der jüdischen als der, ich möchte sagen heimischen, innerfamiliären Ansicht dieser Dinge ihren Platz erobern oder sichern; von einer solchen Vervielfältigung der Gesichtspunkte wird letzthin auch jene ihren Vorteil haben. Aber noch sind keine Anzeichen und keine Hoffnungen dafür vorhanden.
Der Grund dieser gegenwärtigen Aussichtslosigkeit der Lage steckt genau da, wo der Grund für das Nichtvorhandensein eines jüdischen Publikums steckt: in der Zuspitzung der theologischen Bildung auf die künftigen Rabbiner. Damit ist eine geistige Verarmung oder mindestens eine Vereinseitigung fast notwendig gegeben. Gewiß sind auch die theologischen Fakultäten der Universitäten so gut wie ausschließlich zur Ausbildung der Geistlichkeit geschaffen; aber schon durch ihre große Zahl bilden sie unter sich zusammengenommen eine Masse von eigenem Aufbau und eigenem Gemeinsinn. So hat sich in ihnen als gelehrter Körperschaft bis zu einem gewissen Grade ein von dem pädagogischen Zweck befreiter mehr oder weniger rein wissenschaftlicher Geist entwickeln können. Ein gleiches ist der Wissenschaft des Judentums schon durch die geringe Zahl ihrer Vertreter erschwert worden; so ist hier die wissenschaftliche Leistung immer Einzelleistung geblieben, hat kaum zur Schulebildung geführt, durch die nun einmal erst der allgemeine Einfluß der Ideen gesichert wird. Der breite Kreis, den die theologischen Fakultäten der Universitäten durch ihre eigene große Zahl darstellen, muß bei uns auf andere Weise hergestellt werden. Und hier bietet sich als Weg zu diesem Ziel der Entwicklung eines eigenen genügend großen Kreises wissenschaftlicher Tätigkeit das gleiche, was wir vom Gesichtspunkt des Schulunterrichts aus zu fordern hatten: die Schaffung eines eigenen theologisch gebildeten Lehrerstandes.
Weniger die Ausbildung als vielmehr die Unterhaltung eines solchen Standes scheint bei den vorhandenen Mitteln unvorstellbar. Für die Ausbildung würden schließlich auch die bestehenden Rabbinerseminare genügen. Selbstverständlich bleibt deshalb die theologische Fakultät im Rahmen einer deutschen Universität ein großes Ziel, vielleicht das Wichtigste, was wir jetzt, wenn wir selbst die nötigen materiellen Opfer bringen, vom Staat im gegenwärtigen Augenblick erreichen könnten. Ganz abgesehen von der anregenden Luft des Universitätsbetriebs, in die der jüdische Theologe seine Studien dort versetzt sähe, wäre es für die ganze deutsche Judenheit – gerade nach dem deutschen Begriff vom Verhältnis zwischen sozialem und geistigem Leben, der in diesem Fall erstrecht auch der jüdische ist – ein kaum zu überschätzender Gewinn, wenn sie in einer Fakultät eine sichtbar erhöhte geistige Vertretung besäße. An inneren Schwierigkeiten sollte der Plan am wenigsten scheitern. Die Zwiefachheit der religiösen „Richtungen“ wäre sicher zu überbrücken; man müßte nur von vornherein für jedes Fach eine Doppelbesetzung vorsehen, also um einmal die geringste Fächerspaltung zugrunde zu legen: je zwei Ordinariate für biblisches, rabbinisches, philosophisches Schrifttum; ganz von selbst werden sich die beiden Fachvertreter innerhalb der Fachgrenzen wieder verschiedenen Hauptgegenständen zuwenden, und während der „liberale Bibelforscher“ Pentateuchkritik treibt, wird sein „orthodoxer“ Kollege die Entwicklung der Exegese behandeln; während der „liberale“ Professor für Rabbinismus sich den Talmud selbst als sein Forschungsgebiet ausgewählt hat, wird der „orthodoxe“ sich auf die Kodifikatoren werfen; während der „liberale“ Philosoph systematische Religionswissenschaft vorträgt, wird der „orthodoxe“ über die mittelalterliche Blütezeit arbeiten. So wird sich eine Arbeitsteilung trotz der Doppelprofessuren irgendwie von selbst ergeben – einfach durch die Weitläufigkeit des Gebiets. Eine nicht zu geringe Zahl von Extraordinarien würde daneben zum mindesten die Behandlung der sozial- und sittengeschichtlichen Gebiete sowie der sprachlichen Hilfswissenschaften sichern; nicht bloß das talmudische Aramäisch würde hier trotz der philosophischen Fakultät seinen Platz finden, sondern auch gewisse Spezialitäten des Arabischen, etwa philosophische Terminologie. Wenn ferner der orthodox-liberale Gegensatz als der geistige Gegensatz, der er ist, Berücksichtigung und Ausgleich verlangt, wie er ja auch auf dem Gebiet der Gemeindeverwaltung solchen Ausgleich im wesentlichen gefunden hat, so ist der andere Gegensatz unserer Epoche, der jenen ersten schneidet, der zwischen Konfessions- und Nationaljudentum, als ein wesentlich politischer hier schlechthin zu ignorieren; die Frage nach der Partei muß verboten sein – das ist das innere Toleranzprinzip unserer theologischen Fakultät. Schwierigkeiten ferner, die sich aus dem Verhältnis zu den Rabbinerbildungsanstalten ergäben, würden sich bei gutem Willen wohl heben lassen. An all dem dürfte das unendlich wichtige Werk nicht scheitern. Die Mittel dafür unter uns zusammenzubringen würde nicht schwer sein. Zweifelhaft aber bleibt, trotz allerlei freundlicher Worte, die Zustimmung der Regierung. Darum sei hier die ganze Angelegenheit zurückgestellt; wir rechnen also mit den technisch ja genügenden bestehenden Vorbildungsanstalten für Rabbiner; ihnen möge auch die Bildung der Lehrer anvertraut werden; sie werden sich der neuen Aufgabe anpassen. Dann aber erhebt sich die große Frage: was weiter?
Es ist nicht genug, daß das Rabbinerseminar uns fertig vorgebildete Lehrer entläßt. Es wurde schon auseinandergesetzt, daß wir nicht bloß Lehrer brauchen, sondern auch arbeitende Gelehrte, eine Gruppe von Hunderten, die, unbeschwert von den äußeren und vor allem den inneren Pflichten des geistlichen Amts, der jüdischen Wissenschaft die nötige Breite der Produktionsmöglichkeiten geben werden. Und beides, der Lehrer und der Gelehrte, müssen die gleiche Person sein. Auch seine materielle Existenz muß auf beiden Seiten seiner Arbeit beruhen. Und was wir hier fordern, ist rein auf dem Wege der Selbsthilfe zu verwirklichen, ohne ein Nachsuchen um staatliche Mitwirkung. Freilich sind die erforderlichen Mittel nicht gering, ein Vielfaches der Summe, aus der eine Fakultät erhalten werden könnte. Wir brauchen nicht mehr und nicht weniger als dies: eine Akademie für Wissenschaft des Judentums. Sie muß von vornherein in einem Maßstab angelegt sein, gegen den die Ansätze, die jetzt schon bestehen, winzig erscheinen; denn ihr Zweck ist eben nicht bloß die Organisation wissenschaftlicher Arbeit, bei der schließlich die zulässige untere Grenze des Umfangs ziemlich niedrig angesetzt werden darf, weil eine kleine Leistung eben auch eine Leistung ist. Sondern sie bezweckt zugleich die geistige und materielle Zusammenfassung der gesamten höheren Lehrerschaft, also einer Gruppe von, um einmal eine Zahl zu nennen, mindestens 150 wissenschaftlichen Arbeitern. Damit ist also ein Stammkapital für mindestens 150 Stipendien von, sagen wir, 2500 Mark notwendig, für die sich die Empfänger zur Mitarbeit an einer der Unternehmungen der Akademie verpflichten. Diese Unternehmungen werden geleitet von den Mitgliedern; im Falle des Vorhandenseins einer Fakultät wären die Mitglieder ohne weiteres der Stamm der Mitglieder der Akademie, die sich dann durch Selbstergänzung entsprechend den wachsenden Aufgaben vermehren würden; anderenfalls müßte dieser Akademikerstamm aus den Dozenten der Rabbinerseminare als gewählter Ausschuß hervorgehen, der dann ebenfalls durch Selbstergänzung wachsen würde. Die nötige Summe würde sich wohl mindestens auf 10 Millionen belaufen, also ungefähr ein Jahresetat der gesamten jüdischen Gemeinden Deutschlands oder auf die Kopfzahl umgerechnet eine Aufwendung, die dem deutschen Wehrbeitrag von 1913 entspricht. Man könnte tatsächlich versuchen, sie nach diesem Muster als „einmaligen Lehrbeitrag“, etwa auch mit dreijähriger Zahlungsbefristung, durch freiwilligen Zusammentritt der Gemeinden aufzubringen; es wäre nicht der schlechteste Nebenerfolg, wenn bei dieser Gelegenheit in Form eines Zweckverbandes der Zusammenschluß der deutschen Gemeinden so aus ihrem eigenen Antrieb sich herstellte. Der andere Weg wäre der bei uns übliche, der durch Sammlung; es wäre nicht unbillig, wenn Stiftungen des Einheitskapitals von 50 bzw. (bei 4 %) 60 000 Mark auf ewig ausgezeichnet blieben und die aus dieser Quelle gespeisten Veröffentlichungen auf dem Titelblatt den Zusatz erhielten, zu wessen Erinnerung die betreffende Stiftung gemacht worden.
Die Inhaber nun dieser Stipendien müssen nicht, aber werden eine Anstellung als Lehrer im Gemeindedienst suchen. Die Gemeinde wird für die achtzehnstündige Lehrtätigkeit ein Gehalt zu bezahlen haben, das freilich immer noch den jetzigen Unterrichtsaufwendungen gegenüber sehr erheblich, andrerseits aber gegenüber dem, was Staat und Stadt dem höheren Lehrer zahlen, gering ist; angenommen, sie zahlt 2500 Mark, so sind damit für die Akademiestipendiaten Stellen von 5000 Mark geschaffen, in Anbetracht des Umstands, daß diese Stellen vor Mitte der 20er Jahre erreicht werden können, ein geradezu glänzendes Auskommen. Für die Gemeinde aber werden die ungewohnt hohen Ausgaben für einen Lehrer sich auch noch außerhalb der Schule lohnen; so wird sich auch die Übernahme des Gehalts eines nur für die höheren Schulen bestimmten Lehrers rechtfertigen, obwohl ohnehin schon bei unserer sozial vorbildlichen Steuerverteilung die Gemeindelasten wesentlich auf die Schultern derer fallen, die ihre Söhne auf die höhere Schule schicken. Auch abgesehen davon also werden sich diese Gemeindeaufwendungen rechtfertigen und lohnen. Suchen wir uns die Stellung des neuen Lehrers einmal vorstellig zu machen.
Er wird neben dem Rabbiner selbständig, theologisch gleichwertig vorgebildet dastehen. Er wird aber anders als dieser, wenigstens anders als dieser in den meisten Fällen, durch seine Arbeit für die Akademie dauernd unter dem befruchtenden Einfluß eines bedeutenden wissenschaftlichen Betriebes stehn. Er wird, da seine Lehramtspflichten, verglichen mit denen eines Oberlehrers, ihn zeitlich wenig und überdies nur nachmittags in Anspruch nehmen, in ganz andrer Weise für wissenschaftliche Tätigkeit frei sein. Seine äußere Stellung wird weniger auf der örtlichen Lehrertätigkeit beruhen, als auf der Zugehörigkeit zu einer großen, das ganze Reich, ja vielleicht, je nach Entwicklung der europäischen Dinge im Friedensschluß, das ganze Mitteleuropa umschließenden gelehrten Körperschaft. Als Mitarbeiter dieser Akademie wird er das jüdische Vortragswesen innerhalb der Gemeinde teils selbstwirkend, teils organisierend in die Hand nehmen und in die Literaturvereine den frischen Luftzug eines großen wissenschaftlichen Lebens hineinwehen lassen; auch die Gemeinden der umliegenden Landstädte wird er durch gelegentliche Veranstaltungen mitberücksichtigen; im Laufe der Jahre wird sich aus seiner eigenen Schülerschaft ein lebendig interessiertes weiteres Publikum hervorbilden. Gemeindebibliotheken mit anheimelndem viel besuchtem Leseraum nach dem bisher unerreichten Vorbild Berlins werden sich überall entwickeln; um so leichter, da schon heute hier weniger die äußere Möglichkeit, als der Wille und Antrieb dazu fehlt; denn schon heute würde es an vielen Orten nur der mutigen Zusammenfassung der verstreut vorhandenen Büchervorräte und Anschaffungsfonds sowie der geschickten Einrichtung von Bibliotheksstunden mit teilweis ehrenamtlichem Aufsichts- und Ausleihdienst bedürfen, um, wenn auch zunächst in bescheidenerem Maßstab, das Berliner Muster nachbilden zu können. Der Lehrer wird ferner das geistige Leben der Gemeinde wirksamer, als bisher dem Rabbiner meist möglich war, nach außen repräsentieren; er wird in der durchschnittlichen universitätslosen mittleren Großstadt schon als „Orientkenner“ zu dem kleinen Kreise der wissenschaftlichen Lokalkoryphäen gehören; seine Stellung, eben gerade weil nicht auf der örtlichen Amtstätigkeit allein beruhend, wird insofern neben dem Galerie- oder Museumsdirektor, dem Vorsteher der Stadtbibliothek, etwa einem oder dem anderen Gymnasiallehrer oder wissenschaftlich interessierten Pfarrer, dem künstlerischen Leiter des städtischen Theaters oder Orchesters sein. Der Lehrer wird nach innen und außen eine neue Lebendigkeit in das Dasein der Gemeinde bringen.
Wir brauchen diese neue Lebendigkeit. Die Hoffnungsfreude, mit der weite Kreise unter uns bei Kriegsausbruch eine neue Zeit für die deutsche Judenheit angebrochen sahen, ist erloschen. Es ist vom ernsthaft jüdischen Standpunkt aus ein Glück. Große Wandlungen dürfen dem Tüchtigen nicht als Geschenke von außen und oben in den Schoß fallen; die Zeit darf ihm nichts bringen, wofür er sich nicht selbst reif gemacht hat. Jene äußere Gleichberechtigung, auf die man hoffte, wäre ein solches Geschenk gewesen. Wir hätten als Einzelne erreicht, was der Gemeinschaft versagt geblieben wäre; im Grunde also der deutsche Zustand wie er schon vorher galt; mit dem einzigen Unterschied, daß, was früher wenigen Einzelnen zukam, jetzt von vielen, ja vielleicht den meisten erreicht worden wäre. Aber viele Einzelne, ja selbst die Gesamtheit der Einzelnen sind noch nicht die Gemeinschaft. Sie ist vielleicht in manchen Augenblicken bei den Wenigen besser aufgehoben als bei den Vielen. Ihr zunächst gilt es, die „Gleichberechtigung“ zu erkämpfen, und nicht zu erkämpfen, sondern zu erarbeiten. Ist erst eine solche Gleichberechtigung der Gemeinschaft, des Judentums, von uns erreicht, dann wird die Gleichberechtigung der Einzelnen, der Judenheit, von selber nachfolgen. Der Weg aber zur Gleichberechtigung der Gemeinschaft führt über die Organisation. Sie ist der Punkt, wo die bewußte Arbeit des Einzelnen den Pfad zum Geist der Gemeinschaft findet.
Als man uns in der ersten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts in Deutschland zur Teilnahme am gemeinsamen Leben des Volks und Staats heranzuziehen begann, da geschah es so, daß man für den Einzelnen durch Gesetzesparagraphen die Schranken niederzulegen suchte, die ihn bisher noch von diesem Leben fernhielten. Daß der zu emanzipierende Einzelne selber auch seinerseits von Schranken eines eigenen gemeinsamen Lebens umfangen war, das galt bestenfalls für eine unbedeutende Erschwerung. Würde man ihm nur die Tore der großen politischen Volksgemeinschaft öffnen, so würden die Ketten, die an den Eingängen der alten Geist- und Blutgemeinschaft ausgespannt waren, schon von selber fallen. Nur die Reaktionäre meinten es damals anders. Die Judengesetzgebung, die Friedrich Wilhelm IV. plante, dachte zwar ebenfalls in ihrer Weise die Juden am Staat zu beteiligen, aber nicht auf Grund des den Einzelnen eröffneten Rechts, sondern auf Grund einer körperschaftlichen Verfassung der „Judenschaft“. Das lag im Rahmen der gesamten auf Belebung der körperschaftlichen Gliederung des Volks gerichteten Staatsansicht dieser Kreise; doch gerade gegenüber den Juden und gegenüber dem Wege im Sinne einzelpersönlicher Bildung, den sie in den letzten Jahrzehnten aus eigenem Antrieb eingeschlagen hatten, sah der Pferdefuß allgemein zurückschraubender Absichten zu deutlich unter dem staatsphilosophischen Gedankentalar heraus. So sind jene Pläne damals erfolglos geblieben. Auch heute wird sie kein Verständiger unter uns wiederbelebt sehen wollen. Gleichwohl hat sich die Zeit auch von jenen schlechthin einzelrechtlichen Vorstellungen, die damals wenigstens auf dem Papier siegten, wieder abgekehrt. Wir haben gelernt, daß mit der paragraphierten Berechtigung der Einzelnen wenig gewonnen ist. Solange man den Einzelnen zwar unter Umständen als Einzelnen gern mitwirken läßt, aber doch immer nur, indem man gegenüber der Tatsache seines Zugehörens zur Gemeinschaft nachsichtig ein Auge zudrückt, solange ist alles, was der Einzelne erreicht, selbst wenn er die Zugehörigkeit zu uns nicht verleugnet, höchstens materiell gesehen ein Nutzen für die Gemeinschaft, ideell gesehen aber nicht bloß kein Nutzen, sondern geradezu ein Schade. Die Gemeinschaft selber muß in eindrucksvoller Zusammenfassung nach innen wirksam, nach außen sichtbar werden, damit sie nicht trotz unserer persönlichen Anhänglichkeit, sowie wir heraustreten, uns von der Außenwelt als ein bestenfalls harmloser Makel nachgesehen wird. Nicht die Judenschaft zwar, wie die Reaktionäre der Mitte des 19. Jahrhunderts wollten, gilt es organisch zu verkörpern, aber das Judentum. Nicht judenschaftliche, sondern jüdischgeistige Organisationen gilt es zu schaffen. Der Geist des Judentums verlangt nach eigenen Heim- und Pflegestätten. Das jüdische Bildungsproblem auf allen Stufen und in allen Formen ist die jüdische Lebensfrage des Augenblicks.
Des Augenblicks. Denn wahrhaftig: die Zeit zum Handeln ist gekommen – „Zeit ists zu handeln für den Herrn – sie zernichten deine Lehre.“ (Ps. 119, 126).