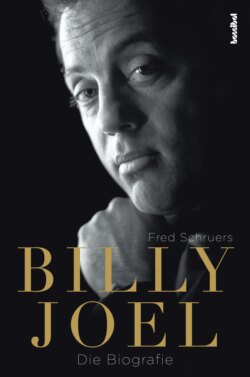Читать книгу Billy Joel - Fred Schruers - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAuch wenn Howard Joel als Vater wenig präsent war, eines hatte er seinem Sohn doch mitgegeben: die Liebe zur Musik. „Wir hatten ein Klavier im Haus, wenn auch kein besonders gutes – es war ein altes, abgestoßenes Lester, ein schreckliches Ding. Jede fünfte Taste war kaputt. Aber trotzdem ‚spielte‘ ich als kleiner Junge jeden Tag darauf. Ganz simple Sachen, sowas wie wamm, wamm, wamm, das ist der Donner, und plink, plink, plink, das ist der Blitz. Und nachdem ich das ein paar Jahre lang gemacht hatte, sagte meine Mutter irgendwann: Das reicht jetzt mit dem Sturmlied. Du musst lernen, wie man richtig spielt. Daraufhin schleppte sie mich zu einer Klavierlehrerin in unserer Straße, Frances Neiman.“ Es folgten zwölf lange Jahre Klavierunterricht, wobei es wohl vor allem Roz zu verdanken war, dass er in dieser Zeit bei der Stange blieb.
„Manchmal war es Quälerei, aber das, was ich damals lernte, gab mir eine Basis, auf die ich an jedem Tag meiner musikalischen Karriere zurückgreifen konnte. Nach einigen Stunden bei Miss Frances gelang es mir, die ersten Stücke nach Gehör zu erarbeiten, und das war der Augenblick, indem ich mich wirklich für Musik zu begeistern begann. Es ging nicht so sehr darum, den kleinen Fliegendreck der Mozartnoten entziffern zu können; das Entscheidende war, sich diese Sachen im Kopf zu erschließen. Das ist absolut großartig, dachte ich damals. Es hatte etwas von Zauberei, eine Art Magie, mit der man Klänge manipulierte. Ich war nur ein mickriger Typ und nicht besonders gewandt im Umgang mit anderen Menschen, aber wenn es in meiner Nähe ein Klavier gab, dann setzte ich mich dort hin und spielte. Und das verzauberte die Leute. Als ich älter wurde und mich für Mädchen zu interessieren begann, da merkte ich, dass ein Klavier besser war als ein Sportwagen. Wenn ich spielte und zwischendurch hochguckte, stellte ich fest: Wow, da steht ein Mädchen! Und wenn ich dann weiterspielte und wieder hochguckte: Mann, da steht ja noch ein Mädchen! Das fand ich echt super.“
Wie viele Jugendliche in den späten Fünfzigerjahren war Billy fasziniert von Elvis, und seine erste Rock’n’Roll-Darbietung erwies sich als Offenbarung. „Ich war in der dritten Klasse und gab mein Bestes, Elvis nachzumachen – ich spielte zur allgemeinen Unterhaltung in der Mittagspause ‚Hound Dog‘, und die Mädchen aus der Vierten fingen an zu kreischen. Da wurde mir klar, welche Macht in dieser Art von Musik steckte. Ich, der Drittklässler, bringe die Mädchen aus der Vierten zum Kreischen? Dabei waren mir Mädchen damals noch ziemlich egal. Der Auftritt war zu Ende, als ich anfing, mit den Hüften zu wackeln, und man mich von der Bühne zog. In der dritten Klasse hat man zwar noch nicht einmal Hüften, aber die Lehrer rasteten alle völlig aus. Ich dachte, es sei die coolste Sache der Welt. Mann, hatte ich etwa was angestellt? Das wäre doch eine echt coole Sache. Rockstar, hmmm.“
Während Eltern sich heutzutage darum sorgen, dass ihre Kinder zu lange auf irgendwelche Bildschirme starren, dann war das, wie Billy sagt, bei ihm zu Hause kein Problem: „Unser Fernseher ging kaputt, als ich zwei Jahre alt war“, berichtet er; in vielen Levitt-Häusern war ein Fernseher mit 12-Zoll-Diagonale in die Treppenwand eingebaut. „Und danach hatte ich bis Mitte zwanzig gar keinen mehr. Ich las viel und ich hörte viel Radio, und meine Mutter legte auf unserem kleinen Magnavox-Plattenspieler Schallplatten auf. Wir hatten keine große Musikbibliothek, aber es war jedes Genre vertreten – Musicals, Klassik, Jazz, Country, Folk, Oper, Rock, dazu noch alles an Musik, was mein Vater mitbrachte. Die Radiosender aus New York City spielten außerdem viel Pop. Von daher kam ich früh mit den verschiedensten Stilrichtungen in Kontakt, und mir gefiel alles.“
Billy war nicht der erste, der trotz klassischer Musikausbildung die Rockmusik für sich entdeckte. „Als die britischen Bands die USA eroberten, definierte ich meine musikalische Persönlichkeit eher abseits der klassischen Musik. Nach dem Motto der Beatles: Roll over Beethoven, and tell Tchaikovsky the news.“
1966 trat John Lennon mit der harmlosen Bemerkung, die Beatles seien beliebter als Jesus, eine echte Kontroverse los. Aber es erinnern sich nur noch wenige daran, dass er schon früher einmal gesagt hatte, dass Elvis seiner Meinung nach wichtiger sei als Religion – damals entschuldigte er sich dafür, dass er neben Elvis noch anderen Götter huldigte wie Little Richard, dessen Single „Tutti Frutti“ gerade mächtig eingeschlagen hatte. Wie viele andere amerikanische Rockmusiker entdeckte auch Billy die schwarze Musik zum Teil dank der jungen Briten, die auf ihren Alben neben den poppigen Charthits auch stets einige Titel unterbrachten, die von ihrer Liebe zum amerikanischen Rhythm & Blues kündeten, beispielsweise Songs von Chuck Berry (bei denen Billy besonders von Johnnie Johnsons energiegeladenem Klavier beeindruckt war) oder „Twist And Shout“ von den Isley Brothers.
Im Oktober 1963 bekam der 14-jährige Billy einen ersten Eindruck davon, was Soul Music eigentlich war: Zusammen mit einem Freund fuhr er nach Harlem, um sich James Brown anzusehen, der damals eine Reihe von Gigs im Apollo Theater absolvierte; bei einem davon entstand eine fulminante Live-Aufnahme, die der „Godfather of Soul“ selbst finanzierte, nachdem sein Label kein Interesse an einer Veröffentlichung gezeigt hatte. „Schon allein seine Beinarbeit war phänomenal“, erinnert sich Billy, „und dann noch dieser großartig raue, soulige Gesang, seine Wildheit, die sich mit der Präzision der Band hervorragend verband, und die ganze Show, die dieser Kerl ablieferte – das alles machte einen unglaublichen Eindruck auf mich.“
Einen Monat später folgte dann ein Ereignis, das die ganze Welt bewegte: die Ermordung John F. Kennedys. „Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich vom Drugstore an der Ecke, der auch Fernseher verlieh, mit so einem Ding nach Hause ging; man bekam dafür einen Wagen mit, dessen vier wacklige Räder über die Meeting Lane eierten. Wir hatten das Gerät dann kaum in unserem Wohnzimmer angeschlossen, da sahen wir auch schon, wie Jack Ruby Lee Harvey Oswald erschoss.“
Es war ein Augenblick, der ihn viele Jahre später immer noch bewegte, wie in seinem 1989 veröffentlichten Song „We Didn’t Start The Fire“ zu hören ist, in dessen Mitte er brüllt: „J.F.K blown away, what else do I have to say?“
Doch in jener Zeit, in der die Ermordung des Präsidenten die Schlagzeilen beherrschte, war auch immer mehr Popmusik im Radio zu hören – Ray Charles mit „Busted“, die Kingsmen mit „Louie Louie“, die ernsthafte, kalifornische Naivität des Beach-Boys-Songs „Be True To Your School“, Dions Herzschmerz-Hymnen „Donna The Prima Donna“ und „Drip Drop“, oder auch die Ronettes mit „Be My Baby“, Phil Spectors erstem großen Schritt zum scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg auf den Pop-Olymp.
Als im folgenden Jahr die britischen Bands ihren Siegeszug in den USA antraten, hatte Billy eines bereits gründlich verinnerlicht: „Mehr noch als Elvis machte diese magische Ära im Radio es einem aufstrebenden Rock-Pianisten wie mir deutlich, wie sehr Little Richard mit der Einstellung aufgeräumt hatte, dass es sich beim Klavier in der Rockmusik um ein zweitrangiges, statisches Instrument handelte. Und wenn man sich Jerry Lee Lewis und Fats Domino ansah, dann war offenkundig, dass die rebellische Energie des Rock auch von Typen repräsentiert wurde, die auf den Tasten herumhämmerten. Denn letztlich ist es doch ein Rhythmusinstrument – man schlägt die Tasten, man drischt wirklich darauf ein. Es ist dazu gemacht, um hart gespielt zu werden, genauso wie das Schlagzeug.“
Es waren jedoch nicht nur diese bahnbrechenden Pianisten, die Billy bewegten, sondern auch Sänger wie Ray Charles, der auf etwas gesetztere Weise Soul mit Country mischte und Hits wie „Georgia On My Mind“ und „Hit The Road Jack“ (1960), „I Can’t Stop Loving You“ (1962) und „Crying Time“ (1965) verbuchen konnte. „Als ich ihn zum ersten Mal hörte, wollte ich so singen wie er“, sagt Billy. „Bei Ray passiert etwas mit den Stimmbändern, das dem Sound gleicht, den ein Leslie-Tone-Verstärker macht, wenn man ihn an eine Hammond-B3-Orgel anschließt: ein leichtes Schwingen, das fast wie ein Knurren wirkt, aber immer melodisch klingt.“ Jahre später, als der Rolling Stone die 100 größten Sänger aller Zeiten kürte und Ray Charles dabei auf Platz 2 landete, nur noch übertroffen von Aretha Franklin, schrieb Billy über die einzigartige Stimme der Soul-Legende: „Es war unüberhörbar, dass das, was er tat, für ihn ein riesiger Kick war, und seine Freude war ansteckend. Bei ihm wurde aus Grollen, Aufschreien, Stöhnen, Rufen richtige Musik. Ray brachte so viele verschiedene Laute hervor, huh-hey!, als sei er selbst gerade völlig überwältigt von dem Klang, den er produziert hatte. Er sang eine Phrase, und dann antwortete er selbst darauf: Oh, all right!
Der Soul, der aus seiner Musik hervorblitzte, war weniger leicht zu erfassen. Ich saß einfach nur da und fragte mich fasziniert: Wie zum Teufel macht er das? Lag es daran, dass er sich selbst immer so sehr aufputschte? War es das Leben als Schwarzer, die Erfahrungen, die man im Süden der USA machte? Lag es an der Kirche? Oder an den Drogen? An dem harten Leben? Ich dachte einfach nur: Mann, so will ich mich auch anhören.“
Ray Charles war das genaue Gegenteil vom Leben in Levittown, und mit der 1962 erschienenen LP Modern Sounds In Country And Western Music entdeckte Billy „einen Schwarzen, der die weißeste Musik auf die schwärzeste Weise spielte, und das zu einer Zeit, als wegen der Bürgerrechtsbewegung gerade die Hölle losbrach. Wenn er ‚You Don’t Know Me‘ sang, dachte ich: Der singt nicht nur diesen Text. Er sagt: You don’t know me, get to know me – du kennst mich nicht, lerne mich kennen. Er demonstriert seine eigene Menschlichkeit. Und das so klar erkennbar spontan.“ Als er schließlich 1986 Gelegenheit bekam, mit Ray zu arbeiten, war das für Billy „geradezu ein religiöser Moment. Er war der Priester, ich war die Gemeinde“, schrieb er später.
„Dass er und ich eines Tages ein Duett einspielen würden“, sagt Billy, „und dann noch einen Song, den ich für ihn geschrieben hatte, ‚Baby Grand‘ – das hätte ich mir damals in den Sechzigern nicht einmal ansatzweise vorstellen können. Auch glaubte ich nie, dass ich eine gute Stimme habe. Da kann ich ganz objektiv sein. Heute gefällt sie mir besser, da sie in den unteren Bereichen inzwischen etwas breiter geworden ist, aber für mich ist sie immer noch nicht mit den Stimmen zu vergleichen, die ich in meiner Jugend gehört habe, und die einen auf natürliche Weise packen. Wenn ich singe, kann ich den Ton halten. Ich kann knurren, mehr Rock oder mehr Soul in meine Stimme legen, aber ohne all das, wenn ich ganz natürlich singe, klinge ich wie ein Kind beim Gottesdienst.
Allerdings war ich ja nicht der einzige, der auf der Bühne vor sich hin zirpte und seine eigene Stimme blass fand. Wir saßen den Titanen zu Füßen, als wir unsere ersten musikalischen Schritte taten. Und dann kamen plötzlich diese Typen, die alles viel zugänglicher erscheinen ließen: Die Beatles nahmen sich den klassischen amerikanischen Rock’n’Roll und R&B und machten sich diese Musik zu eigen.
John Lennon war sich der Musikgeschichte völlig bewusst. Er hatte alles ganz genau studiert und schon ganz früh erklärt, dass man in einem Pop-Song von zwei oder drei Minuten sehr viel machen kann und dass es sich um eine eigene Kunstform handelt. Das denke ich auch – ich glaube, man muss eine Menge Unschuld, Ehrgeiz und auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben, um sagen zu können: Das können wir alles in drei Minuten unterbringen.“
Eine Erklärung dafür, warum Billy nach dem 1993 erschienenen Album River Of Dreams mit dem Songschreiben aufhörte, findet sich vielleicht in diesen Überlegungen, in denen er über das unweigerliche Schwinden der jugendlichen Unbekümmertheit spricht, die seinen Werken damals ihre Energie verlieh: „Zuerst verliert man die Unschuld – so war es jedenfalls bei mir – und dann das Selbstvertrauen.“ Nur wenige Musiker haben aus dem Ungestüm der frühen Jahre so viel herausgeholt wie er: Nachdem er in den Sechzigern mit dem Songschreiben begonnen hatte, blieb er immerhin 30 Jahre lang enorm produktiv. Heute sagt er: „Solche Songs jetzt zu schreiben, in meinem Alter, das könnte ich wahrscheinlich nicht einmal versuchen. Damals wusste ich es eben nicht besser.“
Das Arbeitszimmer in Billy Joels Haus auf Centre Island wirkt mit seinen Mahagonimöbeln, den Seekarten und dem weiten Blick aufs Wasser, das sein Grundstück umgibt, ein wenig wie ein einladender Raum in einem Herrenclub. Die hohen Bücherregale reichen bis zur Decke; hier stapeln sich Geschichtsbücher, Romane und Biografien – Bücher, mit denen er sich in denen Jahren, in denen er seine Bildung im Selbststudium vertiefte, viel beschäftigt hat. Mit seinem Wissen über die Geschichte Amerikas und der Welt, vor allem in militärischer Hinsicht, können wohl nur Historiker mithalten. Dabei ist es ihm nicht im Geringsten peinlich, darüber zu sprechen, dass er die Highschool vorzeitig abbrach und nie an ein Studium gedacht hat: „In der Junior High redeten plötzlich alle davon, auf welches College sie später gehen wollten. Mich reizte daran überhaupt nichts. Seit meinem 14. Lebensjahr drehte sich bei mir alles um die Musik. Das werde ich einmal machen. Ich gehe nicht aufs College. Das ist sinnlos. Tatsächlich hatte ich überhaupt keinen akademischen Ehrgeiz, obwohl ich schon gern die Abschlussurkunde von der Highschool gehabt hätte – meiner Mom zuliebe.“
1967 besuchten mehr als tausend Schüler die Hicksville High School, aber die Gruppe derer, zu denen sich Billy am ehesten hingezogen fühlte, der Rockertypen mit Schmalztolle, war in seiner Abschlussklasse bereits erheblich geschrumpft. In dieser präpsychedelischen Zeit interessierten sich immer mehr Schüler für Folk und führten ernsthafte Gespräche über Kunst; sie trugen Rollkragenpullover, Brillen mit schwarzem Rand und Collegejacken. „Es wurde auch immer mehr Pot geraucht“, erinnert sich Billy, „aber ich wollte das nicht. Wahrscheinlich hatte ich Schiss. Die hatte ich nicht, wenn ich mit den Sportskanonen rumhing und Bier trank, oder mit den kaputten Typen, die Kleber schnüffelten und sich dazu Limo oder Billigwein reinschütteten. Aber trotzdem hatte ich mich, als ich die Junior High hinter mir ließ, vom knallharten Rocker schon etwas zum Hippie entwickelt, weil ich in einer Band war. Ich ließ mir die Haare lang wachsen und trug Jeans. Aber ich legte auch Wert auf gute Kontakte zu denen, die aufs College wollten, weil da viele süße Mädchen dabei waren – blonde, sportliche Mädels, die wie Surferinnen aussahen und hübsche Kurven hatten. Irgendwie kam ich mit allen gut zurecht.“
Dennoch gab es natürlich die üblichen Teenager-Krisen. Das Mädchen Virginia, das in „Only The Good Die Young“, seiner Hymne an die junge Liebe, namentlich genannt wird, blieb in Wirklichkeit unerreichbar: „Unsere Liebe stellte ich mir nur vor, wir hatten nie etwas mit einander. Sie war meine Traumfreundin.“ Also sah Billy sich anderweitig um. In der achten Klasse war er „schwer verliebt“ in Carol Mulally, „ein wunderschönes Geschöpf“, bis er herausfand, dass sie ihrer Freundin Dina einen Zettel geschrieben hatte, auf dem stand: „Dieser eklige Typ hat mich den ganzen Tag angestarrt.“ Danach kam er auf die Masche, sich mit „Mauerblümchen“ zu treffen, die er immer noch namentlich aufzählen kann – Cathy, Lorraine und Glenna, die Glenna Glide genannt wurde, „weil sie immer so ging, als würde sie auf Rollschuhen gleiten“. Meistens war er nur kurz entflammt, ein Zustand, den er selbst als „shiksa madness“ beschreibt, nach dem leicht abfälligen jüdischen Ausdruck für nicht-jüdische Mädchen, und schnell wieder auf der Suche nach der nächsten. „Ich konzentrierte mich darauf, die gerade erst erblühenden Schönheiten zu entdecken, die noch niemandem aufgefallen waren. Die anderen Jungs fragten mich dann immer: Wo hast du die denn aufgetrieben? Ich gucke nicht zuerst nach dem Busen – ich verliebe mich in Gesichter.“
Und ein Gesicht war offenbar dabei, das alle anderen in den Schatten stellte. „Das Mädchen, das auf mich den größten Eindruck machte, hieß Patti Lee Berridge und wohnte ein paar Meilen entfernt in Bethpage. Wir waren uns 1968 begegnet, als sie in einer Bar in Plainville, dem Mr. House, im Publikum saß, während ich mit meiner Band The Hassles auf der Bühne stand. Sie war so alt wie ich, 19, und sah aus wie Ann-Margret.“ Billy hatte sie kaum übersehen können: Sie war ein Wasserfall aus rotem Haar, hatte ein Gesicht, das halb den perfekten Zügen eines Fotomodells und halb der Natürlichkeit eines Mädchens von Nebenan entsprach, und in ihren Augen konnte man deutlich den Hunger nach Leben erkennen.
Es ist ein beliebter Showbiz-Trick, sich jemanden im Publikum auszugucken, für den man singt, und an jenem Abend machte Patti Lee es ihm leicht. „Patti Lee war das Mädchen für mich, ein paar Jahre lang – solange, bis sie aufs College ging und ich meine Beziehung mit Elizabeth begann.“ Noch viele Jahre später gab Billy unumwunden zu, dass sie ihn gewissermaßen in ihren Bann geschlagen hatte: „Vielleicht war sie nicht die eine große Liebe, aber ganz sicher die erste, an die ich immer noch zurückdachte, selbst später, als ich schon verheiratet war. Ich weiß nicht, ob ich mich dieser Gedanken jetzt schäme, aber auf alle Fälle bin ich selbst gerade überrascht, dass ich das jetzt so formuliert habe.“ In „Keeping The Faith“ behauptete Billy, seine Vergangenheit habe ihm nie im Weg gestanden („My past is something that never got in my way“), aber er war nicht immer so großmäulig wie der Erzähler in jenem Song von 1983:
I thought I was the Duke of Earl
When I made it with a red-haired girl
In a Chevrolet
Patti Lee Berridge sagt dazu: „Ja, ich glaube, das handelt von mir – ich war wohl in meinem letzten High-School-Jahr, als wir ein Paar wurden.“ An das erste Mal, dass sie sich beide ansahen, erinnert sie sich noch genauso gut wie Billy: „Es war ein richtig intensiver Flirt. Er hatte gleich etwas für mich übrig und fing schon auf der Bühne an, mich anzusprechen – nicht verbal, sondern mit Gesten. Das war trotzdem wie ein Gespräch; ich wusste, dass er mit mir redet, auch wenn das sonst niemand mitbekam.“
Patti sollte in Billys Leben zehn Jahre lang eine große Rolle spielen. Ihre junge Liebe entfaltete sich unter den wachsamen Augen von Schäferhund-Labrador-Mix Whitey und Roz’ Katze Cupcake, wenn sie sich auf dem Wohnzimmersofa der Joels gegenseitig Knutschflecke machten (einmal musste Patti Lee sich sogar schnell unter der Couch verstecken, als Roz unerwartet nach Hause kam), aber sie fand schließlich ein Ende, als Patti beschloss, sich an einem weiter entfernten College einzuschreiben.
„Als wir Schluss machten“, berichtet Billy, „sagte ich zu ihr: Unsere Beziehung bedeutet mir sehr viel. Immerhin haben wir miteinander geschlafen, Patti Lee. Das war 1967 oder so. Und sie sagte nur: Ja und? In unserer Beziehung war sie der Mann, ich war das Mädchen. Sie fragte: Na und, was heißt das schon? Dass eine Frau so etwas zu einem Mann sagte, das war wie ein Eimer kaltes Wasser ins Gesicht. Sie war völlig mit sich im Reinen, was ihre Sexualität, ihren Intellekt und ihre Weiblichkeit betraf, noch bevor diese Themen politisch so intensiv diskutiert wurden.“
„Ich ging aufs College“, erinnert sich Patti Lee, „und Billy war sehr … Er fragte mich, ob ich ihn heiraten wollte. Und ich sagte, machst du Witze? Ich bin doch noch viel zu jung dafür.“
Patti Lee besuchte schließlich ein College in Buffalo, weiter nördlich im Bundesstaat New York, kehrte dann nach Long Island zurück, um eine Ausbildung zur Chiropraktikerin zu machen und zog später nach Kalifornien, wo sie viel Zeit mit Billy und seiner ersten Frau Elizabeth Weber verbrachte (mit der sie zunächst gut befreundet war, sich später aber zerstritt). Sie blieb eine feste – und rein platonische – Größe in Billys Leben, aber auch eine bittersüße Erinnerung daran, dass sie in romantischer Hinsicht „doch nie ganz zueinander fanden. Immer Freunde, aber einen Schritt voneinander entfernt.“
Für Billy war diese Trennung ein recht schwerer Schlag und eine Lektion fürs Leben. In Eric Rohmers Film Claires Knie zieht die etwas verwirrte Hauptfigur Jerome seine eigenen Folgerungen daraus, dass er so sehr von der bezaubernden jungen Titelheldin besessen ist: „Das Durcheinander, das sie in mir auslöst, gibt mir ein gewisses Recht an ihr.“ So wie Jerome sich schließlich damit zufrieden geben muss, Claires faszinierendes Knie nur einmal kurz berühren zu dürfen, lernte auch Billy, dass Verliebtheit, wie tief sie auch gehen mag, erwidert werden muss. Patti hatte ihn abgewiesen, und das war der erste, aber auch der wichtigste Punkt, der sie voneinander trennte. Er erklärte später: „Daraus habe ich sehr viel gelernt. Oh, sie war über Jahre meine Muse. Es gibt Songs, bei denen ich sagen könnte: Ja, da geht es vermutlich um Elizabeth – aber wahrscheinlich noch mehr um Patti Lee.“
Die wahre Tiefe ihrer Beziehung enthüllt vielleicht ein anderes Gespräch der beiden, an dem eine weitere Hochzeit Billys scheiterte. „Billy und ich waren einmal zusammen essen“, sagt Patti Lee, „und er erzählte von seiner damaligen Freundin – ich glaube, es war Carolyn [Beegan, mit der Billy von 2000 bis 2002 zusammen war]. Er sagte: Ich bin ziemlich in sie verliebt. Und ich erwiderte: Billy, eins will ich dir sagen. Sie hat vielleicht dein Herz erobert, aber ich habe deine Seele. Und er meinte: Wow, das sollte ich mir aufschreiben.
Damals sagte ich ihm: Sie ist nicht die Richtige für dich. Wahrscheinlich war ich mit ein Grund, weshalb er mit ihr Schluss machte. Ich fragte ihn: Willst du sie heiraten? Und er sagte: Nein. Und dann meinte ich: Wenn du sie jetzt an dich bindest, opfert sie dir einige ihrer besten Jahre. Das solltest du nicht tun. Wenn du sie heiraten willst, ist das was anderes. Aber wenn nicht, dann lass sie gehen.“
„Sie wollte nicht etwa eigene Besitzansprüche anmelden“, sagt Billy. „Sie hat mir das ganz liebevoll gesagt.“ Patti Lee gab ihm einen ausgesprochen anspruchsvollen Einführungskurs, was Frauen betraf: „Fühlen sie dasselbe wie wir? Sie brachte mir bei, dass Frauen nicht nur genauso viel empfinden, sondern uns in einiger Hinsicht übertreffen, und dass sie von uns nicht abhängig sind. Wow. Aber wir haben doch mit einander geschlafen, Patti. – Ja? Na und? Komm drüber weg, du Weichei.
Ich bin ja wahrscheinlich bekannt für meine Liebeslieder, diese Balladen, diese Herz-Schmerz-Nummern. Und deshalb sollte ich wohl mal erklären, wo dieser ganze Scheiß herkommt – ‚An Innocent Man‘, She’s Got A Way‘, ‚Just The Way You Are‘ oder ‚You’re My Home‘, von denen einige ja schon echt schmuseweich sind. Tja, das liegt eben daran, dass ich mein ganzes Leben lang immer Hals über Kopf in Frauen verliebt war.“
Zu den Lehren, die Billy in den Sechzigern zog, gehörte zwar die Erkenntnis, dass man sich zu lange in seinen Träumen verlieren konnte („you can linger too long / In your dreams“), aber es war doch eine Zeit, in der junge Liebe mit der Überschwänglichkeit des schlichten Rock’n’Roll noch eng verbunden war:
Oh, I’m going to listen to my 45s
Ain’t it wonderful to be alive
When the rock’n’roll plays, yeah
Diese Begeisterung rückte mehr und mehr in den Mittelpunkt, als Billy mit seinen ersten Bands in den Garagen der Nachbarschaft probte: „Zwar hatten wir kaum nennenswerte musikalische Fähigkeiten, aber es war eine berauschende Erfahrung, damals überhaupt in einer Rockband zu sein, in dieser aufregenden Zeit, als es mit der Rockmusik so richtig losging. Als mein High-School-Freund Jim Bosse die Band gründete, hießen wir zunächst The Echoes.“
Jim war ebenso wie Bill Zampino, ein Freund aus Billys Kindertagen, die Inspiration für jenen „James“, den Billy auf dem Album Turnstiles von 1976 besang – ein Song, der auf den UKW-Sendern der USA, die weniger auf ein reines Mainstreamprogramm abonniert waren, gern gespielt wurde und auch ein Hit in den Niederlanden war. Darin beschrieb er die unterschiedlichen Wege, die er und seine Schulkameraden eingeschlagen hatten, und wandte sich freimütig und offen an die Freunde von einst:
I went on the road
You pursued an education …
Do you like your life
Can you find release
And will you ever change
When will you write your masterpiece?
Do what’s good for you
Or you’re not good for anybody …
Billy wurde ein festes Mitglied in der Band, obwohl die anderen ihn zunächst noch gar nicht wirklich einschätzen konnten. „Ich hatte den Eindruck“, sagt Bosse, „dass er ein ziemlicher Einzelgänger war – nicht nur innerhalb der Band, sondern ganz allgemein. Aber er hatte ein ungewöhnliches inneres Selbstbewusstsein. Wir waren damals 14 oder 15. Und mit seinen Fähigkeiten als Pianist war er uns anderen meilenweit voraus. Er konnte klassische Musikstücke spielen, aber Rock’n’Roll war ja gerade erst erfunden worden, also brachten wir uns das alles selbst bei.“
Beide gehörten zur Parkway-Green-Gang, einer Gruppe von Jungen, die in der Nähe eines öffentlichen Platzes in Levittown wohnten. Wie Bosse sich erinnert, waren sie nicht gerade zahme Pfadfinder: Man hing gemeinsam herum und amüsierte sich mit Alkohol, Klebstoffschnüffeln, Vandalismus und kleinkriminellen Delikten. „Viele, die damals mit dabei waren, leben heute schon gar nicht mehr; viele starben früh an Drogen, Alkohol oder den harten Lebensumständen.“
Billy erinnert sich: „Am Anfang, als Billy Zampino noch unser Schlagzeuger war, gaben wir kleinere Gigs in der unmittelbaren Umgebung, vor allem in der Holy Family Church. Dann erzählte uns jemand von einer Band namens Echoes aus den Fünfzigern, die einen Hit mit ‚Baby Blue‘ gehabt hatte, und daher tauften wir uns schließlich – nach einer kurzen Phase als Joe & The Hydros – in The Lost Souls um, was natürlich für unseren Hauptauftrittsort, die Holy Family Church, nicht gerade optimal war.“
Die Band machte bei einem Musikwettbewerb des Staates New York mit, setzte sich mit großer Leichtigkeit in den ersten Runden durch und wurde schließlich Sieger des Bezirks Long Island. Im Oktober 1965 trat sie in der Endausscheidung im New York State Pavilion auf dem Gelände der Weltausstellung gegen drei andere Bands an und landete hinter den Rockin’ Angels aus North Woodmere auf dem zweiten Platz. Um in Clubs auftreten zu dürfen, in denen Alkohol ausgeschenkt wurde, mussten die Bandmitglieder sich ausweisen können – ein Problem, das schließlich ein Bekannter des nächsten Drummers, Dave Boglioli, für sie löste: Er hatte eine Wagenladung geklauter Brieftaschen aufgetan, in denen zwar kein Geld mehr steckte, dafür aber noch einige Führerscheine, die nun passend gemacht wurden.
Die Lost Souls fanden einen Manager namens Dick Ryan, der ihnen einen Kontakt zu Mercury Records herstellte, und nach einem Vorspieltermin unterschrieb die Gruppe dort einen Vertrag. Aber schon bald stand der nächste Namenswechsel an, weil sich herausstellte, dass es in England bereits eine Band namens Lost Souls gab. „Diesmal waren wir richtig genervt“, sagt Billy, „weil wir den Namen toll fanden. Dann kam der Boss der Plattenfirma zu uns und sagte: Ich habe einen Namen für euch, Jungs: The Commandos. Wir guckten ihn an und dachten alle dasselbe: Das ist doch scheiße. Zwar war der Widerstand gegen den Vietnamkrieg noch nicht so groß wie später, aber es war schon zu diesem Zeitpunkt abzusehen, dass man mit einem solchen Namen keinen Blumentopf würde gewinnen können. Aber wer waren wir schon, dass wir etwas dagegen hätten sagen können? Wir waren ein paar dusslige Rock’n’Roller, noch ganz jung, und diese Musikmanager hatten alle Macht, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Und so wurden wir The Commandos, obwohl wir den Namen wirklich hassten. Aber das ging nicht einmal ein Jahr, weil uns die Plattenfirma Gott sei Dank nach ein paar gefloppten Singles fallen ließ.
Daraufhin machten wir als The Lost Souls weiter. Für kurze Zeit nannten wir uns allerdings auch U.S. Male, wahrscheinlich als wenig gelungene Reminiszenz an den gleichnamigen, ziemlich hinterwäldlerischen Elvis-Song. Auch ein grässlicher Bandname.
Damals hatte ich ohnehin schon beschlossen, die Gruppe zu verlassen – dabei wusste ich noch gar nicht, dass The Hassles einen Keyboarder suchten. Die anderen Lost Souls – abgesehen von Jim Bosse, aus dem ein ziemlich guter Gitarrist wurde – machten nicht gerade den Eindruck, als ob sie es mit der Musik ernst meinten.“
Dass der Band keine große Karriere bevorstand, schon gar nicht mehr, nachdem Billy die Band verlassen hatte, erkannte auch Jim Bosse, der sich daraufhin, wie in „James“ erzählt wird, für eine ordentliche Ausbildung entschied. Er schrieb sich für zwei Jahre auf der Hofstra University ein und wechselte anschließend nach Philadelphia, wo er einen Abschluss in Optometrie machte. Obwohl seine zukünftige Frau die Wohnung gemietet hatte, die Roz in ihrem Haus in der Meeting Lane hatte abteilen lassen, um ein bisschen Geld zu verdienen, sah er Billy nur noch sehr selten. Der ging aber jetzt auch ganz andere Wege und arbeitete mit The Hassles an seiner Rock’n’Roll-Zukunft: „Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass mir damals gar nicht mehr so viele andere Möglichkeiten blieben. Wenig später erfuhr ich, dass ich meinen Abschluss an der Hicksville High School nicht bekommen würde.“
Jim stand kurz vor einer wichtigen Prüfung in Biologie, als Billy eines Tages bei ihm vorbeikam und auf dem Klavier in seiner Wohnung jene Songs spielte, die später auf seinem Album Cold Spring Harbor erscheinen würden. Bosse erinnert sich: „Ich sagte damals schon: Wow, das ist ja großartig. Und Billy meinte daraufhin: Jim, kommt doch mit ins Studio und spiel die Gitarrenparts dazu ein.“
Bosse hatte damals schon ein Jahr lang nicht mehr gespielt und hatte eine Woche später seinen Prüfungstermin. „Ich sagte: Billy, das kann ich nicht. Zum einen bin ich total eingerostet. Zum anderen – wenn ich jetzt mit dir ins Studio gehe und den Termin versäume, dann muss ich ein Semester wiederholen. Also sagte ich ihm ab. Das bedaure ich heute noch.“
Jim zog später nach Denver und sah Billy noch sporadisch, wenn der dort auf Tournee war; als Jim wieder einmal an die Ostküste kam, spielte er seinem ehemaligen Musikerkollegen ein Arrangement von „James“ vor, das er für klassische Gitarre geschrieben hatte: „Ich glaube, da fing er bereits damit an, seine eigenen Klassikstücke auszuarbeiten.“
Fand Bosse, dass der Song etwas zu hart mit ihm ins Gericht ging? „Es ist ein komplexer Titel – ich verstand den Text als Ratschlag eines alten Freundes. Billy glaubte wirklich, dass ich den falschen Weg gegangen war, vor allem nach dem Treffen damals in meiner Wohnung, als er mir seine Songs vorspielte und ich seinen Vorschlag ablehnte, als Gitarrist an der Platte mitzuwirken. Für Billy war stets die Musik das Wichtigste. Wenn er keine Musik machen könnte, würde er eingehen. Für ihn war klar, dass er nie ein anderes Ziel in seinem Leben haben würde, und von daher konnte er sich nicht vorstellen, dass ich meine Richtung so grundlegend änderte und die Musik ganz aufgab.
In ihm brannte ein viel zu heißes Feuer, und deswegen ließ er mich ganz offen wissen, was er dachte. Und natürlich ist es beim Songwriting so, dass die ursprüngliche Inspiration irgendwann hinter dem zurücktritt, was das Werk wirklich verlangt. Dann könnten die Texte schon etwas bissiger oder ein bisschen kritischer ausfallen als nötig, aber das bestimmte nicht unbedingt meine Lesart dieses Songs.“
Dennoch ist es nicht unbedingt ein Titel, den man für die Berufsberatung an der Highschool auswählen würde. „Klar“, meint Bosse, „will man etwa einen Typen dafür kritisieren, dass er Arzt geworden ist? Aber das ist nun einmal Billys Sicht der Dinge. Er ist ein Beispiel für den amerikanischen Traum – vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber zu seinen eigenen Bedingungen.“
1966, in seinem vorletzten Jahr an der Hicksville High, füllte Billy wie der Rest seiner Klasse einen Fragebogen mit „freien Assoziationen“ aus. Darauf waren 40 Begriffe genannt, zu denen die Schüler niederschreiben sollten, was ihnen als erstes einfiel. Einige der Dinge, die Billy dabei nannte, sind in der Tat sehr aufschlussreich:
Ich mag … gute Musik, New York City, hübsche Mädchen, chinesisches Essen
Ich hasse … laute, verlogene, voreingenommene Menschen
Der beste … Sänger in der Popmusik war Nat King Cole
Ich habe ein Problem damit … Dinge ernst zu nehmen
Ich möchte gerne wissen … warum Neger verfolgt werden
Eine Mutter … ist unverzichtbar
Ich brauche … eine große Portion Selbstvertrauen
Ein Bruder … ist etwas, was ich nie hatte
Mein Vater … ging weg, als ich noch klein war
„Wahrscheinlich höre ich mich an wie ein 16-Jähriger kurz vor einer klinischen Depression“, sagt Billy heute, „aber in meiner Kindheit war auch nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und damals reifte in mir bereits der Entschluss, dass ich das werden wollte, was David Copperfield ‚der Held in meinem eigenen Leben‘ nennt. Weil ich nämlich nicht das Gefühl hatte, dass sich jemand anders darum riss, diese Rolle zu übernehmen.“
Jungen wie Billy, die nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden waren, suchten sich ihre Vorbilder nicht unter den erfolgreichen Karrieristen Amerikas, sondern unter den harten Kerlen aus der Arbeiterklasse. In Billys Fall waren darunter auch einige bekannte Boxer, beispielsweise Barney Ross, der mutige Weltergewichtler, der auf der Chicagoer Maxwell Street im Judenghetto aufgewachsen war und zum Symbol für die Zähigkeit seiner ethnischen Gruppe wurde. Bekannt war er vor allem für seine Unverwüstlichkeit: Er gewann 74 seiner 81 Boxkämpfe, und im Zweiten Weltkrieg erhielt er für seinen Einsatz bei den Kämpfen um Guadalcanal einen Orden. Allerdings kehrte er krank und verletzt zurück und wurde später schwer schmerzmittelabhängig. (Diese Sucht spielte eine große Rolle in dem biografischen Film Monkey On My Back aus dem Jahr 1957, gegen dessen Darstellung Ross entschieden vorging.)
Ein anderes Beispiel war Rocky Graziano, ein Slum-Kid aus New York, der in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs und nach mehreren Gefängnisstrafen zur Mittelgewichtslegende wurde; Paul Newman porträtierte ihn als gebrochenen Helden in dem 1956 erschienenen Film Die Hölle ist in mir. Und dann war da natürlich noch der ultimative Antiheld, Terry Malloy aus Die Faust im Nacken. Terry, gespielt von Marlon Brando, stellt schnell fest, dass es nicht nur im Boxsport Korruption gibt, sondern auch in der Justiz. Und er merkt schon bald, dass man vom Weg abkommt, wenn man nicht seinem Herzen und seiner Überzeugung folgt. Als er seinem Bruder sagt: „Du hättest auf mich aufpassen müssen, nur ein kleines bisschen, damit ich mich nicht für schnelles Geld hätte auf die Bretter schicken lassen“, da ist es für eine Umkehr schon zu spät. Er gehörte fest in die Galerie sperriger amerikanischer Helden, die Billys Generation durch Mundpropaganda entdeckte.
Bei dem Assoziationsspiel auf der Highschool ging es so weiter:
Mir tut leid … dass ich mich mit den falschen Leuten eingelassen habe
Das einzige Problem ist … was passiert ist, ist passiert
Menschen … sind entweder das Glück oder der Untergang im Leben
Die meiste Angst habe ich davor … jemandem das Leben zu zerstören
Ich wünschte … ich hätte eine Million Dollar
Meine größte Sorge ist … was meine Familie von mir hält
Ich leide … wenn meine Familie auf mich sauer ist
Ich habe es nicht geschafft … in den Golden-Gloves-Wettkampf zu kommen, wegen meines Handgelenks
Zwar war er tagsüber ständig müde, weil er bis spät in die Nacht mit Bands unterwegs war, aber dennoch versuchte Billy, ein bisschen zu lernen und sich bis zum Ende seiner Schulzeit 1967 durchzubeißen. Eine Woche vor dem Abschluss jedoch ließ man ihn wissen, dass er nicht genug Punkte gesammelt hatte und einen Aufbaukurs über die Sommerferien belegen müsste, um sein Zeugnis zu erhalten.
Das kam jedoch für ihn nicht infrage. „Ich war 18, ich spielte schon vier Jahre in Bands und wusste genau, was ich wollte. Und das war ganz klar: Ich will Musiker werden. Und ich will nicht noch länger die Schulbank drücken. Ich hatte das Gefühl, genug zu wissen. Schließlich hatte ich mir selbst so allerlei beigebracht, alles im Selbststudium. Weil wir ja keinen Fernseher hatten, las ich den ganzen Tag – Bücher über Geschichte, Naturwissenschaften, Literatur. Wenn ich nichts anderes hatte, sogar Schulbücher. Während meiner Kindheit ging meine Mutter viel in die Bibliothek und brachte ganze Bücherstapel mit nach Hause. Bücher waren für mich wie Süßigkeiten. Es mag sich arrogant anhören, aber ich wusste mehr als manche Lehrer. Und die Kids, die ihren Abschluss machten – klar, die hatten ihre Punkte, aber meiner Meinung nach waren sie nicht wirklich klug; sie wussten nur, wie man Klassenarbeiten besteht. Von daher war ich innerlich eigentlich schon lange ausgestiegen, noch bevor ich erfuhr, dass ich keinen Abschluss machen durfte.“
Billy hegte dennoch gemischte Gefühle, als er sich gegen den Aufbaukurs entschied, weil er wusste, wie schwer das für seine Mutter sein würde. Sie wusste, dass er intelligent war, und sie wollte, dass er aufs College ging. Kein Schulabschluss, das war in der Mittelklasse von Hicksville ein Unding. Sie machte sich Sorgen um seine Zukunft.
„Ich wusste, dass es ihr wehtun würde“, sagt Billy, „und sie hatte es sowieso schon schwer als alleinerziehende Mutter. Sie bekam keine guten Jobs. Wir waren die arme Familie in unserer Straße. Aber mir war das scheißegal. Ich erklärte damals: Ich gehe nicht auf die Columbia University, ich gehe zu Columbia Records. Ich brauche das alles nicht mehr. Aufbaukurse? Nicht einen Tag länger werde ich in dieser Strafanstalt zubringen, weil ich sie hasse.“
Seit Billy zu einer Band gestoßen war, die regelmäßig Auftritte absolvierte, war ihm die Richtung seines Lebens klar geworden: „Ich wusste, dass ich Musiker werden würde. Zwar hatte ich noch keine genaue Vorstellung davon, wie ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten würde, ob als Komponist, Live- oder Studiomusiker oder Teil einer Band, aber irgendetwas davon würde es sein.
Einmal, auf Tournee 1986, saß ich nachts in einem Hotelzimmer und schrieb spontan an meine Mom – ich sagte ihr, wieviel mir ihre Loyalität, ihre Hartnäckigkeit und Inspiration bedeutet hatte. Einige Tage später kam der erste von zwei Briefen, in denen sie mir, bewegt von ähnlichen Gefühlen, antwortete. Ich war sehr berührt.“
„Gott“, schrieb Roz, „ich war so gern deine Mutter. Ich hatte so ein Glück. In meinem Haus lebte ein echter Sonnenstrahl.“ Weiter hieß es:
Und es war nicht viel nötig, um dich zu begeistern. Du hast dich schon über die kleinsten Dinge gefreut. Eine neue Landkarte für dein Zimmer – „Wow!“ Ein neues Karohemd – „Gee-nial!“ Bücher aus der Bibliothek – „Hey, super!“ Ein Teller Spaghetti – „Abgefahren!“ Wir hatten nie viel Geld, aber wir haben miteinander geredet, gelacht, geweint, Urlaubstage, Geburtstage, Shows, Konzerte gemeinsam verbracht, Freunde, Großväter, Großmütter und Tanten gemeinsam gefeiert. Wir waren eine Familie, die füreinander da war, in guten wie in schlechten Zeiten. Und dein Lachen und deine Musik und deine Begeisterung haben so viel Leben in dieses kleine Haus in Hicksville gebracht. Es war unser Zuhause, mit dir und Judy und mir und unseren Tieren, und das Geld der ganzen Welt hätte mir nicht so viel Freude kaufen können, wie ich sie mit diesen wunderbaren Kindern hatte. Die Stille war erdrückend, als ihr beide ausgezogen wart.
Dann erzählte sie eine Geschichte, die er schon kannte, die aber dennoch sehr bewegend war:
Habe ich dir je erzählt, wie wir zu unserem Klavier kamen? Howie wollte keine weiteren Kinder mehr. Doch dann war ich einmal „überfällig“. Er war entsetzt. Bei Gott, er war wirklich völlig durcheinander. Daraufhin sagte ich: „Weißt du was? Ich lasse beim Arzt einen Test machen. Und wenn ich nicht schwanger bin, dann kaufen wir ein gebrauchtes Klavier. Ich möchte so gern eines. Du kannst doch spielen – warum haben wir dann kein Klavier? Ich brauche echte Musik in diesem Haus.“ Ich war nicht schwanger. (Zu meinem Bedauern, denn ich liebte Kinder.) Das Klavier kostete 75 Dollar – und für den Transport von New York City mussten wir noch einmal 125 drauflegen. Was war das für ein Batzen Geld damals. Aber er beharrte auf meinem Versprechen. Und damit fing alles an. Ich war sooo glücklich über dieses Klavier. Der Lack schimmerte in so vielen verschiedenen Farben. Und weißt du noch, wie wir Reißzwecken auf die Filze gedrückt haben, damit es ein bisschen nach Honkytonk klingt? Erinnerst du dich noch an das Fireside Book Of Songs, in dem die ganzen hübschen alten Country-Songs vom Land standen? Ich frage mich, ob du dich wohl noch darauf besinnst. Das Leben war damals einfacher, kitschiger, süßer. Heute fühlt es sich alles ein bisschen grausam und kalt und irgendwie herzlos an.
Kurz bevor Roz im Juli 2014 mit 93 Jahren starb, sagte Billy: „Wir stehen heute, da meine Mutter über 90 ist, viel mehr in Kontakt als früher. Und ich möchte gerne dafür sorgen, dass sie in der Zeit, die ihr noch bleibt, nie wieder dieses Gefühl von Kälte spürt.“