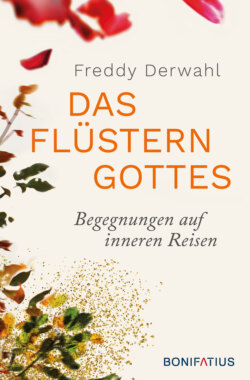Читать книгу Das Flüstern Gottes - Freddy Derwahl - Страница 10
ОглавлениеDer ehemalige Kölner Philosophie-Student Gabriel Bunge hat einen langen Lebensweg hinter sich. Wege und Umweg, doch immer wieder angefacht von der Sehnsucht: das Heilige und den Heiligen berühren. Der Protestant wechselte zur katholischen Kirche, wurde Benediktiner-Mönch in Meschede und Chevetogne, zog als Einsiedler in die Tessiner Berge und schloss sich schließlich der russischen Orthodoxie an. Ich bin sein ältester belgischer Freund.
4. Der Einsiedler im Kastanienwald
Die Begegnung mit Gabriel lag an einer Schnittstelle meines Lebens. Der Wunsch, selbst ins Kloster einzutreten, scheiterte am Druck meines Elternhauses und an meiner Unfähigkeit eines geduldigen Widerstands. Zugleich begann die Studienzeit, nach all den Bedrängnissen so etwas wie die große Freiheit. Alles sehr bewegende Jahre, den Stürmen und Verlockungen des Mai ´68 ausgesetzt, eine Zeit der Liebschaften und Freiheitsillusionen, fern von Gott, doch er nicht von mir.
Mein Freund, der Mönch Gabriel, den ich im Herbst 1963 im Garten des belgischen Benediktinerklosters Chevetogne kennengelernt hatte, übernahm in dieser Zeit die Rolle eines „Schutzengels“. Allein schon sein Name: Gabriel, das ist der Engel der Verkündigung, ein Mitwisser des Geheimnisses der Menschwerdung und sein stiller Bote. Dieser Engel ist ein konspirativer Gesandter. Das, was er zu sagen hat, kommt leise und kurz gefasst. Seine letzten Worte zur erschütternden Sache der angekündigten Schwangerschaft: „Bei Gott ist kein Ding unmöglich.“
Fast vierzig Jahre lang war Gabriels Mitleidenschaft von einer großen Diskretion und allein auf das Wesentliche konzentriert: „Lass dich von Gott wieder finden.“ Dieser Schutzengel im schwarzen Mönchsgewand waltete mit stiller Hand an den zunehmend dramatischen Standorten meines Lebens. Zugleich öffnete er in der Zeit des II. Vatikanischen Konzils den Blick auf die Schönheit der Weltkirche.
Auf den Waldwegen von Chevetogne sprach er zum ersten Mal die Begriffe „christlicher Orient“ und „Wüstenväter“ aus. Die Namen der protestantischen Theologen Karl Barth oder Dietrich Bonhoeffer wurden mir vertraut. Es war eine der Ökumene verpflichteten Kirche des Mutes und der Demut. Das Katholische war nicht der Name einer Konfession, sondern das „katholos“, das Heilige und Ganze umfassend. Gabriel liebte den Begriff „pneuma“ und nannte ihn den „Anhauch Gottes“. Seine einsamen Gebete galten einem schweigenden, einem leisen, einem flüsternden Gott.
Im frankophil ausgerichteten Kloster bildete er eine ernsthafte deutsche Ausnahme. Erst wenn das Vertrauen gesichert war, leuchtete er auf, mehr weise als wissend und bisweilen von einem lebensfrohen kölschen Humor. Dann lächelte er: „Et hätt noch emmer joot jejange …“ Er stammte aus einem wohlhabenden protestantischen Elternhaus. Für die Konversion zur katholischen Kirche forderte sein Vater eine angemessene Wartezeit. Dann trat er gleich in die westfälische Abtei Meschede ein, bevor eine Griechenland-Reise sein Interesse für den christlichen Osten weckte und er zu den ökumenischen Benediktinern nach Chevetogne wechselte: zwei Riten unter einem Dach, die lateinische und die orientalische Liturgie.
Von ihm selbst wusste man nicht viel mehr, als dass sein ganzes Interesse den „Vätern“ galt, den in den ägyptischen Wüsten im 3. und 4. Jahrhundert versteckt lebenden Asketen. Radikal auf Gott ausgerichtete Sucher, darunter auch zur Heiligkeit strebende ehemalige Räuber, Huren und Ehebrecher. Über deren Schriften entwickelte er sich zu einem großen Kenner. Seine Entdeckungen betrachtete er mitunter als „ganz kostbare Sachen“, mit denen man sich allerdings „nicht auf die Bühne stellt“. Als sein Abt ihm zunächst den Rückzug als Einsiedler verweigerte, sah er sich einem schmerzlichen Kampf ausgesetzt. Dass man ihn dahinein tragen würde, hatte er nicht erwartet, dass es jedoch so schlimm kommen würde, gehört zu seinen persönlichen Erfahrungen der Erniedrigung, der Heimsuchung und des Sich-leer-Machens. Sein Weg in die Wüste, allein mit Gott, war raue und harte Realität.
Erinnerungen an meine ersten Besuche oben im Kastanienwald: Er hatte dort einen jener kleinen Ställe bezogen, in denen die Bergbauern im Herbst ihr Vieh zusammentrieben. Alles war noch zu richten. Der Wind pfiff durch die Ritzen. Die Winter waren schlimm. Da saß er in seiner engen Zelle, ein Büchertisch und ein Bett, nebenan hinter einem Sackvorhang die kleine Kapelle, wo wir vor den Ikonen am Stehpult die Psalmen beteten. Einzelheiten über Nachtwachen und andere asketische Übungen kamen nicht zur Sprache. Nie ein Wort der Klage, vielmehr bei ihm, dem Meister im Editieren frühchristlicher Texte, keine weißen Schreiberhände mehr, eher eine ungewohnte Seite des Handwerkens und Anpackens. Holzhacken, Garten- und Küchenarbeit neben langen Liturgien, Stunden- und Nachtgebeten.
Noch hagerer wurde er, im Laufe der Jahre auch etwas gebeugt. Der lange Bart eisgrau, wüstenväterlich. Über der Stirn das schwarze Kopftuch mit dem kleinen gestickten roten Kreuz. „Wenn man dieses Leben liebt“, sagt er rückblickend auf all die Prüfungen der langen Einsiedlerjahre, „kommt einem der Preis gar nicht sonderlich hoch vor.“ Die einsame Zeit hatte ihn für das Alleinsein mit Gott gestärkt.
Doch war da auch eine andere Entdeckung. Sie hat wesentlich mit dem Namen des um 345 geborenen Eremiten Evagrios Pontikos zu tun, der sein Lehrmeister wurde. Die Anziehung durch den Osten wurde stärker. Evagrios war eine der großen Hoffnungen der frühen Kirche. Seine verheißungsvolle Karriere fand allerdings ein abruptes Ende, als er von der Passion der Frau eines hohen Beamten verfolgt wurde. Er floh nach Jerusalem und entschied sich nach einer kuriosen Krankheit für das Mönchtum. Das war damals gleichbedeutend mit dem Auszug aus „der bewohnten Welt“. Nach zwei Jahren auf einem Berg in der Wüste Nitra südöstlich von Alexandria zog er sich für den Rest seines Lebens 18 Kilometer weiter in die noch strengere „Kellia“ zurück, wo er am orthodoxen Weihnachtsfest, der Epiphanias, im Jahr 399 starb.
In den Besuchszeiten empfängt der Einsiedler Gabriel zahlreiche Hilfesuchende. Immer wieder überrascht ihn die Ehrlichkeit von Menschen, die mitten im Leben stehen. „Da legt man die Hand auf den Mund, ja, und wird bescheiden.“ Die Demut der beichtenden, sogenannten einfachen Leute ist für ihn eine große Schule. Er vermisst diese Ehrlichkeit und Demut in der Kirche, hinauf bis in höchste Ämter. Da bahnt sich ein schwerer Konflikt an, der trotz seiner guten Beziehungen zu verschiedenen Kardinälen zu seinem Übertritt zur russischen Orthodoxie führt. Die russischen Freunde umarmen ihn von Herzen. Seine Taufe wird im Fernsehen gezeigt. Ich habe ihn selten so glücklich gesehen.
Auch in seiner neuen Funktion als Archimandrit vertraut Gabriel seiner spirituellen Erfahrung sowie dem illusionslosen Zeugnis der Väter. Die „Gedanken“ nennt er „Einfallschneise und Kampffeld des Dämonischen, des großen Widersachers und seiner Einflüsterungen“. Er wundert sich über den Aufwand, den die Medien um Satanismus, Okkultismus oder Besessenheit treiben, die Schriften der alten Väter seien konkreter und nüchterner: Eigenliebe bezeichnen sie als „Alleshasserin“, deren Angriffe lehren, dass „dahinter jemand die Drähte zieht“. So hat er gelernt, dass auch im Mönchtum niemand sicher ist, Antonios der Große mahnt, mit Versuchung zu rechnen „bis zum letzten Atemzug“. Gabriel kennt schreckliche Lebensläufe von Mitbrüdern, die in den Gossen der Städte endeten. „Wenn man allein lebt“, sagt er, „werden diese Dinge klarer“. Das ist der Sinn des Lebens der Einsiedler, dass man das Beherrschen lernt „und mit Gottes Hilfe, soweit das in diesem Leben möglich ist, befreit wird“. Was ich von ihm gelernt habe? Beten. Der Ort Gottes ist der Ort des Gebetes, er steht allen offen. Er ist der Zustand innerer Stille, der Herzensstille: Gott alles in allem.