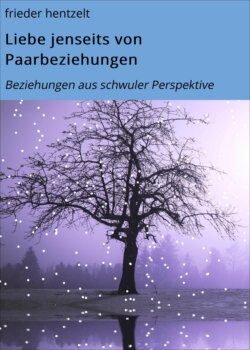Читать книгу Liebe jenseits von Paarbeziehungen - frieder hentzelt - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Geschichte einer Annäherung
ОглавлениеIm Jahr 1919 wurde in einigen deutschen Kinos ein Film gezeigt mit dem Titel „Anders als die Andern“. Ein schwuler Violinvirtuose wird von einem Stricher erpresst, weigert sich aberirgendwann zu zahlen und wird wegen Vergehens gegen den §175 StGB vor Gericht gestellt. Der Film endet damit, dass die Hauptfigur den gesellschaftlichen Druck, den sie nach der Bloßstellung erlebt, nicht mehr erträgt und sich das Leben nimmt. Der Film gilt als der erste in dem damals noch jungen Genre, der das Thema Homosexualität aufgreift. Ganz sicher spiegelt sich in ihm recht gut die Situation von Männern, die Männer begehren, im ausgehenden deutschen Kaiserreich. Erpressungen waren angesichts der damaligenRechtslage keine Seltenheit und es war nur eine verschwindende Minderheit, die die Lustunter Männern einfach hinnehmen konnte. Vor allem aber kamen Schwule als diejenigen vor,die eben anders als die Anderen sind. So wurden sie von anderen gesehen und so sahen sie sich selbst.
Für Schwule bot die Vorstellung, sie seien irgendwie anders als die Anderen, zunächst große Vorteile. Ihr Begehren war damit der Sphäre moralischer Beurteilung entzogen. Niemand sucht es sich aus freien Stücken aus, anders zu sein. Es ist ein Zustand, in dem man sich ungewollt einfach vorfindet. Wo keine Freiwilligkeit vorliegt, ist es auch nicht möglich zu verurteilen, oder von Männern zu sprechen, die sittlich verkommen sind oder sich unerlaubten Lüsten hingeben. Der Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, der sich in dem erwähnten Film in einer Szene selbst spielt, legte in seinem Kampf gegen die strafrechtliche Verfolgung der Sexualität unter Männern immer sehr großen Wert auf diesen Aspekt. In einigen populärwissenschaftlichen Aufsätzen bezeichnete er Männer, die andere Männer begehrten, als Angehörige eines dritten Geschlechts.
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass diese zunächst sehr griffige Bezeichnung letztlich genauso schwammig bleibt, wie die Bezeichnung der Schwulen als die Anderen. Es wird nicht klar, was damit eigentlich inhaltlich gemeint sein soll. Nun darf allerdings nicht übersehen werden, dass es bei dieser wissenschaftlich unhaltbaren Position nicht darum geht, das Wesen schwuler Männer genauer zu bestimmen, sondern darum, Argumente gegen eine juristische Verfolgung der Sexualität unter Männern zu liefern. Bis zum heutigen Tage findet sich dieses Argumentationsmuster in den Äußerungen und dem Selbstbild zahlreicher schwuler Männer, insbesondere dann, wenn von außen moralische Gründe gegen deren Art zu leben vorgebracht werden.
Bei allen Gefahren, die zunächst für die Betroffenen bestehen blieben, konnte sich durch diese Sichtweise etwas wie ein schwules Leben etablieren. Mit dem Rückgang der juristischen Verfolgung – in der Bundesrepublik Deutschland nach der großen Strafrechtsreform von 1969 – gab es geradezu eine Explosion in der Entwicklung dessen, was man damals die schwule Subkultur nannte. Dabei ging es um wesentlich mehr, als um die Bereitstellung von Orten und Institutionen, die die Aufnahme von sexuellen Kontakten unkompliziert und unverbindlich ermöglichten, auch wenn das selbstverständlich seine Bedeutung hatte und behielt. In der Literatur, der Philosophie, der Psychologie, dem Unterhaltungssektor und in vielen anderen Bereichen, sogar bis in Sprache und Gestik hinein entwickelte sich ein eigenständiges schwules Leben. Das wurde zum Teil heftig abgelehnt, zum Teil überschwänglich begrüßt. Es gab Stimmen, die hier ein Zeichen für den kommenden Niedergang des Abendlandes erkennen wollten, wohingegen andere in der schwulen Subkultur Elemente eines kommenden freieren, echteren und besseren Lebens sahen. Dieses Spiel brachte zum Teil bunte Blüten hervor. Es war nicht nur die heterosexuell geprägte Umwelt, die in den Schwulen die Anderen sah und sie in diese Position drängte, es waren auch einige Schwule selbst, die sich so begriffen und inszenierten.
Neben dieser Strömung innerhalb der schwulen Welt gab es aber immer auch eine entgegengesetzte, die in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat und augenblicklich wohl die bestimmende ist. Dadurch dass es immer selbstverständlicher geworden ist, seine sexuellen Vorlieben öffentlich zu machen, ist die Zahl der Menschen, die von sich selbst und von anderen als schwul bezeichnet werden, deutlich gewachsen. Dabei wurde klar, dass es sich bei ihnen oft um ansonsten völlig unauffällige Zeitgenossen handelt. Auch Menschen, deren Beruf oder Privatleben ein hohes Maß an Normalität verlangen, gaben sich als schwul zu erkennen. Man kann sagen, dass schwule Männer auf diese Weise immermehr den Nimbus des Fremden und „Anderen“ verloren haben. Während der großen Aids-Katastrophe von 1981-1994 wurde diese Entwicklung massiv vorangetrieben. Viele Betroffene hätten ihr Sexualleben wahrscheinlich lieber verheimlicht, es wurde aber durch Krankheit und Tod in die Öffentlichkeit gezerrt.
Zunächst sah es allerdings absolut nicht nach Verbesserung für die Schwulen aus. Man erinnere sich etwa an die Äußerungen von Peter Gauweiler, der die Infizierten gesellschaftlich isolieren wollte, oder den bayerischen Kultusminister Hans Zehetmair, der von einer willkommenen Ausdünnung des gesellschaftlichen Randes sprach. Das jämmerliche und grausame Sterben so vieler Männer aber löste angesichts der empörenden Äußerungen eine Welle der öffentlichen Solidarität aus. Viele Prominente trugen die rote Schleife als Zeichen der Solidarität mit den Aidskranken.
Schwule, die bis dahin ihre Sexualität eher geheim hielten, fanden den Mut, an die Öffentlichkeit zu treten. Daneben kamen diejenigen, die sich angewidert oder negativ über Schwule äußerten, immer mehr in die Defensive. Den Schwulen kam eine neue Rolle zu. Sie waren nicht mehr die Anderen. Sie waren jetzt die organisch Kranken oder die von Krankheit bedrohten. Im Rahmen der Politik, die sich in der Bundesrepublik Deutschland allmählich unter dem Stichwort „Aids geht uns alle an“ durch setzte, hörte schließlich auch diese Krankheit auf, ein exklusives Merkmal von Schwulen zu sein, was der Normalisierung der Schwulen weiteren Vorschub leistete.
Wesentlicher für das Bild schwuler Beziehungen als alles bisher Beschriebene dürfte aber eine andere Entwicklung gewesen sein. Schon in den frühen Tagen der Schwulenbewegung gab es Vertreter, die die Fixierung auf ein bestimmtes sexuelles Verhalten monierten. Für sie waren Schwule nicht nur Männer, die andere Männer begehrten und mit ihnen Sex hatten. Ihnen war wichtiger, dass es Männer waren, die andere Männer liebten. Einige wollten sogar das Wort Homosexualität durch den Ausdruck Homophilie ersetzen, um von vornherein die Liebe in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken. Dabei wäre es sehr arrogant zu behaupten, dass hier nur die finstere und anrüchige Sexualität durch die edlere und weniger anstößige Liebe ersetzt werden sollte. Man hat zu sehen, dass auf diesem Wege für viele Schwule ihr Selbsterleben wesentlich besser getroffen wurde. Mit der Zeit wurde dabei immer mehr die Ähnlichkeit der Liebe zwischen Mann und Frau mit der Liebe eines Mannes zu einem anderen Mann betont. Einem Ratgeberbuch vor allem für die Eltern schwuler und lesbischer Kinder gab der Psychologe Thomas Grossmann den Titel „Eine Liebe wie jede andere“. Damit verlieh er einem zentralen Aspekt einen treffenden und griffigen Ausdruck. Von etwas naiven Emanzipations- und Gleichberechtigungspolitikern ist aus dieser Entwicklung die Forderung nach einer juristischen Gleichstellung von lesbischen und schwulen Paaren mit Eheleuten oder einer Öffnung der Ehe abgeleitet worden.
Das, was in nicht einmal 100 Jahren geschehen ist, kann durchaus als atemberaubend bezeichnet werden. Es begann mit denen, die anders waren als die Anderen und mündete darin, dass sie eine Liebe haben, wie jede andere. Dabei hieße es, die Bedeutung der Schwulenbewegung deutlich zu überschätzen, wenn man in ihr die einzige oder die wesentliche Triebkraft dieser Entwicklung sehen wollte. Hätte sich in dieser Zeit nicht auch das Verhältnis von Mann und Frau und die Beziehung zwischen beiden an verschiedenen Stellen fundamental verändert, dann wäre auch Liebe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen nicht zu einer Liebe wie jeder anderen geworden.
Diesen Veränderungen kann und soll hier nicht im Einzelnen nachgegangen werden. Nur zwei Punkte, die unmittelbar ins Auge fallen, sollen im Folgenden beleuchtet werden. Der erste Aspekt bezieht sich auf das Auseinanderfallen von Lust und Fruchtbarkeit, wie es sich durch den Siegeszug der Pille ergeben hat. Der zweite betrifft die Art, wie die Unterschiede zwischen Mann und Frau gesellschaftlich konstruiert werden.
In der Beziehung zwischen Männern an Frauen gab es früher eine untrennbare Verbindung zwischen Lust und Fruchtbarkeit. Jeder Geschlechtsverkehr konnte prinzipiell zu einer Schwangerschaft führen. Der berühmte Ausspruch des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer, Kinder kämen ganz von alleine, deutet darauf hin, wie eng bis in die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein diese Verbindung war. Selbstverständlich ging schon damals die Sexualität zwischen Männern und Frauen nicht in der Zeugung auf. Unmittelbare Lust aber auch Erlebnisse von Macht und Unterwerfung spielten immer eine wesentliche Rolle. Ebenso gab es auch immer schon Möglichkeiten, eine Schwangerschaft zu verhindern.
Diese Verhütungsmethoden waren alle nicht wirklich sicher und bedeuteten fast immer, dass ein gewisser Aufwand während oder unmittelbar vor dem Geschlechtsverkehr zu betreiben war. Einen solchen Zusammenhang zwischen Lust und Fruchtbarkeit gab es da, wo nur Männer beteiligt sind, selbstverständlich niemals. Hier stand die Lust immer für sich alleine. Das gilt natürlich auch für Lesben. Da die weibliche Sexualität aber ein ganz eigenes Thema ist, soll hier allein die schwule Perspektive in den Blick genommen werden. Man kann fast sagen, dass sich vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Verknüpfung von Lust und Fruchtbarkeit auch unterschiedliche Sexualitäten mit ihren jeweils eigenen Regeln und Institutionen entwickelt haben. Auf der einen Seite ist das Ideal der lebenslangen sexuelen Exklusivität und die Institution der Ehe entstanden. Auf Seiten der Schwulen wurde die Sexualität geprägt durch eine wesentlich höhere Zahl von Sexualpartnern und Institutionen wie spezielle Kneipen, Darkrooms und Pornokinos, in denen kurzfristige sexuelle Kontakte aufgenommen werden konnten.
Fundamental verändert hat sich diese Situation, da inzwischen auch für Heterosexuelle der unmittelbare Zusammenhang zwischen Lust und Fruchtbarkeit nicht mehr besteht. Mit der Markteinführung der Antibabypille im Jahr 1962 und ihrer inzwischen selbstverständlichen Nutzung wurde für Frauen ihre Fruchtbarkeit zu Etwas, über das sie selbst entscheiden können. Sie sind nur dann fruchtbar, wenn sie es wollen. Dadurch hat sich die Sexualität zwischen Mann und Frau stark der schwulen angeglichen. Dabei ist es auf keinen Fall schon zu einer völligen Gleichgestalt gekommen. Dafür ist die Zeit der Veränderung noch deutlich zu kurz. Aber die Richtung der Entwicklung ist schon deutlich. Das zeigt sich besonders klar auch darin, dass die moralische Beurteilung schwuler Sexualität sehr viel milder geworden ist. Ihre Erscheinung wird nur noch selten von vorneherein als wahllos, hedonistisch oder unverantwortlich bezeichnet, was früher durchaus üblich war.
Das zweite, was in seiner Entwicklung und Veränderung erst die heutige gesellschaftliche Positionierung und Wahrnehmung der schwulen Beziehung möglich gemacht hat, ist die Art der Zuordnung bestimmter Eigenschaften zu den Geschlechtern. Zweifellos gibt es Unterschiede zwischen den Angehörigen der beiden Geschlechter. Man denke etwa an die durchschnittliche Körpergröße oder die sekundären Geschlechtsmerkmale. Es gibt daneben aber auch eine Vielzahl von Untersuchungen, die diverse andere Differenzen zwischen Männern und Frauen zeigen wollen, etwa im Aufbau des Gehirnes, oder auch mit Blick auf unterschiedliche Intelligenzprofile. Über die Überzeugungskraft solcher Untersuchungen kann allerdings trefflich gestritten werden. Was der „kleine Unterschied“ bedeutet, ist alles andere als klar.
Entscheidender als alles, was sich womöglich am Körper finden lässt, ist aber die Rolle, die den Geschlechtern auf gesellschaftlicher Ebene zugeschrieben und zugewiesen wird. Das war einmal sehr eindeutig und wurde kaum infrage gestellt. Männer hatten die Ernährer ihrer Familien zu sein und Frauen hatten sich um Haushalt und Nachwuchs zu kümmern. Beziehungen wurden so gedacht, dass beide Aufgaben klar voneinander getrennt und jeweils einem der beiden Beteiligten zugeschrieben wurden. Auch wenn von feministischer Seite zu Recht noch einige Defizite beklagt werden; es hat sich hier in den letzten Jahrzehnten einiges verändert. Sehr deutlich wird das zum Beispiel an der Rede von der Wahlfreiheit, die Frauen bei der Suche nach dem für sie besten Lebensweg gegeben werden soll. Hier wird nicht mehr davon ausgegangen, dass eine bestimmte Rolle schon allein dadurch vorgegeben ist, dass eine Frau eine Frau ist. Prinzipiell sagt man, dass sie genauso gut eine Position übernehmen kann, die früher allein Männern vorbehalten war. Vielleicht etwas übertrieben sprechen einige Forscher angesichts dieser Entwicklung von einer „Homosexualisierung“ unserer Gesellschaft. Wo sich die Geschlechter immer mehr angleichen, entsteht eine Art Gleichgeschlechtlichkeit.
Mit Blick darauf, wie schwule Beziehungen von der heterosexuellen Umwelt gesehen werden, zeigt sich, dass die oben beschriebene Veränderung nicht ohne Auswirkungen geblieben ist. Die Älteren werden sich noch gut daran erinnern, dass dort, wo die Beziehung zweier Männer von anderen wahrgenommen wurde, sehr schnell die Frage auftauchte, wer von beiden die Frau und wer der Mann in der Beziehung sei. Hier zeigt sich, dass als conditio sine qua non für das Zusammenleben zweier Menschen das Zusammentreffen der beiden Geschlechtsrollen angesehen wurde. Der eine musste „die Hosen anhaben“ während der andere folgsam war und das Schöne im Blick hatte. Gerne wurde das auch mit den verschiedenen Positionen beim Analverkehr verbunden. Wer hier aktiv war, der verhielt sich quasi wie ein richtiger Mann, während der passive Partner die Rolle der Frau übernahm. Männer waren die diejenigen, die penetriert haben. Wer penetriert wurde, war unmännlich.
Die Vorstellung eines Mannes, der eine weibliche Rolle übernimmt, war nicht nur irritierend, sie wurde durchaus als Beleidigung verstanden und verwendet. Der Begriff des effeminierten Mannes war immer, so neutral er auch klingen mochte, negativ konnotiert. Unter den damaligen Umständen wäre der Preis hoch gewesen, wenn schwule Männer eine Beziehung wie jede andere gehabt haben wollten. Durch die Entwicklungen der letzten Dekaden ist er bedeutend geringer geworden. In dem Maße, in dem die Geschlechtsunterschiede nicht mehr als Wesensunterschiede betrachtet werden – in dem Sinne, dass die eine Seite der anderen zu dienen habe und ihr eine andere gesellschaftliche Position zukäme – sondern viel mehr auf der Ebene von Persönlichkeitsunterschieden – in dem Sinne, dass der eine nicht zuhören und die andere nicht einparken könne – können auch Beziehungen unter Männern ohne Irritation oder Beleidigung denkbar werden.
Die oben dargestellten Veränderungen der heterosexuellen Paarbeziehung mit ihren Auswirkungen auf die Beziehung zwischen zwei Männern sind eingebunden in die Entwicklung dessen, was der Psychiater und Existenzanalytiker Viktor E. Frankl die reine Beziehung genannt hat. Das sind für ihn Beziehungen, die alleine um der Beziehung willen existieren. Ihr Zentrum und das, was sie am Leben erhält, sind die gegenseitigen Gefühle der Beteiligten. Auf juristischer Seite entspricht der reinen Beziehung das Modell der Liebeshochzeit, das sich in den letzten Jahrzehnten in unseren Breiten als das dominante, wenn nicht gar als einzig gültiges Modell entwickelt hat. Galten früher noch Aspekte der gesellschaftlichen Stellung oder auch Absprachen der Eltern des Paares als wichtige Gründe für die Bildung einer Paarbeziehung, so wird das heute nur noch als Zwangshochzeit bezeichnet. Der Zwangshochzeit gegenüber erscheint für uns die Liebeshochzeit als kulturell und moralisch überlegen.
Verschiedene Menschen, die sich theoretisch mit Beziehungen auseinandergesetzt haben, haben immer wieder betont, dass menschliche Gefühle viel zu flüchtig sind, als dass sie eine lebenslange Beziehung begründen könnten. Noch schärfer fällt das Urteil über schwule Beziehungen etwa bei dem Psychoanalytiker Fritz Morgentaler aus. Er hat eine eigene Theorie, wie sich Homo- und Heterosexualität entwickeln. Auf dem Boden dieser Annahmen sieht er für schwule Männer geradezu eine Notwendigkeit, Beziehungen eher kurzfristig anzulegen. Solche Theorien entlasten von dem Anspruch, dass Beziehungen lebenslang und monogam sein müssen. Was unmöglich ist, kann auch nicht gefordert werden.
Dennoch ist das Ideal der Paarbeziehung von diesen kritischen Einwänden weitgehend unberührt geblieben. Das mag zum einen daran liegen, dass Idealvorstellungen ihr Eigenleben haben. Ganz sicher liegt es aber auch daran, dass es Paare gibt, die ihr Leben lang in Liebe miteinander leben. Solche Paare können sowohl aus Frau und Mann als auch nur aus Männern bestehen. Grundsätzliche Unterschiede in Bezug auf Gefühle und Empfindungen lassen sich nicht begründen. In dem Maß also, in dem sich die Wahrnehmung von Beziehungen allein auf Gefühle und Empfindungen reduziert, gleichen sich also heterosexuelle und schwule Beziehungen aneinander an.
Die bisherige Darstellung der Entwicklung der letzten 100 Jahre ergab zwei Bewegungsrichtung, die beide auf dasselbe Ziel hinausliefen. Auf der einen Seite war da die Coming-out Bewegung, die immer deutlicher die Schwulen als selbstverständlichen Teil der Mehrheitskultur sichtbar werden ließ. Der Teil der Schwulen, der sich als provozierende Minderheit empfand, der sich als die Anderen darstellte und inszenierte, geriet immer mehr in die Bedeutungslosigkeit. Gleichzeitig verblassten die Geschlechtsunterschiede in Beziehungen, die Möglichkeit, Nachkommen zu haben, wurde für Mann-Frau Verbindungen immer zweitrangiger. Der Aspekt, die Liebe zu einander zu verwirklichen und zum Ausdruck zu bringen, wurde zum zentralen Moment von Beziehungen. Das wird für das weitere bedeuten, dass dem, was Liebe ist und bedeutet, intensiver nachgegangen werden muss. Dennoch soll zunächst einmal geklärt werden, ob schwule Beziehungen überhaupt gesondert betrachtet werden sollten.