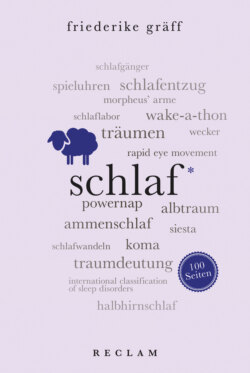Читать книгу Schlaf. 100 Seiten - Friederike Gräff - Страница 5
ОглавлениеEinschlafen – Showdown im Kinderzimmer und Morpheus’ Arme in der Apotheke
Sonderbar, habe ich oft gedacht, wenn ich bei Freunden abends nicht mehr anrufen konnte, weil das die gerade ins Bett gebrachten Kinder hätte wecken können. Sonderbar, dachte ich, wenn sich Freundinnen vom gemeinsamen Abendbrot für eine halbe Stunde verabschiedeten, weil ihre Kindergartenkinder nur einschliefen, wenn sie sich dazu legten. Jetzt habe ich selbst Kinder, die nur einschlafen wollen, wenn man sie nach genauen Anweisungen küsst. Ich sehe mir oft selbst mit Befremden dabei zu, aber ich finde keinen Weg, es anders zu lösen. Als die Zeit, die es dauerte, meine große Tochter ins Bett zu bringen, sich auf Stunden ausdehnte, habe ich die Beratung einer Kinderkrankenschwester aufgesucht. In den Buchhandlungen liegen Kinderbücher, in denen die Kinder so lange wach bleiben, bis ihre übermüdeten und hilflosen Eltern in den Kinderbetten der Schlaf übermannt, und unter den Erwachsenen entwickelte sich der entnervte, Buch gewordene Aufschrei eines Vaters – Verdammte Scheiße, schlaf ein von Adam Mansbach – zum Bestseller.
Die meistgekauften Schlaflied-Spieluhren in Deutschland
1 Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
2 Wiegenlied von Johannes Brahms
3 La Le Lu
4 Schlaf, Kindchen
5 Guter Mond, du gehst so stille
6 Sandmann, lieber Sandmann
(Stand: März 2019; Quelle: Vedes)
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter abends Stunden an meinem Bett verbracht hätte – wie auch, wenn vier andere Kinder versorgt sein wollten. Wenn ich sie danach frage, wie es war, sagt sie – und es scheint Mitleid mit mir durch –, dass es überhaupt nicht kompliziert gewesen sei. Meine Zwillingsschwester und ich schliefen in Gitterbetten, aus denen wir nicht hätten aussteigen können, einmal ins Bett gebracht waren wir eben ins Bett gebracht. Ganz einfach. Ich habe meine Kindheit alles andere als lieblos in Erinnerung, und in der Theorie würde ich es gern genauso machen. In der Praxis scheint dieses Procedere wie ein Traum aus einem fernen, entschwundenen Land.
Wenn man die Geschichte des Kinderschlafs verfolgt, dann taucht dieser erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Problem auf. Das lag nicht daran, dass die Kinder plötzlich nicht mehr schliefen, sondern an veränderten Erwartungen der Eltern. Und, so absurd das auf den ersten Blick wirken mag, am Bemühen der neu entstehenden Profession der Kinderärzte, sich Autorität zu sichern. Die Historiker Peter Stearns, Perrin Rowland und Lori Giarnella haben am Beispiel der USA nachvollzogen, wie zunehmend Experten in der Öffentlichkeit auftauchten, die mehr Schlaf für die Kinder verlangten; die Entwicklung in Deutschland verlief ähnlich. Das US-Innenministerium hatte schon 1910 bestimmte Schlafzeiten gefordert: von 13 Stunden für 5- bis 6-Jährige bis zu 9 ½ Stunden für die 16- bis 18-Jährigen. Zuvor hatte man lange angenommen, dass Kinder von sich aus ihre Schlafdauer regulierten – und noch 1901 hieß es im Ladies’ Home Journal, dass alles oberhalb von sechs Stunden in Ordnung sei.
Zu wenig Schlaf wurde zu einem Problem: Die Begriffe chronic fatigue und overfatigue tauchten auf, ein Mangel, der bei Schulkindern Krankheiten und schlechtes Lernen nach sich ziehen sollte. Verantwortlich gemacht für die Übermüdung wurden die Schulen – und die Mütter. Deren Verantwortung war es nämlich, die Kinder vor den emotionalen Spannungen zu bewahren, die sie am Schlafen hinderten. Und sie waren es, die den Kindern das richtige Schlafen beibringen sollten. Denn das war nicht länger etwas, was sich natürlich einstellte, sondern etwas, das erlernt werden musste. Was hinzukam: ein Rhythmus von Wach- und Schlafzeiten, den es streng einzuhalten galt. Aber nicht nur die Idee, wie und wie viel ein Kind schlafen sollte, änderte sich – auch das familiäre Umfeld wurde nach und nach ein anderes. Wo nachts einmal Hausangestellte, Großeltern oder ältere Geschwister den Schlaf der Kleinen mitgehütet hatten, waren die Eltern nun auf sich gestellt.
Eigentlich ist es paradox: Mit weniger Hilfe will man heute gewachsene Ansprüche erfüllen. Dabei sind auch die der Eltern gewachsen. Sie wollen den Feierabend nun auch außerhalb der Wohnung verbringen und abends ausgehen, Sex ist nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern zur ehelichen Vergnügungspflicht geworden. Die Folge: Auch die Erwartung an das schlafende Kind wächst. Und das in einem Umfeld, das dem Einschlafen viel weniger entgegenkommt – nicht länger in einer Wiege, die geschaukelt werden kann, nicht länger umgeben von anderen Schlafenden, sondern in einem eigenen Kinderbett in einem separaten Raum.
(Quelle: National Sleep Foundation). Dies sind die Empfehlungen in der aktualisierten Fassung von 2015 – auch heute sind die Auffassungen von gutem Schlaf veränderlich.)
Marion Brinkers ist Kinderkrankenschwester und Familienberaterin, wir suchten sie auf, als wir Stunden am Bett unserer großen Tochter verbringen mussten, bis sie endlich einschlief. Ich muss gestehen, dass ich nicht mehr genau weiß, was Marion Brinkers uns riet. Aber der Besuch bei ihr ließ uns den Abenden etwas gelassener gegenübertreten. Probleme mit dem Schlaf gehören zu den häufigsten Anliegen, mit denen Eltern zu ihr kommen. Dass es bei dem Thema zu Reibungen zwischen Kindern und Eltern kommt, wundert sie nicht: »Ich finde es normal, dass Kleinkinder morgens um fünf aufwachen«, sagt sie. »Dann ist es meistens hell, und früher sind alle um diese Zeit aufgestanden.« In Zeiten verschobener Tag-Nacht-Rhythmen sind die Eltern zu dieser Zeit alles, aber nicht wach. Zugleich erfinden sie die Elternrolle vielfach neu, das heißt, dass auch die Frage, wie und wann die Kinder ins Bett kommen, wieder verhandelt wird. Grundsätzlich, so erlebt es Brinkers, wird häufig das Wollen und Wünschen der Kinder über deren Grundbedürfnisse gestellt, denn die Eltern wollten freundlich sein.
»Es ist die Generation, die macht«, sagt Marion Brinkers. Der müde und schreiende Säugling muss getröstet werden, aber für das Gefühl der Eltern reicht es nicht aus, schlicht da zu sein. Es muss etwas getan werden, das Kind wird hochgenommen, gestillt oder geschuckelt. »Das ist oft der Beginn eines Teufelskreises«, sagt Brinkers. Denn die Kinder lernten nicht, ohne größere Angebote von außen einzuschlafen. Die entnervten Eltern sagten schließlich: »Ich habe alles getan, aber das Kind will nicht schlafen.«
Bei den größeren Kindern schließlich werde das Bedürfnis nach Schlaf oft gar nicht gesehen. Die Kinder drehten auf, weil sie bereits übermüdet seien und statt der Müdigkeit sähen die Eltern nur das Wollen. »Die Idee, dass die Kinder umso leichter einschlafen, je müder sie sind, stimmt nicht«, sagt Marion Brinkers. Um die Übermüdung am Abend zu verhindern, empfiehlt sie Pausen am Tag. Nicht immer gleich das Kind bespaßen und anregen, sondern Auszeiten zulassen. Weniger statt mehr.
Während ich dies schreibe, kommt meine 6-jährige Tochter zum dritten Mal aus dem Bett. Es ist spät und die Notwendigkeit, ihr Wasserglas aufzufüllen, offenkundig ein Vorwand, um das Bett zu verlassen. »Warum kannst du so lange nicht einschlafen?« fragte ich sie neulich, als ich sie ins Bett brachte. Ihre Antwort: »Ich muss noch an so viele Dinge denken.«
Es gibt viele Gründe, den Beginn des Schlafs kontrollieren, vielleicht sogar erzwingen zu wollen. Was sich geändert hat, sind die Möglichkeiten dazu. Bis ins 19. Jahrhundert war der Umgang mit Opiaten sehr sorglos, Kinder waren davon nicht per se ausgeschlossen. Die eigentlichen Schlafmittel gibt es seit dem 19. Jahrhundert, beginnend mit den Barbituraten, die zwar zuverlässig wirken, aber bereits bei zehnfacher Überdosierung tödlich sein können. Als 1956 das Schlafmittel Contergan auf den deutschen Markt kam, glaubte man, damit dieser Gefahr zu entgehen. Ein sicheres Schlafmittel schien gefunden, doch fünf Jahre später war klar, um welchen Preis: Mütter, die während der Schwangerschaft Contergan eingenommen hatten, bekamen Kinder, die körperlich schwer geschädigt waren. Seitdem sind die Arzneimitteltests in Deutschland ungleich strenger.