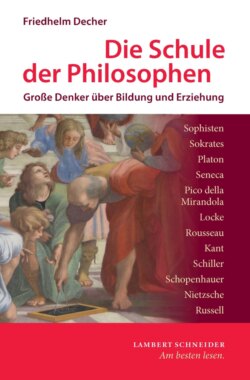Читать книгу Die Schule der Philosophen - Friedhelm Decher - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II Sokrates:
Nichtwissen als Weisheit
ОглавлениеPhilosophie in der Antike, so haben wir bereits bei den Sophisten gesehen, das war alles andere als abstraktes, blutleeres und weltfremdes Räsonieren über Probleme, die mit denjenigen, die den Menschen und seine Lebensverhältnisse unmittelbar berühren, wenig oder gar nichts zu tun haben. In der Antike vielmehr gestaltete sich Philosophie als Lebenskunst. Sie versuchte Anstöße und Anregungen zu geben, wie man sein Leben selbst in die Hand nehmen kann. Ähnlich wie ein Künstler ein Werk gestaltet, so meinte man, kann auch der Einzelne frei sein Leben gestalten, es selbst aufbauen, ihm Form und einen selbst verantwortbaren Sinn und damit zugleich anderen Menschen Verhaltensregeln an die Hand geben, ihr Leben entsprechend einzurichten. Seneca (4 v. Chr.–65 n. Chr.), ein späterer, prominenter Vertreter einer Philosophie als Lebenskunst, hat dafür die schöne Formel vom artifex vitae, vom Künstler des Lebens, geprägt.
Als einer der Ersten – nach den uns erhaltenen Zeugnissen wohl überhaupt der Erste –, der Philosophie in diesem Sinne als Lebenskunst sowohl theoretisch betrieb als auch praktisch vorlebte, begegnet uns Sokrates. Das Bild allerdings, das die Überlieferung von ihm zeichnet, ist alles andere als eindeutig.
Im Jahre 423 v. Chr. wurde in Athen die Komödie Die Wolken des Komödiendichters Aristophanes aufgeführt, die im Kern nichts weniger als eine bissige Satire auf Sokrates ist. Besäßen wir über sie hinaus keine anderen Zeugnisse, die über das Leben und Denken des Sokrates berichteten, so müsste man ihn aufgrund der in ihr gegebenen Charakterisierung für den übelsten aller Sophisten – und zwar in einem durch und durch negativen Verständnis – halten, erklärt Aristophanes ihn doch zum Hauptschuldigen für das Unheil, das die in seinen Augen verderblichen Aktivitäten der Sophisten angerichtet haben. Der Sokrates, den Aristophanes auf die Bühne bringt, sitzt mit seinen Anhängern und Schülern in der „Denkerbude“, er selbst die meiste Zeit in einem Korb unter der Decke, von wo er sich nur herablässt, um einem Ratsuchenden gegen ein üppiges Honorar windige Ratschläge zu erteilen. Dieser aristophanische Sokrates ist erklärter Atheist, der Zeus durch einen „kosmogonischen Wirbel“ ersetzen will, ist der Urvater aller wortverdrehenden Rhetorik, welche die ungerechte Sache mit Worten und argumentativen Tricks zur gerechten ummünzt, ein wahrer Verderber der athenischen Jugend und ein Vertreter physikalischer, grammatischer und ästhetischer Lehren, die sich zwar als „Weisheit“ ausgeben, sich durch ihre offenkundige Unsinnigkeit und Lächerlichkeit jedoch selbst entlarven. Kein Wunder also, dass am Ende des Stücks die „Denkerbude“ in Brand gesteckt wird – der Tod durch das reinigende Feuer als das einem solchen Wortverdreher und Jugendverderber angemessene Ende. Soweit Aristophanes.
Allein schon der Sachverhalt, dass seine Komödie auf Unverständnis beim damaligen Publikum stieß, ja von diesem gar abgelehnt wurde, lässt vermuten, dass man es bei ihr mit einem Zerrbild – einem reichlich grotesken zumal – zu tun hat. Aber wer und wie war Sokrates wirklich? Nun, diese Frage wird sich wohl nie endgültig beantworten lassen, hat dieser wunderliche Mensch, als der er seinen Zeitgenossen erschien, doch selbst keine einzige Zeile der Nachwelt hinterlassen – weder seine Biografie noch sein Denken betreffend, von einer ‚Lehre‘ ganz zu schweigen. Und so sind wir allein angewiesen auf die Berichte, die uns einige seiner Zeitgenossen überliefert haben. Zum Glück handelt es sich dabei um so glaubwürdige Autoren und Philosophen wie Platon, Xenophon und Aristoteles. Die umfangreichsten Zeugnisse über Leben und Denken des Sokrates liefert uns Platon, in dessen Dialogen wir eine Menge an Material vor uns ausgebreitet finden, das sowohl biografische Einzelheiten betrifft als auch über Sokrates’ philosophische Überzeugungen informiert. Allerdings stellt sich uns Heutigen in Anbetracht dieses Materials die Frage, was von dem, was Sokrates sagt, von Platon als Bericht gedacht oder was seine, Platons, Ansicht ist. Letztgültig wird sich auch dieses Problem wohl nie klären lassen. Doch schon Schleiermacher war der Überzeugung, wir müssten – und könnten – lernen, zu unterscheiden, wann Platon einen Bericht über seinen Lehrer Sokrates und dessen Philosophie geben will, und wann Platon seine eigene Lehre durch den Mund des Sokrates vorträgt.
Die zweite bedeutende Quelle für unsere Kenntnisse stellen die meist als Memorabilien zitierten Erinnerungen an Sokrates des Xenophon dar. Xenophon, der um das Jahr 430 v. Chr. in Athen geboren wurde, lernte Sokrates bereits in jungen Jahren kennen und zählte zu dessen begeisterten Verehrern.
Während Xenophon noch selbst vertrauten Umgang mit Sokrates hatte, kann das von unserem dritten wichtigen Gewährsmann, nämlich Aristoteles, nicht mehr behauptet werden, wurde der doch 384 oder 383 v. Chr. – also gut fünfzehn Jahre nach Sokrates’ Tod – im makedonischen Stageira geboren. 367 v. Chr. finden wir ihn dann in Athen, wo er in die Platonische Akademie eintrat und zwanzig Jahre – bis 347 v. Chr. – deren Mitglied blieb. Über Platon hinaus dürfte er dort zahlreichen Menschen begegnet sein, die Sokrates noch persönlich gekannt haben. Daher ist anzunehmen, dass die Stellen in seinem Werk, an denen er von Sokrates spricht und dessen philosophische Bedeutung darstellt, nicht allzu weit von der historischen Wahrheit entfernt sind.
Diese drei Gewährsleute nun zeichnen ein völlig anderes – wenn auch jeweils unterschiedlich akzentuiertes – Bild des Sokrates, als Aristophanes in den Wolken. Dabei spielt der Umstand, dass Sokrates, anders als die Sophisten, für seine Lehre kein Honorar nahm und in bescheidenen Verhältnissen lebte, nur eine untergeordnete Rolle. Wichtiger sind andere Aspekte. Die Sophisten konstruierten ihre Reden und Argumentationen mit äußerster Sorgfalt, für sie zählte schöner, geschliffener Stil und längerer zusammenhängender Vortrag. Sokrates hingegen bediente sich der alltäglichen Sprache, die man auf der Straße und auf dem Marktplatz sprach. Er suchte das Zwiegespräch, den Dialog mit einem oder mehreren Partnern. Und während die Sophisten nachhaltigen Eindruck auf ihre Hörer machen wollten und zu diesem Zweck auch vor rhetorischen Knalleffekten nicht zurückschreckten, ging es Sokrates ausschließlich um die zur Debatte stehende Sache, um eine ungelöste Problemstellung, um – mit einem gewichtigen Wort gesagt – die ‚Wahrheit‘.
Diese Wahrheit nun war keine abstrakt-wissenschaftliche, sondern eine, die in engster Verbindung stand mit dem Menschen und den ihn umtreibenden lebenspraktischen Problemen. Sehr schön geschildert hat das Xenophon. „Sokrates“, so erinnert er sich, „führte seine Gespräche immer über die Fragen, die den Menschen angehen. Er forschte, was fromm und was gottlos, was sittlich-schön und was hässlich, was recht und was unrecht, was Besonnenheit und was Leidenschaft, was Tapferkeit und was Feigheit, was ein Staat und ein Staatsmann, was eine Regierung und ein Regent der Menschen sei, und über die anderen Dinge, deren Wissen ihm gleichbedeutend mit sittlicher Tüchtigkeit war, deren Unkenntnis aber nach ihm mit Recht den Namen Knechtsgesinnung trug“.20
Diese Orientierung am Menschen, dieses Nachsinnen und Forschen über Ansichten und Tugenden, die sein Verhalten und Zusammenleben mit anderen betreffen, findet seinen beredten Ausdruck in einer Äußerung, die Platon in seinem Dialog Politeia, dem Entwurf eines idealen Gemeinwesens, Sokrates in den Mund legt. Im Zusammenhang mit der Frage, ob der gerechte Mensch ein besseres Leben führe und glücklicher sei als der ungerechte, sagt Sokrates nämlich, bei einer solchen Frage handele es sich ja nicht um etwas Belangloses, sondern darum, wie man leben soll.21 Die Frage nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit kann demnach für Sokrates nicht rein abstrakt-theoretisch beantwortet werden, das heißt nicht losgelöst von der Frage, wie man sein Leben einrichten soll. Ziel hierbei ist es nach sokratischer Ansicht – und Spätere wie Aristoteles, Epikur, die Stoiker und die Skeptiker werden ihm hierin folgen –, ein sinnvolles, ein gelingendes Leben zu führen, ja vielleicht sogar eines, das es verdient, als glücklich bezeichnet zu werden. Entsprechend sehen wir den Sokrates, den die Zeitgenossen schildern, bemüht, die Ansichten seiner Mitmenschen hinsichtlich gerecht und ungerecht, sittlich schön und sittlich hässlich, tapfer und feige und so weiter auf ihre Tragfähigkeit hin zu prüfen und seine Zuhörer und Gesprächspartner entsprechend zu ermahnen, nicht nachzulassen bei der Suche nach einem guten, einem gelingenden Leben.
Hiermit nun sind bereits die zwei Grundformen des sokratischen Philosophierens, sind die zwei Hauptformen seiner ‚Pädagogik‘ benannt: Prüfung und Ermahnung. Beides, so viel dürfte bereits deutlich geworden sein, sind im Grunde nur zwei einander ergänzende, komplementäre Aspekte und Stadien ein und desselben Prozesses: Die Ermahnung, die Frage danach, wie man leben soll, zur Richtschnur des Philosophierens zu machen, führt zur Prüfung der jeweils leitenden Lebensziele und -einstellungen. Und diese Prüfung ihrerseits mündet in die Ermahnung, sein Leben in Richtung auf das als richtig und falsch Erkannte hin auszurichten oder zu ändern.
Und beides, Prüfung wie Ermahnung, vollzieht sich – und das ist für das sokratische Philosophieren von entscheidender Bedeutung – im Gespräch, das um konkrete Lebensfragen oder -probleme kreist. Dieses Gespräch nun verläuft gemäß einer bestimmten Methode. Diese ist dadurch charakterisiert, dass der Gesprächsführer Sokrates – oder allgemeiner: der ‚Lehrer‘ – dem oder den Gesprächspartnern – den ‚Schülern‘ – keine fertigen Ergebnisse vorträgt, sondern sie durch geschickte Fragen dahin führt, aus eigener Einsicht Erkenntnisse zu gewinnen – und sei es auch nur, um zu erkennen, dass man bisher in einem Irrtum befangen war und etwas als wahr und richtig meinte erkannt zu haben, was sich jetzt, nach dem Durchsprechen seiner Ansichten, Meinungen und Überzeugungen mit anderen, als hinfällig erweist.
Sokrates selbst bezeichnete diese Methode, zu Einsichten zu gelangen, als Maieutik, als Hebammenkunst. So, wie Sokrates’ Mutter Phainarete, die von Beruf Hebamme war, leiblichen Kindern auf die Welt half, so hilft Sokrates mit seiner Methode der Gesprächsführung, für die Lebensführung relevante ‚geistige Kinder‘, sprich Einsichten und Lebenseinstellungen, zu entbinden.
Sieht man sich diese Methode einmal etwas näher an, so fällt auf, dass Sokrates die Gespräche, in die er seine Dialogpartner verwickelt, mit einer dem ersten Eindruck nach recht simplen, bei näherem Hinsehen jedoch äußerst folgenreichen Frage beginnt – der Frage: Was ist das? Diese Frage hat so vor Sokrates noch niemand gestellt. Und die Gesprächspartner, denen er sie stellt, glauben darauf schnell eine Antwort geben zu können. Aber gerade dabei unterschätzen sie die Brisanz, die diese schlichte Frage in sich birgt, geht ihnen doch erst nach und nach im weiteren Verlauf des Gesprächs auf, dass ihre rasche Antwort auf die Was-ist-das-Frage in nahezu allen Fällen eine allzu voreilig und unbedacht geäußerte war.
Das Setting in den sokratischen Dialogen ist dabei immer ähnlich. Da unterreden sich zwei oder mehrere Personen beispielsweise über Gerechtigkeit, Tapferkeit, Besonnenheit oder Frömmigkeit – über Aretai, Tugenden also, die im Leben der antiken Polis von besonderer Bedeutung sind. Und sie wähnen, bezüglich des jeweils betreffenden Gegenstands fundiertes Wissen zu besitzen. Sokrates nun, sich in das Gespräch einmischend, unterläuft solch vermeintlich sicheres Wissen mit der Was-ist-das-Frage. Gerechtigkeit: Was ist das? Tapferkeit: Was ist das? Besonnenheit: Was ist das? Frömmigkeit: Was ist das?
Nun stellt Sokrates die Was-ist-das-Frage nicht nur rein theoretisch als Aufforderung zu einer Definition, sondern er täuscht den Unwissenden vor, der sich angeblich belehren lassen will, obwohl er bereits davon überzeugt ist, dass die zu erwartenden Antworten voller Widersprüche und Ungereimtheiten sein werden. So gesehen ist die Was-ist-das-Frage schon vom Ansatz her mit Ironie aufgeladen: Sokrates verstellt sich – das griechische Wort eironeia, von dem sich unser Wort ‚Ironie‘ ableitet, bedeutet ursprünglich ‚Verstellung‘ und das Verb eironeuomai ‚sich im Reden verstellen‘. Und natürlich wittern die Gesprächspartner die Verstellung nicht und gehen Sokrates nur zu bereitwillig auf den Leim: Sie beantworten die Was-ist-das-Frage nämlich für gewöhnlich mit einem oder mehreren, mehr oder wenig zufällig aufgegriffenen Beispielen. Aber das ist ja gerade nicht das, auf was die Was-ist-das-Frage abzielt, denn die hat eine Wesensdefinition, hat einen allgemeinen Begriff im Visier. Und so fragt Sokrates weiter. Dieses bohrende Weiterfragen zwingt die Gesprächspartner dazu, Rechenschaft über ihre Antworten zu geben, das heißt Gründe beizubringen. Dabei werden im Fortgang des Gesprächs Folgerungen entwickelt, welche die Problematik, Fragwürdigkeit und letztendliche Haltlosigkeit der aufgestellten Behauptungen immer deutlicher werden lassen. Und so dämmert den Dialogpartnern mehr und mehr die Erkenntnis, dass sie, die doch zu Beginn der Debatte meinten, hinsichtlich der infrage stehenden Angelegenheit bestens Bescheid zu wissen, im Grunde genommen gar nichts wissen.
Nun wissen sich die solcherart Bloßgestellten in den sokratischen Dialogen an solchen Wendepunkten des Gesprächs in der Regel mit weiteren Strategien zu helfen, auf die sie ihre Hoffnungen setzen: Entweder weichen sie auf andere Thesen aus, die bislang noch gar nicht diskutiert worden sind und deren Wahrheit sie dogmatisch behaupten, oder aber sie weigern sich schlicht, sich auf ein weiteres gemeinsames Gespräch einzulassen. Mit beiden Strategien aber verweigern sie sich eben dem Ziel, auf das es der sokratischen Pädagogik neben der Gewinnung von Gegenstandswissen entscheidend ankommt: der Selbsterkenntnis nämlich. Akzeptieren die Partner hingegen die Weiterführung des Gesprächs und versucht man gemeinsam eine verbesserte Antwort auf die Was-ist-das-Frage zu gewinnen, dann nähert man sich im günstigsten Fall einem verbesserten Begriff der zur Diskussion stehenden Sache, will sagen, einem Begriff von höherem Allgemeinheitsgrad. Damit hat der Betreffende zugleich, so ist Sokrates überzeugt, einen wichtigen Schritt in Richtung Selbsterkenntnis gemacht.
Jedoch sind auch die verbesserten Ergebnisse, welche die Überprüfung des vermeintlich sicheren Wissens erbringt, nie endgültig. Aber immerhin vermitteln sie die Einsicht, dass sie den ursprünglich geäußerten Vorstellungen überlegen und näher an der Wahrheit sind. Am Ende bleibt die Begriffserkenntnis offen und aporetisch: ohne letztgültige Lösung. Sicheres Gegenstandswissen konnte nicht gewonnen werden. Und da die sokratische Methode Begriffserkenntnis und Selbsterkenntnis aufs Engste miteinander verschränkt, bleibt auch die Selbsterkenntnis auf der Strecke: Das einzig sichere Wissen, das müssen die Gesprächsteilnehmer mehr oder weniger schmerzlich erkennen, besteht darin, dass sich das, was sie sicher zu wissen meinten, als Nichtwissen entpuppt hat. Mit anderen Worten: Die Selbsterkenntnis der Gesprächspartner hat insofern einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht, als ihnen am Ende des Gesprächs mit Sokrates wenigstens eines gewiss ist: Ihre ursprüngliche Selbstsicherheit hat sich unter der Hand in Nichts aufgelöst. Immerhin wissen sie jetzt um ihr Nichtwissen!
Lassen wir es nicht bei diesem formalen Gerüst der sokratischen Pädagogik bewenden und füllen wir es mit Leben, indem wir uns den tatsächlichen Verlauf eines sokratischen Gesprächs vergegenwärtigen, wie Platon ihn uns in seinen Frühdialogen überliefert hat. Ich schlage dazu vor, den Dialog Laches heranzuziehen, weil er nach Meinung von Sokrates-Forschern und Platon-Kennern als die beste Darstellung eines sokratischen Dialogs gelten kann. In diesem Dialog unterredet sich Sokrates mit Laches und Nikias, zwei als tapfer bekannten Feldherren. Diese beiden Feldherren sind von zwei vornehmen Athenern – Lysimachos und Melesias – gefragt worden, ob sie ihren Söhnen Fechtunterricht geben sollen. Anlass dazu bot ihnen eine Art Schaufechten, dem sie als Zuschauer beigewohnt haben. Und nun fragen sie sich, ob sie ihre Söhne in der Kunst des Fechtens ausbilden lassen sollen. Und wer wäre besser geeignet, diese Frage zu entscheiden als die zwei verdienten, kampferprobten Feldherren? Nikias und Laches jedoch sind hinsichtlich der Fechtkunst unterschiedlicher Ansicht. Während Nikias sie befürwortet und ihren Nutzen mit einer Reihe von Argumenten unterstreicht, erachtet Laches sie demgegenüber für unnütz und gefährlich. Also wird Sokrates in das Gespräch einbezogen, um als eine Art Schiedsrichter in dieser Angelegenheit zu vermitteln und zu entscheiden, wer von beiden das Richtige sagt. Sokrates jedoch gibt dem Gespräch sofort eine charakteristische Wendung: Er lenkt es weg von der konkreten Frage nach Sinn und Nutzen des Fechtunterrichts und hin auf die allgemeine Frage nach der Tugend (Areté). Freilich sieht Sokrates selbst, dass es zu viel verlangt ist, nach der ganzen Tugend zu fragen – dieses Geschäft, so sagt er, wäre zu groß –, sodass man sich darauf verständigt, zunächst etwas über einen Teil der Tugend in Erfahrung zu bringen. Da nun die Kunst des Fechtens ganz wesentlich auf die Tapferkeit abzuzwecken scheint, einigt man sich darauf, sie zum Gegenstand der Erörterung zu machen. „Dieses also“, hält Sokrates, an Laches gewandt, fest, „wollen wir zuerst versuchen zu erklären, was die Tapferkeit ist; dann aber nach diesem auch überlegen, auf welche Art sie den Jünglingen beizubringen wäre, soweit es nämlich möglich ist, sie durch Übung und Unterricht beizubringen. Also versuche nun, wie ich sage, zu beschreiben, was Tapferkeit ist“.22
Was also ist Tapferkeit? Diese Frage zu beantworten scheint den Teilnehmern ein Leichtes zu sein. Denn schließlich stehen mit Nikias und Laches zwei gestandene Feldherren Rede und Antwort, die im Kampf wiederholt ihre Tapferkeit unter Beweis gestellt haben. Und auch Sokrates, so berichtet Laches, habe sich in den Kämpfen Athens als tapfer erwiesen: Hätten einst bei Delion alle so tapfer gefochten wie Sokrates, dann wäre die Schlacht für Athen nicht so unglücklich und schmählich ausgegangen.23
Laches also wirft sich in die Brust und antwortet auf Sokrates’ Frage, was Tapferkeit ist: „wenn jemand pflegt in Reih und Glied standhaltend die Feinde abzuwehren und nicht zu fliehen, so wisse, daß ein solcher tapfer ist“.24
Diese Antwort indessen entspricht nicht dem, wonach Sokrates gefragt hat. Mit unverkennbar ironischem Unterton nimmt er selbst die Schuld dafür auf sich, dass Laches seine Frage nicht in der Weise beantwortet hat, die er im Sinn hatte. Womöglich, erklärt Sokrates, habe er nicht deutlich genug gefragt. Zwar versteht Laches noch nicht, worauf Sokrates hinaus will, doch der versucht es durch weitere Fragen zu verdeutlichen. Wenn nämlich, so legt er auseinander, wie Laches behauptet, derjenige tapfer ist, der in Reih und Glied standhaltend gegen die Feinde ficht, wie verhält es sich dann mit demjenigen, welcher fliehend gegen die Feinde kämpft, und nicht standhaltend? Zur Verdeutlichung verweist Sokrates auf die Kampftaktik der Skythen, deren Reiter in einem steten Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung kämpfen. Dieses Verhalten steht ebenso im Gegensatz zu der von Laches vorgebrachten Definition von Tapferkeit, wie das der Spartaner, die bei Plataiai den großen Sieg dadurch erfochten haben, dass sie zunächst scheinbar die Flucht ergriffen und dann umkehrend die Perser besiegt haben. Sind Skythen und Spartaner mithin nicht als tapfer anzusehen?
Als erfahrener Feldherr weiß Laches, dass die unterschiedlichen Truppenarten auf unterschiedliche Weise kämpfen. Und so kommt er nicht umhin, auch die Kampftaktik der Skythen und Spartaner als tapfer zu qualifizieren, und er sieht ein, dass sich seine Definition nur auf die Hopliten, das schwerbewaffnete griechische Fußvolk, bezieht.
So ist die Was-ist-das-Frage des Sokrates lediglich mit einem Beispiel beantwortet worden, einem Beispiel zudem, das, wie Laches einräumt, die aufgeworfene Frage nicht einmal ansatzweise beantworten kann. Und so hakt Sokrates nach: „ich wollte nicht nur erfahren, welches die Tapfern im Fußvolke wären, sondern auch in der Reiterei und in allem, was zum Kriege gehört; und nicht nur die im Kriege, sondern auch die Tapfern in den Gefahren der See, ferner auch die, welche in Krankheiten und in Armut und in der Staatsverwaltung tapfer sind, ja noch mehr, nicht nur die gegen den Schmerz tapfer sind und gegen die Furcht, sondern auch die gegen Begierden und Lust stark sind zu fechten, und zwar sowohl standhaltend als auch umwendend“.25 Kurz und gut, Sokrates geht es nicht um eine einzelne Art von Tapferkeit, also nicht um die Tapferkeit des Fußvolks oder die der Reiter. Ihm geht es vielmehr um die Tapferkeit als solche, um den allgemeinen Begriff von Tapferkeit, denn Tapferkeit gibt es nicht nur im Krieg und in der Schlacht, sondern auch im zivilen, politischen Leben, in Armut, Krankheit und Furcht, wie überhaupt ihn vielen anderen Situationen. Was ist das nun: die Tapferkeit, die in allen diesen vielen verschiedenen Situationen und Lebenslagen immer dieselbe ist?
Laches, durch den bisherigen Gang der Unterredung offenkundig unsicher und vorsichtig geworden, zögert und gibt zu, noch nicht so genau zu wissen, auf was Sokrates hinaus wolle. Um ihm auf die Sprünge zu helfen, erläutert Sokrates den Sinn seiner Frage anhand eines Vergleichs. Ebenso wie bei der Tapferkeit gibt es auch vielerlei Arten von Geschwindigkeit, sodass man auch hier fragen kann: Was ist Geschwindigkeit? Hierbei will man nicht nur wissen, was Geschwindigkeit im Laufen, im Reden, im Lernen, in der Musik und in vielen anderen Dingen ist, sondern man will wissen, was die Geschwindigkeit als solche ist, insofern sie in all diesen Dingen immer dieselbe ist. Darauf könnte man, wie Sokrates vorschlägt, antworten: Geschwindigkeit ist ein Vermögen, in kurzer Zeit vieles zu vollbringen. Damit hätte man eine allgemeine Antwort auf die Frage: Was ist Geschwindigkeit?
Analog wird eine allgemeine Bestimmung für die Tapferkeit als solche gesucht, also eine Bestimmung, die in all den genannten Fällen zutrifft: im Kampf des Fußvolks ebenso wie im Kampf der Reiterei, in Armut und in Krankheit, im Staatsleben wie im Umgang mit Furcht, Lust und Begierden. Um diesen Anforderungen Genüge tun zu können, schlägt Laches eine erweiterte Bestimmung vor: Wenn die Natur der Tapferkeit in all diesen Fällen dieselbe sein soll, dann könne man sie als eine gewisse Beharrlichkeit der Seele bestimmen. Aber auch diese Bestimmung wird von Sokrates einer kritischen Prüfung unterzogen. Nicht jede Beharrlichkeit, so wendet er gegen Laches ein, könne als Tapferkeit gelten. Er, Laches, rechne die Tapferkeit doch wohl zu den vortrefflichen Dingen und setze offenbar voraus, gut und vortrefflich sei die Beharrlichkeit mit Verstand. Als Laches dies bejaht, weist Sokrates ihn darauf hin, eine solche Bestimmung könne nicht allgemeingültig sein, denn es gebe doch auch eine Beharrlichkeit in törichten Dingen, etwa bei der Verschwendung oder beim Geiz. Laches räumt auch das bereitwillig ein. Angeleitet durch Sokrates’ kritische Prüfung aller bislang vorgeschlagenen Definitionsversuche versucht er sich an einer dritten Bestimmung. Tapferkeit, so setzt er jetzt fest, sei eine verständige Beharrlichkeit. Aber auch diese Bestimmung hält der kritischen Durchmusterung nicht stand, gibt es doch Fälle von verständiger Beharrlichkeit, wie Sokrates ausführt, die keineswegs tapfer genannt werden können.
Laches, so scheint es, ist mit seinem Latein zunächst einmal am Ende. Und so greift denn nun auch Nikias in die Unterredung ein, und es entwickelt sich ein Gespräch zwischen Sokrates, Laches und Nikias. Nikias führt es weiter mit der These, Tapferkeit sei Erkenntnis des Gefährlichen und Unbedenklichen. Aber wie immer man diese Definition im weiteren Fortgang auch hin und her wendet – Sokrates zeigt immer wieder, dass keiner der Bestimmungsversuche einer gründlichen Prüfung standhält: Entweder ist die vorgeschlagene Bestimmung zu eng, wie die von Laches vorgebrachte erste, oder aber sie ist zu weit, wie die zweite und dritte.
So endet das Gespräch, nachdem sich keine der vorgeschlagenen Bestimmungen als stichhaltig und allgemeingültig und richtig hat erweisen lassen, aporetisch, ohne definitive Lösung. Sokrates hat während des ganzen Gesprächs immer nur gefragt und nachgehakt und sich selbst jeglicher Behauptung enthalten. Und so stellt er abschließend fest: „Wir haben also nicht gefunden, o Nikias, was die Tapferkeit ist?“, worauf dieser antwortet: „Wir scheinen nicht“26. Und dennoch erbringt das Gespräch mit Sokrates für alle Beteiligten insofern einen Erkenntnis gewinn, als sie doch jetzt zumindest wissen, dass ihr Wissen hinsichtlich der Tapferkeit hinfällig ist, dass sie, anders gesagt, doch jetzt so viel wissen, dass sie nichts wissen. Das hat Sokrates ihnen klar gemacht. Und eben dieses Wissen des Nichtwissens vermag zur Fortsetzung der Auseinandersetzung mit dem anstehenden Problem anzustacheln. Daher erklärt Sokrates in der Regel gegen Ende solcher Gespräche ausdrücklich, man werde die Frage später wieder aufnehmen. Und so verabredet man für gewöhnlich eine Fortführung des Gesprächs. Eben dieser aporetisch-offene Schluss der sokratischen Gespräche, das Fehlen eines definitiven Endergebnisses, sodass am Schluss eine Frage stehen bleibt, „erregt“, wie Werner Jaeger es einmal auf den Punkt gebracht hat, „im Leser eine philosophische Spannung, die von höchster erzieherischer Wirkung ist“27.
Diese sokratische Methode des Fragens und Prüfens mit dem Ergebnis eines wissenden Nichtwissens hat Sokrates auch in seinem eigenen Leben angewandt. Von Athener Bürgern der Gottlosigkeit und Jugendverderbung angeklagt und vor Gericht gestellt, verteidigt er sich eben dort, indem er betont, das einzige Wissen, über das er verfüge, sei sein Nichtwissen. Das ist natürlich auch insofern ein geschickter taktischer Schachzug, als Sokrates vom Orakel in Delphi in die prekäre Situation gebracht worden war, niemand sei weiser als er. Also nutzt Sokrates seinen Auftritt vor Gericht – den Platon in seiner Apologie, der Verteidigungsrede des Sokrates, geschildert hat –, um den delphischen Orakelspruch zu prüfen. In einem ersten Schritt nimmt er das in Angriff, indem er sein Wissen und seine Weisheit mit dem- und derjenigen der Staatsmänner vergleicht. In einem Gespräch mit einem namentlich nicht genannten Staatsmann ergibt sich ihm der Eindruck, dieser Mann scheine vielen anderen als sehr weise vorzukommen, am meisten aber offenbar sich selbst. Entsprechend den Grundlinien seiner ‚Pädagogik‘ versucht Sokrates, ihm zu zeigen, er, der Staatsmann, glaube zwar, weise zu sein, er wäre es aber nicht. Kein Wunder daher, dass sich Sokrates dadurch bei ihm und vielen der bei dem Gespräch Anwesenden verhasst macht! Als Sokrates von ihm fortging, so berichtet er, habe er so bei sich gedacht, weiser als dieser Mann sei er doch offensichtlich allemal. Denn wenn auch keiner von ihnen beiden etwas Tüchtiges oder Besonderes wissen möge, so meine doch dieser etwas zu wissen, obwohl er nichts weiß; er, Sokrates, hingegen, der eben nichts wisse, meine nun auch nicht etwas zu wissen. Und so sinniert Sokrates: „Ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein als er, daß ich, was ich nicht weiß, auch nicht glaube zu wissen.“28 Im Bewusstsein dieses Wissens begibt sich Sokrates zu einem anderen Staatsmann, der als noch weiser als der erste gilt. Aber auch hier erbringt das prüfende Gespräch das gleiche Resultat.
Ähnlich ergeht es Sokrates mit den Dichtern und den Handwerkern, mit denen er sich auseinandersetzt, um sich selbst, wie er sagt, durch die Tat zu überführen als unwissender denn sie. Bei den Dichtern nun stößt ihm sehr rasch auf, dass sie glauben, um ihrer Dichtung willen auch in allem übrigen sehr weise Männer zu sein. Tatsächlich jedoch waren sie es nicht, wie Sokrates ernüchtert feststellen muss. Und so geht er auch von den Dichtern fort mit dem Glauben, sie um dasselbe zu übertreffen wie die Staatsmänner.
Wie sieht es nun mit den Handwerkern aus? Nun, zunächst einmal wussten sie, wie Sokrates unumwunden einräumt, wirklich vieles, was er nicht wusste. Insofern waren sie in der Tat weiser als er. Aber diese „trefflichen Meister“ hatten gleichwohl denselben Fehler wie die Dichter: Weil ein jeder seine Handwerkskunst gründlich erlernt hatte und insofern tatsächlich viel wusste, beanspruchten die Handwerker, auch hinsichtlich anderer Dinge und Angelegenheiten, die mit ihrer Kunst nichts zu tun hatten, über Wissen und Weisheit zu verfügen. In Sokrates’ Augen ist das indessen Torheit, eine Torheit zumal, die ihre Weisheit verdeckt. Und so fragt sich Sokrates, was er wohl lieber sein möchte: so sein, wie er ist, gar nichts verstehend von ihrer Weisheit und auch nicht behaftet mit ihrem Unverstand, oder aber in beiden Hinsichten so wie sie. Für den Mahner und Prüfer Sokrates liegt die Antwort natürlich auf der Hand: „Da antwortete ich denn mir selbst und dem Orakel, es wäre mir besser, so zu sein, wie ich bin“29. Von hierher ergibt sich für ihn als Fazit seiner Selbstprüfung: „Unter Euch, ihr Menschen, ist der der Weiseste, der wie Sokrates einsieht, daß er in der Tat nichts wert ist, was die Weisheit anbelangt.“30
Ohne Frage ist dieses Resümee hoch ironisch aufgeladen, und Sokrates zieht damit erst recht den Zorn und den Hass eines Teils der Richter und der Volksmenge auf sich. Aber er lehrt und lebt eben das, was er aufgrund gründlicher Prüfung als das Rechte und Richtige glaubt erkannt zu haben – und sei es auch um den Preis, dass er dafür mit dem Tod bestraft und hingerichtet wird. Diese kompromisslos und bis zur letzten Konsequenz durchgehaltene Einheit von Lehre und Leben ist sicherlich einer der markantesten Charakterzüge des Erziehers Sokrates. Von dieser Einheit abzurücken, das käme dem Sokrates, den die Zeitzeugen schildern, niemals in den Sinn. Und das gilt für ihn auch und gerade im Angesicht des Todes. Von dem Gericht in Athen zum Tod durch Schierlingsgift verurteilt, wartet Sokrates, wie Platon in seinem Dialog Kriton berichtet, im Gefängnis auf seine Hinrichtung. Kriton, ein alter und vertrauter Freund, besucht ihn dort. Es ist früher Morgen, fast noch Nacht; der letzte Tag des Sokrates auf Erden bricht an. Kriton ist gekommen, um den Freund ein letztes Mal zur Flucht zu bewegen. So manch ein Athener wird in der Zwischenzeit das Unrecht eingesehen haben, das Sokrates mit der Verurteilung zugefügt worden ist. Und in Athen scheint man geradezu darauf zu warten, dass Sokrates flieht und seine einflussreichen Freunde ihm zur Flucht verhelfen.
An diesem Morgen nun unternimmt Kriton einen letzten Versuch in diese Richtung. Geld und Helfer, so versichert er Sokrates, stünden bereit, von den Behörden drohe kaum Gefahr und er, Sokrates, werde auch außerhalb Athens überall Helfer und Gastfreunde finden. Zudem behielten seine Kinder ihren Vater und sie erhielten eine gute Ausbildung. All das jedoch vermag Sokrates nicht umzustimmen. Dem beinahe flehentlichen Bitten und Drängen des Freundes, sich doch zur Flucht bewegen zu lassen, hält er seine ihn leitende Lebensmaxime entgegen: „Denn nicht jetzt nur, sondern schon immer habe ich ja das an mir, daß ich nichts anderem von mir gehorche als dem Satze [logos], der sich mir bei der Untersuchung als der beste zeigt. Das aber, was ich schon ehedem in meinen Reden festgesetzt habe, kann ich nun nicht verwerfen, weil mir dieses Schicksal geworden ist; sondern jene Reden erscheinen mir noch ganz dieselben, und ich schätze und ehre sie noch ebenso wie vorher.“31 Und im weiteren Verlauf der Unterredung erinnert er Kriton an die Prinzipien, an denen er sein bisheriges Leben ausgerichtet hat: Unter keinen Umständen solle man Unrecht begehen, niemals Unrecht mit Unrecht vergelten, niemandem Schaden zufügen oder Schaden mit Schaden vergelten, wie überhaupt niemanden schlecht behandeln. Flucht nun wäre, wie Sokrates weiter erklärt, ein Unrecht. Zwar mag auch die Verurteilung ein Unrecht sein, aber in Anbetracht der aufgeführten Prinzipien werde durch seine Flucht ein Unrecht mit Unrecht vergolten. Zudem dürfe eine gültige Entscheidung des Gerichts, selbst wenn sie ungerecht ist, nicht ohne Weiteres durch einen Einzelnen durch Flucht gewissermaßen korrigiert werden. Denn wichtiger als das Leben selbst, schärft Sokrates seinem alten Freund ein, sei ein Leben nach sittlichen Maßstäben – und eben die ließen ungerechtes Handeln, im vorliegenden Fall: seine Flucht, nicht zu. Auf diese Weise hält Sokrates unbeirrt an seiner Grundüberzeugung fest, der Tod sei ein geringeres Übel als dasjenige, Unrecht zu tun.
Eine solch entschiedene Treue gegenüber den Gesetzen mag unserem heutigen Verständnis von Demokratie und Staatsverfassung einigermaßen befremdlich erscheinen. Zudem werden sich wohl nur die wenigsten zu der sokratischen Maxime bekennen, es sei besser, Unrecht zu erdulden als Unrecht zu begehen. Und Sokrates selbst ist sich, wie er in dem Gespräch mit Kriton bekennt, sicher: „Ich weiß wohl, daß nur wenige dieses glauben und glauben werden.“32 Gleichwohl lässt er sich von dem einmal eingeschlagenen Weg, der ihm aufgrund reiflicher Überlegung und Prüfung der Alternativen als der einzig rechte und richtige erscheint, durch schlechterdings nichts – auch durch eine Todesandrohung nicht – abbringen. Und so erleben wir selbst im Angesicht des Todes einen gelassenen, mit seinem Lebenswerk zufriedenen Sokrates.
Sicherlich kommt in der Haltung des Sokrates und ihrer Begründung ein, modern gesprochen, ausgeprägter ‚ethischer Idealismus‘ zum Ausdruck, den manch Heutiger mit Argwohn beäugen wird. Aber dennoch beruht über die Jahrtausende hinweg die Faszination, die Sokrates ausstrahlt, und die Wirkung, die er als Erzieher ausübt, zum überwiegenden Teil auf der von ihm vorgelebten Einheit von Lehre und Leben, die sich auf eben solch ethischen Idealismus gründet.
Gegenüber dem sophistischen Bildungsideal ändert der Begriff der Paideia damit bei Sokrates sein Wesen. Werner Jaeger fasst diese Veränderung prägnant zusammen, wenn er feststellt: „Bildung im sokratischen Sinne wird zum Streben nach philosophisch bewußter Lebensführung, die auf das Ziel gerichtet ist, die geistige und sittliche Bestimmung des Menschen zu erfüllen. Der Mensch ist in diesem Sinne zur Paideia geboren. Sie ist sein einzig wahrer Besitz.“33
Und zur Illustration dieses letzten Aspekts zieht er jenes schöne Wort des Philosophen Stilpon, eines Hauptvertreters der durch Euklid gegründeten sokratischen Schule in Megara, heran. Als der Makedonenkönig Demetrios Poliorketes nach der Eroberung Megaras im Jahre 307 v. Chr. Stilpon eine Gunst erweisen und ihn für die Plünderung seines Hauses entschädigen wollte, forderte er ihn auf, eine Zusammenstellung seines gesamten abhandengekommenen Besitzes einzureichen. Stilpon antwortete ihm darauf in bester sokratisch-ironischer Manier: „Die Paideia hat keiner aus meinem Hause getragen.“34