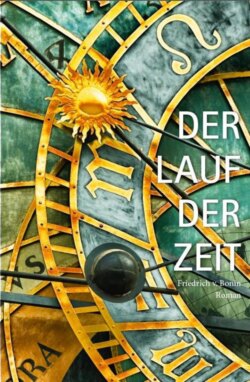Читать книгу Der Lauf der Zeit - Friedrich von Bonin - Страница 6
II. Jugend
Оглавление1.
Bruno von Halcan wurde ein Jahr nach dem Weltkrieg geboren. Das sagt sich leicht, war aber Mitte des 20. Jahrhunderts schon interpretationsfähig: nach welchem Krieg? Die Weltkriege zeichneten das Jahrhundert aus. Obwohl die Europäer schon immer miteinander Kriege geführt hatten, wurden diese beiden als Weltkriege bezeichnet, weil praktisch die ganze Welt darin verflochten war oder jedenfalls das, was die Europäer, die die Welt immer noch aus dem Blickwinkel Mitteleuropas sahen, dafür hielten. Bruno jedenfalls wurde nach dem zweiten Weltkrieg geboren.
Er gehörte der zweiten Löwengeneration nach dem Krieg an, für diejenigen, die Astrologie mögen. Als Löwe im Aszendenten des Löwen geboren. Und die den Löwen nachgesagten Eigenschaften würden ihn, ob man an die Interpretationen der Sternzeichen glaubte oder nicht, sein Leben lang begleiten: Gutartiges Angebertum, Großzügigkeit, Neugier und ein sonniges Gemüt.
Seine ersten Lebensjahre verbrachte Bruno in einer Nissenhütte am Rande eines winzigen Dorfes, Neuburgheim, im westlichsten Westdeutschland. Seine Eltern waren Kriegsverlierer, wie es auch Kriegsgewinner gab, sein Vater war der Erbe eines kleinen Gutes jenseits der Oder-Neiße-Linie gewesen, wie man die Grenze zwischen Polen und Deutschland damals nannte. Klein war das Gut nur nach jenen Maßstäben gewesen, mit denen man in dieser Gegend vor dem Kriege maß, kleine 6.000 Morgen, davon 4.000 Morgen Wald und 2.000 Morgen Ackerland, insgesamt 1.500 Hektar. Das nächstgrößere Gut hatte ungefähr 10.000 Morgen gehabt, auch das war noch ein kleines Gut nach den dort geltenden Verhältnissen. In Neuburgheim, wo Bruno aufwuchs, hatte der Großbauer, wie er genannt wurde, 80 Morgen, deshalb konnte sich Bruno zeitlebens an die Größenordnungen, in denen seine Eltern dachten, nicht gewöhnen.
Brunos Vater war im Krieg gewesen, als die Russen in die Nähe des väterlichen Gutes kamen; seine Mutter floh, das war 1945, mit einem kleinen Sohn und schwanger mit Brunos Schwester, sie floh aber nicht, bevor sie nicht das Familiensilber mit „Mamsell“, der vertrauten langjährigen Köchin des Gutes, im Garten vergraben hatte. Die Herrschaft der russischen Armee konnte ja nicht von langer Dauer sein, dachten sie, dann kam man wieder und hatte das Silber gerettet.
Die Qualen seiner Eltern in dieser Zeit hat Bruno sich nie vorstellen können. Seine Mutter, hochschwanger, im Ungewissen über das Schicksal ihres Ehemannes im Krieg, machte sich auf den Weg nach Westen, immer vor der russischen Armee her. Aber die Verkehrsmittel, Bahn und Pferdefuhrwerk, hatten nicht gerade auf Brunos Mutter gewartet, sondern wurden dazu eingesetzt, die geschlagene deutsche Armee nach Westen zu bringen, man hatte keinen Platz für alleine fliehende Frauen.
„Da kam mir zugute, dass ich schwanger war und die Regierung die Förderung arischen Nachwuchses immer noch auf ihrem Programm hatte“, erzählte sie später immer und immer wieder, „die Offiziere, die ich um Hilfe bat, ließen mich in den Armeezügen mitfahren, aber nie gerade nach Westen, sondern immer dahin, wo die Armee sich gerade hinbewegte. So kam ich dann im Februar nach Neustrelitz, in der Nähe von Rostock, da wurde deine Schwester geboren, auf dem Bahnhof.“
Als Bruno diese Geschichte zum ersten Mal hörte, war sie eine Geschichte wie jede andere auch. Erst als junger Mann verstand er die Bedeutung des Programms „Förderung des arischen Nachwuchses“ , noch später sah er die Bilder von Flüchtlingen, die zu Fuß, mit Karren, über die vereiste Ostsee flohen und wie sie reihenweise starben und begriff das unendliche Leiden, aber immer mit dem Gedanken, dass das Volk litt, das Wind gesät hatte und nun den Sturm erntete. Viel Lebenszeit war nochmal erforderlich, um menschliches Leid unabhängig von Schuld zu sehen und es mitempfinden zu können.
Das Leiden seines Vaters war subtiler, schuldbeladener und möglicherweise brutaler, wenn ein solcher Vergleich überhaupt möglich ist, ein Leiden, das er nie zeigte. Er war von seinem 22. bis zum 28. Lebensjahr als Offizier im Krieg gewesen, trug mit Stolz ein Ritterkreuz, hatte den Krieg vielleicht, so jedenfalls nach Brunos späterem Eindruck, als Möglichkeit zum Abenteuer begrüßt, aber dann offenbar doch zu viel gesehen. Er versuchte sich die Schmerzen von der Seele zu reden, indem er seine Heldentaten aus dem Krieg erzählte, die aber wollte nach kurzer Zeit keiner in seiner Umgebung mehr hören, da vergrub er sie. Nur in der Nacht stöhnte, schluchzte und schrie der Mann, der seine Leiden, die Leiden der anderen, die Bilder des Krieges nicht loswerden konnte. Bruno lernte, als er heranwuchs, einen Soldaten aus dem Weltkrieg kennen, der in Russland in Gefangenschaft gewesen war, spät und todkrank zurückkehrte und nie über den Krieg redete, er sprach eigentlich gar nicht mehr. Der, so hatte Bruno jahrzehntelang gedacht, hatte wirklich gelitten, war das Opfer seines Vaters gewesen, der ja nur Heldentaten erlebt hatte. Auch diesmal brauchte es wieder viel mehr Lebenszeit, um beide Männer als Leidende zu erkennen.
2.
Die Nissenhütte war beengt: zwei Räume unter einem rund geformten Wellblechdach, ohne Isolierung, mit einem Ofen in einem der Räume, der andere bitterkalt im Winter, beide heiß in warmen Sommern. Auf der einen Seite ein Kanal, der zwei Flüsse miteinander verband, aber nur selten von Schiffen befahren wurde, auf der anderen unkultiviertes Moor. Hierhin hatten sich die Eltern aus „Angst vor den Russen“ geflüchtet, wie sie jedenfalls Bruno und seinen Geschwistern erzählten, deren es bald drei gab: der ältere Bruder, der die Flucht mitgemacht hatte, war kurz nach Geburt der Schwester gestorben, Bruno erinnerte sich nicht an ihn. Die Schwester, Hanna genannt und ein Jahr älter als Bruno, war schon da. Es kamen noch zwei Brüder, Malte, zwei Jahre jünger und Hendrik, drei Jahre jünger als Bruno.
So wuchs er mit seinen Geschwistern heran. Sein Vater betrieb neben der Nissenhütte eine Gärtnerei, deren Produkte er in einem winzigen Bretterladen im Dorf verkaufte. Dorthin kam er mit dem Motorrad, Gangschaltung am Tank. Bruno wusste die Marke nicht mehr. Auf diesen Fahrten durfte er vorne auf dem Tank sitzen, zwischen den starken Armen des Vaters, die den Lenker hielten. Ein Gefühl der Geborgenheit überkam ihn jedes Mal, ihm konnte nichts passieren, die Welt war außen, er innen. Aber dann wurde sein Bruder Malte alt genug, um auch auf dem Motorrad mitgenommen zu werden. Der Platz auf dem Tank gehörte ab sofort dem Bruder. Bruno durfte auch mitfahren, allerdings hinter dem Vater auf dem Soziussitz. Er fühlte sich nicht mehr geschützt vor der Welt, sie konnte ihn erreichen. Eifersucht auf den Bruder mischte sich mit Stolz, dass sein Vater ihn wohl für groß genug hielt, auf dem Sozius zu sitzen.
3.
Neuburgheim hieß das kleine Dorf, das in der Nähe lag. Es war wie viele andere auch nach dem Krieg rasend schnell gewachsen, wegen der Flüchtlinge, die gleich seinen Eltern vor den Russen so weit wie möglich nach Westen geflohen waren. 2.500 Einwohner zählte die kleine Ortschaft, als alle Flüchtlinge angekommen waren.
Von der Nissenhütte führten zwei Anfahrten dahin, einer rechts und einer links neben dem Kanal, Vater und Mutter nahmen immer den linken, keiner wusste, warum, beide waren mit dickem Sand belegen, für die Pferdefuhrwerke, die Hauptwege von den Fuhrwerken tief ausgefahren, in zwei Spuren. Wenn man mit dem Fahrrad oder Motorrad in eine dieser tiefen Furchen kam, stürzte man unweigerlich, es schlingerte so lange, bis man lag. Deshalb gab es daneben schmale Spuren für Fahrrad und Motorrad, zwar auch Sand, aber immerhin fester und ohne tiefe Rillen.
Zwischen dem Damm für die Fuhrwerke und der Spur für Fahrräder war eine kleine Hecke aus Buschwerk, rechts neben dem Fahrradweg begann das undurchdringliche Schilf, das bis hinunter zum Kanal wuchs.
Jenseits der breiteren Strecke gab es eine erneute Böschung, diesmal aufwärts, etwa fünf Meter, die gesamte Erhöhung war mit Kiefern und Birken bestanden, unten mit Buschwerk, durch das man sich zwängen musste, wollte man auf den Hügel klettern. Alles stand auf losem sandigem Boden. Im Sommer gaben Büsche und Bäume starken Schatten, man fuhr nie in der prallen Sonne. Das Dickicht lebte: Es gab Vögel aller Art, Amseln, Lerchen, Stare, Spatzen natürlich, und nachts Nachtigallen, dann Kaninchen, Hasen, Mäuse, Ratten und Schlangen.
Der Kanal war voll mit Fischen. Obwohl sauber, war das Wasser nie klar, weil es mitten im Moor lag.
Einsam, mit nach innen gerichtetem Blick, saß der verlassene Bruno an dem Esstisch in seiner Villa in Göttingen und erinnerte sich. Erinnerte sich des kleinen Jungen hinter dem Vater auf dem Soziussitz und weinte vor Einsamkeit und Mitleid mit diesem kleinen Jungen und seinem einsamen Sitz auf dem Motorrad, während die starken schützenden Arme des Vaters vor ihm seinen Bruder hielten, nicht ihn.
Und indem er merkte, dass er in dem kleinen Jungen sich selbst betrauerte, sah Bruno klar und deutlich die Wagenspuren auf dem trockenen Sand des Kanalweges, sah sie, wie sie aufeinander zuliefen, sich vereinigten und sich wieder trennten, aber immer auf dem gleichen Weg blieben und verstand in plötzlicher Klarheit, wie die Spuren seinem Leben glichen, das seine Spur zog, er Margarete begegnete, sich von ihr trennte, ihr erneut begegnete. Immer wieder hatte er in seinem Leben gewonnen und verloren, wie im Spiel, nur, dass es mehr schmerzte als ein Spiel.
Zwei Brücken führten über den Kanal. Von der Nissenhütte benutzte man die erste, um in das Dorf zu kommen, das auf der anderen Seite des Kanals lag. Sie waren beweglich, man konnte sie mit einer Kurbel anheben und dann zur Seite schieben, so dass Schiffe hindurch fahren konnten. An beiden Übergängen gab es Bauern, die den Mechanismus bedienten. Wenn Bruno über den Kanal musste, ging er absichtlich langsam. Immer hoffte er, es würde ein Schiff kommen und der Brückenwärter die Brücke öffnen.
Im Winter war der Kanal zugefroren, helles Eis lud zum Begehen ein, im Sommer war er eine stille Idylle, freundlich und warm.
Auf der anderen Seite der Hütte, vom Dorf weg gelegen, begann unendliches Moor, von kleinen Ansammlungen von Kiefern, Birken, wohl auch Erlen, unterbrochen. In diesen Wäldchen gab es mehr Wild. Das Sumpfgebiet selbst war gefährlich und unheimlich, Hochmoor, nicht kultiviert, mit Löchern, die tief waren, so tief, dass man drin ertrinken konnte. Die konnte man aber sehen, gefährlicher waren die unsichtbaren und unsicheren Stellen, die erst dann in unergründliche Tiefen absanken, wenn man darauf trat und sie mit Gewicht belastete. Dunkel war es hier und unheimlich, selbst im Sommer. Manchmal, wenn man auf den sicheren Stellen ein Wasserloch passierte, blubberte es heraus, als wenn dort ein Lebewesen Luft abblies. Im Dunkeln waren oft Lichter im Moor zu sehen. Bruno fürchtete sich vor dem ganzen Gebiet, es war nicht daran zu denken, im Dunkel, oder auch nur in der Dämmerung da hineinzugehen.
An den trockenen Stellen des Moores wuchs Heide, Wollgras, es gab auch Stellen mit bloßem Sand, der dunkelgrau war. Wenn auf diesen Stellen im Sommer ein Stück Holz lag, war es manchmal kein Holz, sondern eine giftige Kreuzotter, der man besser aus dem Wege ging, oder eine Ringelnatter, die war aber ungefährlich. Im Sommer gab es viele Schlangen im Moor und auf der Heide.
Die Nissenhütte selbst lag auf einem kahlen Platz. Wenn man vom Weg her hin wollte, lag links vom Platz die Hütte selbst, rechts daneben hatte der Vater für sein Gemüse die Gewächshäuser aus Glas errichtet. Es gab ein Bild, auf dem seine Eltern mit ihm, seiner Schwester Hanna, und seinem Bruder Malte zu sehen sind. Seine Mutter saß, eine schlanke, schwarzhaarige Frau, mit gerader Nase und einem geschwungenen Mund, eine schöne Frau, sein Vater stand daneben, hochgewachsen, ebenfalls schlank, mit Hut, der Offizier war vor allem aus seinem strengen Mund zu erkennen, beide mit ernsten aristokratischen Gesichtern vor der ärmlichen Nissenhütte, in die ein grausames Schicksal sie verbannt hatte.
4.
Als Bruno fünf Jahre war, zogen seine Eltern mit der ganzen Familie um. Mittlerweile war ein weiterer Bruder, Hendrik, dazugekommen, Die Eltern wohnten nun mit vier Kindern in dem Dorf, in einem Haus, das der Vater selbst hatte bauen lassen. Dieses Haus lag nicht mitten im Dorf, sondern am Rande, immerhin waren es nur noch fünf Minuten zu Fuß zum Kaufmann, ebenso viel zur Kirche.
Zu dem Haus gehörte ein großes Grundstück. Der Vater hatte um dieses Grundstück im Abstand von zwei Metern Pappeln gepflanzt, um seinen Besitz zu begrenzen. Mit Zäunen grenzten nur Kleinbürger ihren Besitz ein, pflegte er zu sagen, Pappeln wüchsen schnell, dann hätten sie ein kleines Anwesen und nicht nur ein großes Grundstück. Bruno erinnerte sich, dass seine Schwester, kurz nachdem sie umgezogen waren, in die Schule kam, Bruno selbst war zu dieser Zeit damit beschäftigt, Fahrrad fahren zu lernen. Die Familie war zu arm, um den Kindern Räder kaufen zu können, so lernte Bruno auf dem Herrenrad des Vaters. Oberhalb der Stange auf dem Sattel sitzend, konnte Bruno nicht treten, die Beine waren zu kurz, und so hielt er das Fahrrad sehr schräg und lernte fahren, indem er unterhalb der Stange die Pedale trat. Das erleichterte das Lernen nicht eben, auch nicht, dass zu dem Haus ein Schlackenweg führte, immer wieder fiel Bruno hin und schlug sich die Knie auf.
Das Haus selbst war klein, ein Siedlungshaus; es hatte unten ein Wohnzimmer, durch eine Schiebetür teilbar, ein kleines Badezimmer und eine Küche. Oben waren zwei Zimmer, eines teilten sich anfangs die Eltern, in dem anderen schliefen die vier Kinder. Dies wurde nach und nach schwierig, die Eigenheiten der Kinder fingen an, sich herauszubilden. Malte „rollte“. Nachts konnte er nicht ruhig liegen, sondern rollte stets von der rechten zur linken Seite und zurück. Dies hinderte die anderen Geschwister am Schlafen. Mutter nahm Malte mit ins elterliche Schlafzimmer, wo das Rollen aufhörte. Allerdings zog die Mutter kurz danach in den unteren hinteren Teil des Wohnzimmers. Sie konnte nicht mehr beim Vater schlafen, wie sie sagte, da er schnarche. Das klang für Bruno damals plausibel.
In diesem Haus spielte sich jetzt Brunos Leben ab. Es war klein, der Garten riesig, die Pappeln, von Vater gepflanzt, regten zum Klettern an, aber wehe, man ließ sich dabei erwischen: Dann legte sein Vater ihn übers Knie und dann gab es „das Jack voll“, wie er das nannte, der alte Halcan konnte fürchterlich hauen, das tat weh, aber noch mehr schmerzte die Missbilligung, die in der Prügel zum Ausdruck kam. Hinter dem Garten war zwar das heimische Grundstück zu Ende, nicht aber die Welt: Von der Grundstücksgrenze gelangte man nach hinten auf eine Weide von riesigen Ausmaßen, auf denen die Pferde eines Bauern standen. Sie war auf allen Seiten von hohen Hecken umstanden, die immer ein bisschen im Wind rauschten. Rechts daneben, hinter dichtem Gebüsch, lag ein Kolk, ein kleiner See, in dem Fische und Frösche lebten. Die Eltern hatten die Kinder in ernstem Ton vor dem Wasser gewarnt: er ist sehr tief, hatten sie gesagt, unten in der Tiefe auch geheimnisvoll, Kinder ertrinken darin, wenn sie zu nah heran gehen.
Hinter der Wiese mit den Tieren der Fluss, damals klein und schnell fließend, mit Weiden und Pappeln an seinem Ufer, auf der anderen Seite wieder Weiden und Felder.
Das war aber nur der Garten nach hinten. Links vom Haus war ein Feld, das alle paar Jahre mit Roggen bestellt war. Im Spätsommer kamen die Bauern mit Sensen und schnitten das reife Getreide, bündelten es und stellten es zu kleinen Hütten auf. Während der Ernte durften sich Bruno und die Geschwister besser nicht am Feld sehen lassen. Es gab nämlich Spuren, flach getrampelte Pfade im Feld; natürlich hatten die Kinder die hochstehenden Pflanzen benutzt, um Verstecken zu spielen, was neben dem Reiz des Spieles auch den Reiz der Gefahr hatte: Wurde man vom Bauern erwischt, gab es eine kräftige Tracht Prügel. Natürlich war das Verhältnis zu dem Bauern zur Linken nicht sehr freundschaftlich, dafür ging Bruno häufig auf den Hof, zu dem die Koppel nach hinten gehörte. Der Hof selbst lag im Dorf, zum Ackern benutzten die Bauern drei Pferde, die zu Feierabend auf die Weide getrieben und morgens geholt wurden. Der Altbauer war damals schon über 60 Jahre, er hatte zwei Söhne, mit denen er den Hof betrieb. War das eine warme Küche im Bauernhaus, in dem Frau Hinners, die Bäuerin, stand, das frisch gebackene Brot an ihren Busen presste und Scheiben abschnitt! Diese Scheiben wurden dick mit Margarine bestrichen und mit Zucker bestreut, ein Leckerbissen.
Der Alte nahm Bruno, den er besonders ins Herz geschlossen hatte, ab und zu beiseite und sang ihm, flüsternd, heimlich Lieder:
„Wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wiederham“,
und, einen halben Ton höher, die gleiche Zeile nochmal:
„Wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wiederham“.
Oder:
„Und unsre Fahne, die ist schwarz-weiß-rot“.
Bruno hatte keine Ahnung, was der Alte ihm da vorsang. Er wusste nichts von Kaisern, von Wilhelm oder Fahnen, aber er nahm das, was der alte Hinners ihm da vorsang und dazu erzählte, sehr ernst. Es musste ja ernst sein, sonst hätte der Alte kaum von seinem gewohnten Plattdeutsch in das ihm beschwerliche Hochdeutsch gewechselt.
Tief in seine Erinnerungen versunken, saß Bruno an seinem Fenster in Göttingen und sah mit blinden Augen hinaus. Nie mehr hatte er an den Garten seines Vaters in Neuburgheim gedacht, nie hatte er registriert, wie genau sich der Anblick der Bäume, der Blumen und der Umgebung dieses Hauses in Neuburgheim in ihm festgesetzt hatten, selbst die Gerüche hatte er heute noch in der Nase. Gerüche! Sehr genau erinnerte er sich, wie die Kinder in der ersten Klasse der Schule rochen, nach Land, nach Tieren und ein bisschen nach saurer Milch.
5.
Zuerst kam seine Schwester Hanna in die Volksschule, da war Bruno noch nicht fünf Jahre alt. Unterrichtet wurde in einem Gebäude mit zwei Zimmern für die evangelischen Kinder, die katholischen Kinder hatten ihre eigenen Lehrer.
Bruno begleitete seine Schwester jeden Morgen um kurz vor acht Uhr zur Schule und holte sie nach Ende wieder ab. Seine Eltern waren gerührt: „Seht doch, wie Bruno an seiner Schwester hängt, jedes Mal bringt er sie hin und holt sie ab.“ Aber Bruno war nicht anhänglich, nicht darum begleitete er seine Schwester. Er brachte Hanna zur Schule und holte sie ab, weil er sich alt genug fand und sobald wie möglich auch lernen wollte.
Seine Eltern hatten mit der Lehrerin gemeinsam ein Einsehen, als Bruno noch nicht 6 Jahre alt war. Zu Ostern, vor seinem sechsten Geburtstag, kam er in die Schule.
Lehrerin war Fräulein Ralle, ungefähr 60 Jahre alt. Wenn Bruno heute an sie dachte, hatte er für ihr Aussehen nur ein Wort: gemütlich. Sie hatte eine dunkle, sonore Stimme, war nicht sonderlich streng. Fräulein Ralle war zunächst die einzige Lehrerin für evangelische Kinder am Ort. Sie musste daher alle acht Klassen gemeinsam unterrichten. Von Nachteil dabei war, dass sie den Unterricht in Hochdeutsch abhalten musste, das von den ungefähr achtzig Kindern nur 10 verstanden. Sie wechselte daher häufig ins Plattdeutsch, um etwas zu erklären. Sie musste alle fünf Minuten von einem Zimmer ins andere gehen, weil sie sich ja um beide Klassen kümmern musste, was nicht zur Disziplin im anderen Zimmer beitrug.
Von Vorteil war, dass es nicht so sehr darauf ankam. Die meisten Schüler kamen von den Bauernhöfen, deren Eltern sowieso nicht recht einsahen, wieso ihre Kinder zur Schule mussten; sie brauchten sie als Arbeitskräfte auf den Höfen. Ein Junge musste rechnen können und ein Mädchen nähen und kochen, was der übrige Unsinn sollte, war unverständlich. Fräulein Ralle trug das alles mit einer unendlichen Geduld. So war ein heulender Junge der zweiten Klasse nicht zu beruhigen. Der Vater war mit Pferden und Leiterwagen in der Pause an der Schule vorbeigefahren, der Junge wollte mit. Fräulein Ralle ließ ihn und erntete Dankbarkeit bei Vater und Sohn.
In der Kirche gab es den alten Kantor Wührmann, der nur acht Finger hatte und damit die Orgel spielte, ungefähr 70 Jahre alt. Ein Schüler der 4. Klasse hatte gerechnet: Kantor Wührmann 70 Jahre, unverheiratet und Fräulein Ralle 60 Jahre, unverheiratet. Das Ergebnis kleidete er in eine Frage, vor der Klasse gestellt: „Fräulein Ralle, warum heiratest du nicht Kantor Wührmann?“ Mit fester Stimme antwortete sie: „Jetzt nicht, Hinderk, wie viel ist 2 und 3?“ Und erreichte, dass Hinderk seine Finger nahm und rechnete.
6.
Jetzt zeigte sich, wie gut es war, dass die Eltern in das Dorf gezogen waren. Bruno brauchte, um in die Schule zu kommen, nur fünf Minuten zu gehen.
Aber was gab es im Dorf nicht alles zu sehen.
Da waren zunächst die seltenen Lastkraftwagen. Bruno war Sachverständiger für Lastkraftwagen, hatte doch sein Vater auch einen und fuhr damit in die weite Welt. Noch beim Erinnern wurde Bruno warm. Er schlief. Auf einmal, es mochte vier Uhr morgens sein, stand sein Vater, noch im Nachthemd, vor seinem Bett, flüsternd: „Bruno wach auf!“ und nach einer Weile: „Bruno, wach auf, willst du mit nach Ibbenbüren fahren?“ Und ob Bruno wollte! Er wusste, um Schule musste er sich nicht kümmern an solchen Tagen, sein Vater würde in seiner unleserlichen Handschrift eine Entschuldigung schreiben. Blitzschnell erwachte er, sprang auf, zog sich an, wusch sich, während sein Vater schon aus dem Hause ging, und folgte dem Vater. Er stieg in den Lkw, einen Mercedes mit ganz langer Schnauze, mit Anhänger und Plane, und sie fuhren los. Auf diese Weise nach Ibbenbüren, Bruno wusste nicht, was sie da holten, nach Lengerich, da holten sie Zement. Immer ging es am Rande des Teutoburger Waldes entlang und sogar hinein. Sie waren den ganzen Tag unterwegs.
Wie sollte Bruno da nicht Sachverständiger sein. Auf dem Hof der Gaststätte Gruber machten viele Lkw-Fahrer Pause, darunter manchmal Holländer, und Bruno stellte sich zu ihnen und träumte davon, einer von ihnen zu sein oder mindestens zu werden.
Bei Gruber war noch mehr los. Immer sonntags, um halb zehn, kamen die Kutschen angefahren, von zwei, manchmal vier Pferden gezogen, schwarze, weich gefederte, geschlossene Kutschen, innen luxuriös gepolstert, gefahren von Kutschern, die bäuerlich gekleidet waren. Die Ankunft einer Kutsche kündigte sich durch den Hufschlag der Pferde auf dem Kopfsteinpflaster und durch das Rollen der Räder an. Hielten die Kutschen, entstiegen ihnen die Großbauern aus der Umgebung, die in ihren schwarzen Anzügen zur Kirche gingen, und zwar zur reformierten. Ernst, schwer und im Bewusstsein ihrer Würde verließen sie ihre Wagen und wandelten würdig zur Kirche, und zwar Sonntag für Sonntag, indes die Kutscher die Pferde abspannten und in der Remise bei Gruber unterstellten. Je älter Bruno wurde, desto öfter folgte er ihnen in die Kirche und zum Gottesdienst. Sie fasste ungefähr 400 Menschen und war jeden Sonntag bis auf den letzten Platz gefüllt, die Männer links von der Kanzel, die Frauen rechts davon, die nicht konfirmierten Kinder bei den Frauen. Hier hielt Pastor Ammermeier jeden Sonntag seine Predigt, ein donnernder Redner, der den Zuhörern die Lehren Jeremias, Jesajas, Amos und all der anderen finsteren Propheten des Alten Testaments um die Ohren schlug, der aber weder mit Text noch mit finsteren Drohungen noch mit Lautstärke verhindern konnte, dass die Besucher, von der harten Arbeit der Woche ermüdet, im warmen, von Menschendunst erfüllten Kirchenschiff den Kampf mit dem süßen Schlaf verloren. Besonders erbittert war der Pfarrer, dass auch die Kirchenältesten, auf Ehrenplätzen für alle sichtbar, den Verlockungen des Schlafes an den meisten Sonntagen nicht widerstehen konnten.
Nach der Kirche und dem Segen traf man sich auf dem Kirchplatz, wo wichtige Landgeschäfte mit Handschlag abgeschlossen, Schweinepreise diskutiert und gegenseitige Besuche verabredet wurden.
Das war Brunos Welt in dieser Zeit. Immer kam er von seinen Erlebnissen nach Hause zu seinen Eltern, zu seinen Geschwistern, in eine vertraute Welt.
7.
Bruno stand, achtjährig, vor dem Verkaufstresen des Lebensmittelgeschäftes, hinter dem die Besitzerin, Frau Koopmann, bediente. Gleich würde er dran sein, würde Frau Koopmann ihn nach seinen Wünschen fragen. Bruno hielt in der kleinen verschwitzten Hand den Einkaufszettel, den seine Mutter ihm mit gegeben hatte. Bruno fühlte, wie der Kloß in seinem Hals immer größer wurde, und jetzt richtete sich der Blick der Besitzerin auf ihn.
„Nun, Bruno, was solls denn heute sein, “ fragte sie nicht unfreundlich.
„Ein Kilo Weizenmehl,“ las Bruno den ersten Posten auf der Liste vor und Frau Koopmann wendete sich zu der großen Schrankanlage hinter ihrem Rücken und füllte aus einer Schublade ein Kilo ab, stellte die Tüte auf den Tresen und fragte nach den nächsten Wünschen. Eine lange Liste hatte seine Mutter ihm mitgegeben, hinter ihm sammelten sich neu hinzugekommene Kunden, die Schlange wurde immer größer und der Kloß in Brunos Hals immer dicker.
„Sonst noch was?“ fragte Frau Koopmann hinter den Tüten auf dem Tresen und sah Bruno an.
„Nein danke“, presste er hervor und Frau Koopmann begann mit ihrem Bleistift auf einem Block zu rechen.
„Dreiundzwanzig Mark sechzig“, sagte sie dann und sah ihn an.
„Anschreiben lassen“, Bruno bemühte sich, seiner Stimme einen tiefen Klang zu geben, das gelang ihm aber nicht, stattdessen wurde sie noch piepsiger als zuvor.
Und dann kam, was er befürchtet hatte, seit die Mutter ihn zum Einkaufen losgeschickt hatte.
„Hör mal, Bruno, das geht aber nicht so weiter, weißt du eigentlich, wie viel ich schon angeschrieben habe?“ fragte Frau Koopmann ihn mit energischer Stimme, „hier stehen schon über hundert Mark, wann will deine Mutter das denn eigentlich alles bezahlen?“
Am liebsten hätte Bruno sie gebeten, leiser zu sprechen, damit die wartenden Kunden nicht mitbekamen, dass er kein Geld hatte, um zu bezahlen, aber das ging wohl nicht an. Er zuckte die Schultern, den Tränen nahe.
„Ich weiß nicht, meine Mutter hat gesagt, ich soll anschreiben lassen“, flüsterte er heiser und verstummte.
„Na gut, diesmal noch, aber sag deiner Mutter einen schönen Gruß, das geht nicht mehr so weiter,“ und Frau Koopmann packte die Tüten in die Tasche, die er ihr zum Tresen hochreichte, und mit hochrotem Kopf ging Bruno aus dem Laden, froh, dass Frau Koopmann diesmal nur geschimpft, aber nicht die Waren wieder zurückgestellt hatte, so dass er mit leerer Tasche aus dem Laden hätte gehen müssen.
Seit sie nicht mehr in der Nissenhütte wohnten, waren sie dem Dorf näher gerückt. In der Hütte war die Familie unter sich, Bruno kannte kein anderes Leben als das in der Familie. Erst als sie in das Dorf zogen, kam er mit den anderen Menschen in Berührung wie mit Frau Koopmann und ihren Kunden. Bruno merkte, sie waren arm, bettelarm.
Nicht nur, dass er bei Frau Koopmann das gefürchtete „anschreiben lassen“ aussprechen musste, Bruno hatte nie neue Sachen, keine Hosen, keine Schuhe, keine Hemden. Immer musste er die Sachen von seiner Schwester Hanna auftragen, „Mädchensachen“ wie er nicht nur einmal in der Schule gehänselt wurde. Am Anfang, als es nur zwei Klassen gab, fiel das nicht so auf, die Bauernkinder waren nicht besser angezogen. Später, in der neuen Schule, gewannen allmählich die Bürgerkinder die Überzahl. Die Bauern gingen nach wie vor ärmlich gekleidet, aber zu denen gehörte Bruno ja nicht. Er gehörte zu den Flüchtlingen, gekleidet war er aber wie ein Bauernkind.
Am schlimmsten waren aber die Kaufleute wie Frau Koopmann, die er hasste, übrigens auch Frau Harmsen, die Fleischersfrau oder Herrn Gerdes, den Inhaber von Kaiser´s Kaffee, wo er auch „anschreiben lassen“ sagen musste.
Ging nichts mehr, war überall die Liste der Schulden zu lang, musste er zu Fransen. Hier kaufte man nicht gerne ein, der war katholisch. Und außerdem hatte er, beklagte sich die Mutter, nichts Frisches. Herr Fransen hatte eine ruhige, besonnene Art, die Sachen wieder wegzupacken, wenn er nicht anschreiben wollte. Meistens wollte er aber, dann schrieb er auf, ohne aber Bruno zu demütigen. Bruno fand Katholische nicht so schlimm, Herrn Fransen jedenfalls nicht.
8.
Je älter Bruno wurde, desto mehr veränderten sich seine Freundschaften. Immer weniger ließ er sich bei dem Bauern Hinners sehen. Der Alte war gestorben und die Söhne hatten wenig Zeit für die Kinder.
Dafür gab es andere Bekanntschaften. Da war zum einen Dieter. Dieter war auch ein Flüchtlingsjunge, seine Eltern allerdings nicht arm wie Brunos Eltern. Der Vater arbeitete bei der Wohlmann AG, einer Ölförderfirma, bei der die meisten Flüchtlinge Arbeit gefunden hatten und gutes Geld verdienten. Dieter war immer gut gekleidet, er redete die gleiche Sprache wie Bruno und seine Eltern. Dieter war so, wie Bruno gerne sein wollte. Nur teilte er die Freundschaft nicht, die Bruno ihm entgegen brachte. Er verschwand nach einem Jahr, Bruno hörte die Lehrerin sagen, sein Vater sei „versetzt“ worden, in einen anderen Ort.
Im Norden des Hauses, in dem Bruno wohnte, hatte sich zum Dorf hin eine kleine Siedlung gebildet. Dort zog eine Familie Klanders mit ihrem Sohn Karl ein, der ein Jahr älter als Bruno war und den Bruno und seine Brüder Kalle nannten. Kalle war ein Freund der drei Brüder, nicht unbedingt ein Freund von Bruno. Die Unterscheidung war deshalb von Bedeutung, weil sich unter den drei Brüdern ein wechselndes Verhältnis entwickelte. Bruno war der Älteste und hätte auch der Stärkste sein sollen. Nach ihm kam Malte, nur ein Jahr jünger und fast gleichstark, aber was Malte schwächer war, machte er durch größeren Mut wett: Er kletterte auf die höchsten Bäume, übersprang die weitesten Gräben. Bruno gab sich natürlich mutiger. Ohne den Ansporn seines jüngeren Bruders hätte er viele Abenteuer nicht auf sich genommen.
Hendrik, der Jüngste, hatte gegen Malte keine Chance und gegen Bruno noch weniger. Er war rettungslos verloren, wenn Bruno und Malte sich gegen ihn verbündeten. Andererseits war Bruno unterlegen, wenn sich seine beiden jüngeren Brüder gegen ihn zusammen taten. Bruno hatte noch immer Narben am Bein, die ihn an einen solchen Pakt seiner Brüder erinnerten. Diese Bündnisse wurden immer nur für kurze Zeit geschlossen, sie zerbrachen schnell und neue wurden geschlossen, In diesen Kämpfen ging es oft um Kalle, den Ältesten und Stärksten und seine Freundschaft. Im Wetteifer der Brüder um diese Freundschaft, der durch den täglichen Verteilungskampf der Geschwister beim Esstisch verstärkt wurde, sammelte sich so viel Zündstoff auf, dass die Brüder sich selten sehr lange vertrugen.
So war das Leben in dieser Zeit in Brunos Erinnerung geprägt von Kämpfen, Bündnissen, Verletzungen, in dieser Zeit lernte er, mit anderen zu paktieren, rechtzeitig nachzugeben und zu wissen, wann er angreifen konnte.
9.
In der vierten Klasse hatten Bruno und seine Mitschüler Unterricht bei Fräulein Blume. Sie wusste den Heimatkundeunterricht besonders spannend zu gestalten und versuchte, den Kindern auch erste Nachrichten vom politischen Geschehen zu vermitteln. So erzählte sie den Viertklässlern eines Tages von der Atombombe.
„Im Krieg gab es Bomben, die waren nichts gegen die neuen Atombomben, die die Russen jetzt haben. Eine solche Atombombe ist so groß wie eine Streichholzschachtel. Wenn die explodiert, ist von hier bis Hermstadt alles verbrannt und kaputt. Alles Menschen sind dann tot.“
Von den Russen hatte Bruno schon gehört. „Die Sowjets“, wie sein Vater sie nannte, oder „die Russkis“, von denen Anni, ihr Kindermädchen zu berichten wusste, konnte man leicht erkennen. Sie wuschen sich nicht zwischen den Fingern. Anni brachte das besonders gerne an, wenn Bruno und seine Geschwister sich nicht ordentlich die Hände wuschen.
Was half es aber, so fragte sich Bruno, wenn man sie erkennen konnte, aber nicht wusste, ob sie eine Streichholzschachtel bei sich hatten, die sich als Atombombe entpuppte? Jahrelang hatte er Alpträume, in denen solche Bomben, getarnt als Streichholzschachtel, explodierten.
Fräulein Blume war aus Sicht des 8 jährigen Bruno alt, so 30 oder 35 und lebte in Neuburgheim. Hanna traute sich, sie ging zu Fräulein Blume, ließ sich wie andere Mädchen Häkeln beibringen und lauschte ihren Geschichten. Bruno traute sich nicht und war also auf die Erzählungen in den Schulstunden angewiesen. Man lebte in einer Demokratie, das sollte eine feine Sache sein, weil das Volk herrschte. Das Volk, so begriff es Bruno, hieß Adenauer, weil der der Chef von Deutschland war. Auch Adenauer hatte mit den Russen zu tun. Eines Tages erzählten Fräulein Blume und die Eltern zu Hause, Adenauer habe ganz viele Gefangene von den Russen nach Hause geholt. Es gab Bilder in den Zeitungen, die Bruno noch nicht lesen konnte, auf denen ein uralter Mann mit zerknittertem Gesicht neben ausgemergelten jüngeren Männern mit Soldatenmützen zu sehen war.
Sein Vater mochte, im Gegensatz zu Fräulein Blume, Adenauer nicht, wie er zum Besten gab. Es gab einen zweiten Mann, Strauß hieß er, den mochte der Vater schon eher. Der konnte sich aber nicht richtig durchsetzen, weswegen der Vater auch eine andere Partei wählte. Was das alles bedeuten sollte, wusste Bruno nicht. Er glaubte jedenfalls fest an Adenauer, weil der den Russen die Gefangenen weggenommen hatte. Fräulein Blume versuchte dann noch, den Viertklässlern beizubringen, was ein Parlament war und wie Regierung funktionierte, aber da hörte selbst Bruno nicht hin. Fräulein Blume sah ihm das nach und gab es auf, davon zu erzählen. Sie hatte andere Sorgen. Neben Bruno saß Henrik Hanken, der schon drei Mal sitzen geblieben war, ein kräftiger Junge, über zwölf Jahre alt, der alle in der Klasse hätte verhauen können. Die Stärke nutzte ihm aber nichts, weil er nach den Maßstäben von Fräulein Blume der Schwächste war. Henrik konnte nicht einmal das Wort „König“ lesen. Wurde er hierzu aufgefordert, buchstabierte er jeden Buchstaben laut „ K-ö-n-i-g“, konnte die Buchstaben erkennen, wusste aber nicht, was die Zusammensetzung bedeuten sollte. Wurde Henrik aufgefordert, 3 und 6 zusammenzuzählen, nahm er seine Finger zur Hilfe, 3 und 6 gab 9, das war in Ordnung, fragte ihn aber jemand nach 6 und 7, reichten die Finger nicht aus. Henrik sah zu Bruno auf, er war zwar weit stärker, aber Bruno war ohne jeden Zweifel und mit weitem Abstand der beste Schüler in der Klasse. Er konnte König lesen und 3 mal 7 ausrechnen. Bruno hatte auf dem Zeugnis lauter Einsen, Henrik lauter fünfen, eine sechs gab es damals noch nicht.
10.
Brunos Großmutter mütterlicherseits, von den Kindern Mum genannt, lebte in Hannover. Bruno, knapp 10 Jahre alt, durfte mit seinen Eltern, ohne Geschwister, nach Hannover fahren, Mum besuchen. Nie hatte Bruno sich geborgener gefühlt, hinten sitzend in dem VW Käfer des Vaters, der Vater fuhr, die Eltern plauderten vorne, Bruno konnte nicht verstehen, was, wollte aber auch nicht zuhören, er fühlte sich einfach nur von den Eltern beschützt.
Die Fahrt war endlos. Kurz vor Hannover wendete sich der Vater zu Bruno um und sprach ihn an.
„Bruno, wenn wir gleich zu Mum kommen, ist da eine Dame, ungefähr so alt wie Mama. Das ist Tante Kathrin, die Schwester Deiner Mutter. Du weißt doch noch, wie ich dir den Handkuss beigebracht habe? Tante Kathrin ist eine Dame, der man den Handkuss gibt. Also nicht vergessen: Benimm dich anständig und küss ihr zur Begrüßung die Hand!“
„Ja, Papa.“
Bruno erinnerte sich, wie sein Vater angefangen hatte, ihm das beizubringen, was er für gutes Benehmen hielt. Schrieb man, nach Weihnachten, Dankesbriefe an Onkel und Tanten, hatten diese unterschrieben zu sein mit „Dein sehr ergebener Neffe Bruno“, begegnete man einer Dame, so hatte man ihr die Hand zu küssen, so: Papa nahm die Hand seiner Ehefrau, beugte sich darüber und hauchte einen Kuss darüber, ohne sie mit dem Mund zu berühren. Bruno machte es nach, die Mutter lachte: „Nein, nicht knutschen, nur leicht andeuten.“ Sie übten so lange, bis er es konnte. „Muss ich nun auch Frau Koopmann die Hand küssen, wenn ich bei ihr einkaufe?“ Beide Eltern lachten noch lauter: „Nein, der selbstverständlich nicht, die ist eine einfache Frau, da macht man das nicht.“ Bruno verstand das nicht, bei Frau Koopmann musste man immerhin anschreiben, da wäre man doch vernünftigerweise besonders höflich. Er hatte aber, weil in Neuburgheim nach Auffassung der Eltern nur einfache Frauen wohnten, den Handkuss noch nie probiert. Nun kam also die Probe aufs Exempel.
Mum wohnte im 7. Stock, bis dahin musste man zu Fuß hochgehen. In der Tür stand Mum, die Bruno sehr liebte, und begrüßte sie, vor allem Bruno, mit einem Kuss. Hinter ihr, im Flur, stand eine Dame, dick, ungefähr so alt wie die Mutter. Artig ging Bruno auf sie zu, nahm die Hand der verblüfften Frau und hauchte einen formvollendeten Handkuss darüber. Alle Erwachsenen brachen in infernalisches Gelächter aus, Bruno floh ins nächste Zimmer und erfuhr daher später den Grund der Heiterkeit: Er hatte der Putzfrau von Mum die Hand geküsst, Tante Kathrin war noch nicht da. Bruno schämte sich sehr.
Am nächsten Tag ging er allein mit der Mutter in die Stadt, die man von der Wohnung Mums zu Fuß erreichen konnte. War das eine Riesenstadt! Bruno kannte bisher nur Neuburgheim. Klar, auch da gab es eine Hauptstraße, ein Kino, Schuhladen, Zahnarzt und Kneipe. Aber weniger Menschen. Hier dagegen wimmelte es von Menschen. Um sie herum hasteten sie, liefen, verzweigten sich, trafen sich, redeten, machten Krach. Und Häuser! Häuser, die so hoch waren, dass sie in den Himmel ragten. In Neuburgheim war der Schuhladen das höchste Haus, drei Etagen hatte es. Bruno musste den Kopf schon sehr in den Nacken legen, ehe er das Dach sehen konnte. Aber hier? Hoch, hoch waren sie, es half nichts, den Kopf in den Nacken zu legen, er konnte das Dach nicht sehen. Zwischen den Häusern von der Straße aus konnte er ein kleines Stück Himmel sehen, nicht mehr. Und wo waren bloß die Wiesen zwischen den Häusern? Wiesen, die grün waren mit Kühen drauf, die einen anguckten. Hier gab es weder Kühe noch Wiesen, keine Pausen zwischen den Häusern und Menschen. Bruno stand, staunte, guckte und fürchtete sich ein bisschen. Aber die Mutter war da und beschützte ihn. Sie kannte die Stadt, sie wusste schon, wie er sich benehmen musste und wie sie wieder nach Hause, nach Neuburgheim, kamen. Ganz leise tastete seine Hand nach der Mutter. Aber seine Mutter war nicht da!
Gerade lief sie noch neben ihm! Wo ist sie? Er ist stehen geblieben, ist sie vielleicht weiter gelaufen? Entsetzt und gehetzt sieht sich Bruno um. Keine Mutter. Auch nicht da, wo sie vielleicht weiter gelaufen sein könnte. Keine Mutter, nur riesengroße Häuser und Menschen, Menschen, aber keine Mutter. Die Menschen erscheinen ihm auf einmal immer größer, sie laufen schneller, immer schneller dreht sich um den Jungen der Kreisel der Stadt, der riesengroßen Stadt. Bruno steht und fürchtet sich. Ganz langsam füllen sich die Augen mit Tränen: Nein, nur jetzt nicht weinen, das macht es nur noch schlimmer. Aber die Tränen kommen, sie kommen immer höher, egal ob er will oder nicht. Ganz langsam, Bruno steht inmitten der Häuser und Menschen, verzieht sich sein Mund, er kann es spüren, wie sein Mund breiter wird, wie gleichzeitig mit den Tränen sein Mund beginnt zu weinen, und dann weint der ganze Junge, er kann es nicht aufhalten, Schluchzen schüttelt ihn und nun weint auch seine Stimme. Er hat den Bissen vom Brötchen, das ihm seine Mutter gekauft hat, noch im Mund, der ihm gerade noch so gut geschmeckt hat und den er jetzt vor Kummer und automatisch weiter kaut. Bruno steht mitten auf dem Bürgersteig in Hannover, von hastenden Menschen umgeben, mutterseelenallein und kaut und schluchzt und weint zum Gotterbarmen. Nie wieder wird er aufhören können zu weinen, seine Mutter ist weg, nie wird sie wiederkommen, sie wird ihn hier allein lassen, mit den Fremden, den Unmenschlichen, den Riesen, und er steht allein und schluchzt und weint und beißt vor lauter Verzweiflung noch mal in sein Brötchen und kaut und weint und in seinem Mund vermischen sich Brötchen, Tränen und Schnodder.
Menschen stehen um ihn herum: „Was hat der Junge bloß? Warum weint er denn so?“ Er kann ihnen nicht antworten, er schluchzt und weint und ist zu verzweifelt, um sie zu hören. Sein ganzer kleiner, fast zehn Jahre alter Körper bebt unter dem Schluchzen und dem Leid, dass seine Mutter weg ist. „Mama“ schluchzt er, mit der Betonung auf der letzten Silbe.
Eine ganz weiche, liebevolle Stimme spricht neben ihm. Er kennt sie nicht, aber sie ist vertrauenserweckend und ihm zugeneigt: „Wo ist denn deine Mama?“, fragt sie und so, als ob sie ihm helfen will. „Weiheiß nihicht“, schluchzt er und versucht, die anzusehen, deren Stimme er vertraute. Er sieht eine Frau in der Hocke neben ihm. „Wollen wir sie nicht suchen gehen?“, fragt sie. Bruno nickt.
Sie richtet sich auf und nimmt seine Hand. „Wo hast du deine Mama denn zuletzt gesehen?“ Er blickt zu ihr auf „Hier“, antwortet er. Sie steht etwas unentschlossen da. „Vielleicht ist es das Beste, wenn wir hier einen Moment warten, vielleicht kommt sie dich holen“, schlägt sie vor. „Aber Du gehst nicht weg?“, fragt er angstvoll. Da hört er plötzlich eine vertraute Stimme „Bruno, wo bist du denn?“, Er reißt sich los und rennt auf die Stimme zu „Mama! Mama! Hier bin ich!“, und schließt seine Mutter in den Arm und lässt sich von ihr hoch heben. Die junge Frau nähert sich: „Na also, habe ich mir doch gedacht, dass Deine Mutter nicht weit sein kann. Also dann Tschüs, Junge, und verlauf Dich nicht wieder.“ Sie verabschiedet sich, nachdem die Mutter ihr herzlich gedankt hat.
Wieder kamen Bruno vierzig Jahre später die Tränen, als er an den kleinen einsamen Jungen in Hannover dachte. Wie einsam war er damals gewesen, wie oft ist er seitdem verlassen worden und wie einsam ist er jetzt. Ablenken wollte er sich von Margarete und tauchte wieder ein in die Erinnerungen, auf der Suche nach seiner Geschichte.
11.
In Neuburgheim zurück standen große Veränderungen an. Bruno sollte zum Gymnasium. Das war in der ungefähr 30 Kilometer entfernten Kreishauptstadt Hermstadt gelegen. Hanna war schon ein Jahr früher dorthin gegangen, deshalb wusste Bruno, was ihn erwartete: Jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und mit dem Zug eine Stunde bis nach Hermstadt fahren.
Und es gab viele aufregende Neuigkeiten!
Eine Sensation war am Bahnhof in Hermstadt der Bildzeitungsverkäufer. Der schrie die Schlagzeilen aus und machte bei den Arbeitern, die nach Hermstadt zur Arbeit fuhren, ein blendendes Geschäft. Bruno war wie seine Mitschüler fasziniert über die Laute, mit denen der Verkäufer die Schlagzeilen ausschrie. Die Schlagzeile etwa „Adenauer: Wir brauchen das Militär“ kam so: „A!“ Luft holen „Nauer!“ Luft holen „Mi!“ Luft holen „tär!“ Der Ausruf „Strauß!“ Luft holen „Krieg!“ kündigte beim näheren Hinsehen die Schlagzeile an „Strauß: Nie wieder Krieg!“ Bruno und seine Kameraden pflegten später Wetten abzuschließen, wer am besten von den Lauten auf die dazugehörige Schlagzeile schließen konnte.
Das Gymnasium machte Bruno ebenso viel Spaß wie die Volksschule. Er hatte nicht den Eindruck, dass sich viel geändert hatte. Er merkte nur, dass sein Ansehen weder bei den Lehrern noch bei den Schülern so hoch war wie in Neuburgheim. Im Gegenteil, sein einziger Mitschüler aus Neuburgheim, Gunther, wollte mit ihm nicht so viel zu tun haben. Gunther war 2 Jahre älter und sprach von Bruno immer nur als Kleiner.
Die Überraschung kam nach ungefähr einem Monat: Ziemlich schnell hatten sie eine Klassenarbeit in Deutsch geschrieben, Bruno hatte in seiner gewohnten Art eine Geschichte erzählt. Er bekam eine 5! Bruno verstand die Welt nicht mehr. Warum denn so schlecht? Und kurz darauf bekam er die erste Arbeit in Mathematik, wie jetzt das Rechnen hieß, zurück. Eine 5! Bruno war verzweifelt. Seine Eltern wussten ebenfalls keinen Rat. Sie fuhren zum Klassenlehrer nach Hermstadt, der zuckte die Achseln: „Ja, ich weiß, welche Zensuren Ihr Sohn in der Volksschule hatte, aber hier jedenfalls reichen seine Leistungen keinesfalls aus.“
Das Herbstzeugnis war verheerend. Lauter fünfen, mal mit einer vier dazwischen. Wenn Bruno so weiter machte, blieb er zu Ostern sitzen, und zwar gleich in der ersten Gymnasialklasse. Das kam nicht in Frage. Bruno wusste bis heute nicht, wie und was die Eltern gedeichselt hatten. Jedenfalls aber hieß es kurz nach den Herbstferien: „Bruno geht zurück zur Volksschule, er war zu jung für das Gymnasium, deshalb war er krank und kam nicht mit.“ Er würde den Rest der Klasse in der Volksschule besuchen und dann, nach einem halben Jahr, es noch mal versuchen.
Bruno erinnerte sich noch wie heute an den ersten Schultag nach der Zurückversetzung. Er hatte mit nichts gerechnet, fand normal, dass er in seine alte Klasse zurückkam. Nicht so seine Mitschüler. Sie standen in der Klasse, als er hereinkam, deuteten mit den Fingern auf ihn und schrien: „Ahhhhh! Da isser wieder! Hats nicht geschafft aufe Oberschule! Ahhhh!“ Das ging so lange, bis Fräulein Blume hereinkam und dem Treiben ein Ende setzte. Sowohl Bruno als auch seine Mitschüler gewöhnten sich schnell wieder an die neue Situation, Bruno bekam erneut nur gute Noten, seine Mitschüler und Fräulein Blume achteten ihn wieder und für eine Zeit war die Welt wieder in Ordnung.
12.
Als das Schuljahr vorbei war, ging Bruno wieder auf das Gymnasium. Die Lesart war nicht etwa, Bruno habe es nicht geschafft, sondern, er sei zu jung gewesen, deshalb krank geworden und nun, ein Jahr älter, könne er es schaffen. Eine gewagte Hypothese, von der Bruno aber erst sehr viel später erfahren hatte. Hätte er sie damals gekannt, wer weiß, vielleicht hätte der Leistungsdruck ihn erneut scheitern lassen, er hätte nicht weiter lernen können, er hätte . . . Bruno dachte auch im Alter diese Hätte’s nicht weiter, es kam anders und damit Schluss.
In der ersten Zeit war das noch anders in der Schule in Hermstadt, aufregend, neue Klassenkameraden, neue Anforderungen. Nach einem Jahr wusste er, sein Verstand und sein Fleiß reichten aus: Jetzt galt es, 8 lange Jahre zu der gleichen Schule zu gehen, den gleichen Tagesablauf zu absolvieren, anstrengende und leichte Tage hinter sich zu bringen, Schularbeiten machen, Zug fahren, mit den Klassenkameraden reden, Lehrern antworten, Hausaufgaben machen, Ausreden erfinden, wenn man sie nicht gemacht hatte und der Mutter Krankheit vorzutäuschen, wenn man absolut nicht zur Schule gehen wollte, acht lange Jahre.
13.
Bruno kam nach Hause. Er hatte in dem einzigen Kino in Neuburgheim, das nur mittwochs und freitags Programm hatte, einen Film aus dem zweiten Weltkrieg gesehen. Heldenverehrung der Kämpfer, Grausamkeiten. Bruno war mit seinen zwölf Jahren tief bewegt. Seine Eltern saßen ausnahmsweise einträchtig beim Kaffee. Bruno fing an, ihnen seine Gedanken zu dem Film zu erzählen. „Gelernt habe ich“, so erklärte er ihnen, „dass Gott will, dass die Menschen friedlich miteinander leben, aber die Menschen gehorchen ihm nicht. Deshalb gibt es Kriege.“ Seine Eltern sahen sich an, schwiegen einen kleinen Moment und brachen dann in lautes, belustigtes Gelächter aus ob der Weisheiten, die ihr ältester Sohn ihnen da unterbreitete. Bruno sah sie schweigend an und ging dann wortlos hinaus. Von diesem Moment traute Bruno seinen Eltern nicht mehr. Nie mehr vertraute er ihnen seine geheimen Gedanken an. Er wurde still, verschlossen, freundlich, skeptisch.
Jetzt, in der Erinnerung, wusste Bruno, dass diese Reaktion seiner Eltern seine Kommunikationsmethoden der nächsten Jahrzehnte geprägt hatten. Mit seinem besten Schulfreund, Hans Rink, redete er nie ernsthaft. Immer und alles wurde bespöttelt. So wusste Bruno heute noch nicht, was Hans eigentlich damals gedacht, übrigens auch nicht, was er selbst gedacht hat. Wollte er einen Gedanken zum Ausdruck bringen, brachte er ihn spottend vor, immer gewahr, dass der andere ihn auslachte, um dann sagen zu können „siehst du, deshalb habe ich diesen Gedanken spottend vorgebracht, ich meinte ihn selbst nicht ernst“.
Nichts im ernsten Ton diskutieren, nicht einmal mit Schulfreunden oder später mit befreundeten Kollegen, noch mit dreißig Jahren pflegte Bruno diese Art der Kommunikation, und behielt sich bei jedem Gedanken den Rückzug vor.
Und seine Freunde machten sich ebenso lustig. Es war eine logische Konsequenz, dass derjenige, der den Gedanken von Bruno spöttelnd serviert bekam, ihn auch spöttelnd zurückgab; und Bruno nahm an, dass genau das eingetreten war, was er befürchtet hatte: der andere mache sich über ihn lustig. Da nahm Bruno im nächsten Satz seine Gedanken wieder zurück. Für ernsthaft an Bruno interessierte Menschen war dies eine kaum zu überwindende Barriere.
Zwei Jahre nach dem Kinobesuch nahm sein Vater ihn beiseite:
„Bruno!“, sagte er, „du bist mein ältester Sohn. Du wirst nach meinem Tode einmal der Erbe meines Rittergutes werden. Es ist an der Zeit, dass du dich mit diesen Gütern vertraut machst und damit, was wir als erstes machen, wenn wir die Ostgebiete zurückbekommen.“
Bruno war verblüfft. Aus Erzählungen wusste er von den Gütern seines Vaters in den Ostgebieten, jenseits der Oder-Neiße-Linie. Dass sein Vater aber so gewiss damit rechnete, diese Güter zurück zu bekommen, hatte Bruno nicht geahnt. Er selbst war in Neuburgheim in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass er in einer armen Familie lebte. Er wusste, wie seine Eltern um die Höhe des Haushaltsgeldes stritten, weil nicht genug da war. Das war sein Leben. Dass es einmal anders werden könnte, hatte er sich nie vorgestellt. Er hörte morgendlich Nachrichten und darin von Eisenhower und Stalin sprechen. Adenauer war fest auf der Seite des Westens, wie sollten da die Ostgebiete jemals wieder deutsch werden? Alle hielten das für eine Illusion, und hier kam sein Vater, versprach ihm das Erbe des Rittergutes und wollte mit ihm den Wiederaufbau diskutieren.
Bruno sagte nichts. Sein Vater rollte eine riesige Generalstabskarte des Rittergutes aus. Er hatte schon vorgearbeitet. Riesige grün umrandete Areale waren, wie sein Vater erklärte, die Forsten der Güter, die Ackerbauflächen waren rot umrandet.
„Wir können natürlich nicht alles von Anfang an bewirtschaften“, sagte sein Vater, „sondern erst einmal einen kleinen Teil. Hierfür brauchen wir einen von den modernen Mähdreschern, die du sicher schon gesehen hast.“
Bruno hatte sie gesehen. Früher waren der Bauer und alle Knechte mit ihren Sensen gekommen, hatten das Korn geschnitten und zu Garben aufgestellt, um es trocknen zu lassen. Wenn die Garben trocken waren, wurden sie auf hohe Wagen gestakt und zum Dreschen auf den Bauernhof gefahren. Diese Art der Ernte war vor einigen Jahren von Mähdreschern abgelöst worden, riesigen Maschinen, die das Korn selbst schnitten, dann in ihrem Inneren verarbeiteten und schließlich aus einem gigantischen Speirohr das fertig gedroschene Korn auf nebenher gezogene Anhänger warfen.
„Aber ist denn so eine Maschine nicht furchtbar teuer?“, fragte Bruno.
„Das müssen wir aus den Erträgen bezahlen, die wir aus dem Forst machen. Wir werden da zuerst viel Holz schlagen und verkaufen müssen. Von dem Geld kaufen wir den Mähdrescher und übrigens auch die Kartoffelerntemaschine, denn wir können dort nur Roggen und Kartoffeln anbauen. Mehr gibt der Boden nicht her.“
Und der Vater legte Bruno eine Kalkulation vor, die den Preis für Mähdrescher, Kartoffelerntemaschine, Trecker und Saatgut enthielt. Auf der anderen Seite waren penible Berechnungen angestellt, wie viel Holz man schlagen und zu welchem Preis verkaufen musste, um die Investitionen zu bezahlen und leben zu können.
Bruno blickte abwechselnd auf die Kalkulation, die Pläne und auf seinen Vater. Sein Vater war groß gewachsen und in letzter Zeit dick geworden. Er hatte tiefe Geheimratsecken, wie er es nannte, man konnte auch sagen, er hatte eine Glatze mit einem Haarkranz drumherum, der jetzt grau wurde. Seine Stimme, die laut, herrisch und aggressiv sein konnte, war in dem riesigen Wohnzimmer, in dem sie saßen, weich geworden, wenn er an sein Gut dachte. Nachdenklich saß Bruno da und hörte dieser Stimme zu und merkte, dass er seinem Vater nicht mehr glaubte.
Zu groß war der Widerspruch, unter dem er seit einiger Zeit lebte: Seine Eltern erklärten ihm und seinen Geschwistern immer, sie seien etwas Besseres, mit ihrem Namen. Aber Brunos Freund Hans Rink hatte viel mehr Taschengeld als er und seine Geschwister. Seine Eltern waren wesentlich reicher. Brunos Vater war Versicherungsvertreter, aber das war Herr Hannsmeyer auch. Was also war es, was sie besser machte? Der adelige Name vielleicht? Aber sie nahmen in der Schule gerade die Zeit im Mittelalter durch, als die Adeligen durch Deutschland gezogen waren und die Armen geplündert hatten. Immer, wenn der Geschichtslehrer, Herr Nordmann, von diesen Ereignissen erzählte, trafen Bruno höhnische Blicke von seinen Klassenkameraden. Herr Nordmann, diese Blicke bemerkend, sprach Bruno direkt an: „Die Halcans, die waren doch nur ein ganz billiger, verarmter Landadel.“ Das machte es auch nicht besser.
Wie unterschieden sie sich von den „einfachen Leuten“, wie die Eltern ohne Ausnahme alle anderen - bis auf die Verwandten - nannten? Etwa dadurch, dass sein Vater früher ein Gut gehabt hatte, das die hiesigen Höfe an Größe um ein Vielfaches übertraf? Aber es gehörte seinem Vater nicht mehr. War man etwas Besseres, nur weil man früher Besitztümer gehabt hatte? Bruno dachte hierüber viel nach, ohne sich aber einen Reim darauf machen zu können.
Brunos Vater war am Ende des ersten Weltkrieges auf dem Gut, das heute Gegenstand ihrer Betrachtungen war, geboren. Er hatte in der regulären Schule Schwierigkeiten gehabt und hatte deshalb kurz vor Beginn des zweiten Weltkrieges auf einem Internat Abitur gemacht. Kurz danach war er eingezogen worden. Im Krieg war er sehr schnell avanciert, war mit Ritterkreuz und der goldenen Nahkampfspange ausgezeichnet worden und beendete den zweiten Weltkrieg mit einer Verwundung als Major.
Mitten im Krieg hatte er die Mutter geheiratet. Bruno hatte verschiedene Geschichten über die Heirat gehört. Seine Mutter hatte, so erzählten die Verwandten der Mutter, eine erhebliche Mitgift in die Ehe gebracht. Diese sei dringend vonnöten gewesen, denn die Güter des Vaters seien praktisch pleite gewesen. Der Vater der Mutter, ein versierter Kaufmann, Landrat und Jurist seines Zeichens, hatte zur Bedingung der Mitgift gemacht, dass er die wirtschaftliche Zukunft des Gutes bestimmen und den Schwager des Vaters, der das Gut während der Abwesenheit des Vaters führte, feuern durfte. Nur deshalb, so diese Erzählung, hatte das Gut am Ende des Krieges noch bestanden.
Die Verwandten des Vaters erzählten die Geschichte anders: Der Schwager habe das Gut durchaus erfolgreich geführt. Dann sei aber der Schwiegervater mit seinem Geld gekommen und habe seiner Tochter einen adeligen Mann und sich selbst ein Betätigungsfeld als Gutsbesitzer gekauft.
Welche Geschichte auch richtig war, der Krieg hatte alles durcheinander gewürfelt: Statt auf einem Rittergut als angesehene Gutsbesitzer zu leben, fanden sich Brunos Eltern nach dem Krieg in einer Nissenhütte am Ende der Welt, das heißt Westdeutschlands, wieder, ohne Besitz, ohne Vermögen, arm. Der Vater wollte möglichst viele Kinder haben, die Mutter nicht. Der älteste Sohn war im Krieg an Diphtherie gestorben. Nach dem Krieg hatte die Mutter auf der Flucht Hanna, dann in fast jährlicher Reihenfolge Bruno, Malte und Hendrik geboren, ohne auch nur die geringste Vorstellung davon zu haben, wie sie sich und ihren Mann, geschweige denn die Kinder den nächsten Tag ernähren sollte.
So waren sie in Neuburgheim gelandet, so wuchs Bruno in den ersten Jahren auf.
Jetzt, mehr als vierzigjährig, verstand der sich erinnernde Bruno den Widerspruch. Was sonst hätte seine Eltern wohl in der Nissenhütte, verarmt, mit vielen Kindern, aufrecht erhalten sollen, wenn nicht die Illusion, sie seien hier ganz falsch, sie seien die Besseren, anders als die einfachen Leute.
14.
Wenn er weder mit dem Vater den Wiederaufbau des Rittergutes noch mit den Geschwistern und Freunden Indianer spielte, las Bruno. Er las erst wahllos, was ihm in die Hände kam: Karl May, Comics, Abenteuerbücher für Kinder vom Schneider Verlag. „Käpt´n Rickys tollster Flug“ war darunter, Heidi, die Bücher seiner Schwester, egal, Bruno las alles. Seine Patentante schickte in einem Weihnachtspaket die Märchen von Oscar Wilde. Bruno, 11-jährig, verschlang sie und bedankte sich überschwänglich für das Geschenk. „Aber“, schrieb seine Tante zurück, „das war doch noch gar nichts für dich, ich habe es für deine Eltern mitgeschickt.“ Dadurch ließ Bruno sich aber nicht abhalten, er las weiter alles, was er erreichen konnte. Derweil kam er in die sechste Klasse, in die siebte, achte, er las, half seinem Vater in Gedanken beim Wiederaufbau der Güter, spielte Indianer, kam in die neunte Klasse.
In der neunten Klasse blieb sein Freund Hans sitzen, Bruno hatte niemanden mehr, mit dem er zur Schule fuhr. Darüber hinaus war nur noch ein Schulkamerad außer ihm „Fahrschüler“, alle anderen waren aus Hermstadt. Das waren Söhne und Töchter von Rechtsanwälten, Zahnärzten, Ärzten, alles Kinder, die sich ihres Status sehr sicher waren und auf ihn, Bruno, herab sahen. Er war adelig und kam vom Dorf, nicht aus der Stadt und man sah ihm an, dass seine Eltern arm waren, der größte Fehler. Isoliert gingen die beiden „Fahrschüler“, Hermann Ahlers und Bruno, über den Pausenhof. Ahlers war zwei Jahre älter als Bruno und interessierte sich schon für Mädchen. „Wie findest du die?“, fragte er eines Tages Bruno: „Ich finde, das ist die schönste Frau auf der Schule“. Bruno sah kaum hin. Ein etwas schleichender Gang, ja, ein hübsches Gesicht, mehr registrierte er nicht. Sie hieß Margarete, ließ er sich von Ahlers sagen, war gerade aus der DDR gekommen und ging mit Hans-Hermann, einem Apothekersohn, der zu den arroganten Söhnchen in seiner Klasse gehörte. Bruno interessierte sich nicht weiter dafür, akzeptierte aber achselzuckend, dass Ahlers ganz aus dem Häuschen war.
In der Schule hatte er keine Freunde. In seiner Nachbarschaft wohnte Peter, den er in der Volksschule nicht kennen gelernt hatte, weil er katholisch war. Peter war wie Bruno etwa 15 Jahre alt, ging aber schon in die Lehre, lernte Elektriker und verdiente bei seinem Lehrherrn bereits eigenes Geld. Peter war klein, drahtig, sportlich, er verehrte Elvis Presley und Peter Kraus, konnte Twist tanzen und sich wie Elvis rückwärts biegen, bis er mit den Schultern fast den Boden berührte und dann wieder hoch kommen. Peter hatte schon Freundinnen, die er küsste. Abends gingen sie in die Kneipe, zu Gruber, tranken Bier und spielten Skat mit Karl, einem älteren dicklichen Uhrmacher mit blondem schütterem Haar, dünner Stimme und zitternden Händen. Anfangs vereinzelt, dann immer regelmäßiger, saßen sie bis Mitternacht und darüber hinaus in der Kneipe und spielten um die nächste Runde Bier, bis sie angetrunken waren. Anfangs fürchtete Bruno sich, der Vater könne schimpfen, weil er immer später nach Hause kam, nach Bier und Rauch stank. Als aber nach einigen Wochen keiner ein Wort über seine Gewohnheiten verlor, wurde Bruno sicherer. Nun kam er fast jeden Abend zu spät nach Hause, trank und rauchte.
Die Quittung bekam er in der Schule: Zuerst nahmen sein Leistungen in Deutsch ab, seinem Lieblingsfach. Im deutschen Aufsatz hatte er selten eine Klassenarbeit mit einer schlechteren Note als gut zurückbekommen. Jetzt brachte ihnen der Deutschlehrer Besinnungsaufsätze bei. Die Themen waren nicht mehr „Dein schönstes Ferienerlebnis“ wo Bruno nach Herzenslust fabulieren konnte, sondern „Jugendherberge, Vorteile und Nachteile“. Da musste man Thesen zusammentragen und Antithesen, die man dann zu einer Synthese zusammenfasste. Bruno verstand das System nicht, war wohl auch wegen seiner Eskapaden zu müde, jedenfalls bekam er den ersten deutschen Klassenaufsatz mit mangelhaft zurück. Es folgte die Mathematikarbeit ebenfalls mit mangelhaft, ebenso oder schlechter in Englisch und Latein. Bruno versuchte sich zusammenzureißen, ohne rechten Erfolg. Im Herbstzeugnis stand dann das bedrohliche „Versetzung gefährdet“. Seine Eltern gingen zu den Lehrern, sie waren mit seinen Geschwistern Kummer gewohnt, aber doch nicht mit ihm, Bruno. Die Lehrer zuckten die Achseln. Ja, Bruno könne eigentlich mehr, sie wüssten nicht, woran es liege, im Augenblick reichten seine Leistungen nicht aus. Und keine Ermahnung der Eltern wegen der abendlichen Touren. Am Ende des Schuljahres blieb nur eine stille Hoffnung für Bruno: Alle Hauptfächer, Deutsch, Mathematik, Englisch und Latein, standen auf der Kippe. Alle konnten ihm ein ausreichend geben, dann war er gerettet und versetzt, alle konnten seine Leistungen aber auch mit fünf bewerten. Dann das Zeugnis: Alle vier Hauptfächer mangelhaft, und in Sport noch dazu: Sitzen geblieben.
15.
Bruno ging jetzt zum zweiten Mal in die zehnte Klasse, meinte, das könne er mit links schaffen. Er konzentrierte sich auf seine neuen Klassenkameraden. Bis auf Hans, den er dort wieder traf, kannte er keinen von ihnen. Gegen die Wiederholung der Klasse protestierte Bruno nicht mit neuer Leistungsverweigerung, sondern gab ab sofort die Kneipenbesuche mit Peter auf, weil er sich entschlossen hatte, die Schule erfolgreich zu Ende zu besuchen, Abitur zu machen, damit er einen Beruf wählen konnte, den er wollte. Die Tatsache, dass er sitzen geblieben war, hatte ihn zum ersten Mal über sich selbst nachdenken lassen, er hatte nach seiner Gewohnheit mit niemandem über seine neue Einstellung geredet, schon gar nicht mit den Eltern, sie war eine Folge seines Nachdenkens. Eine Form des Protestes gab es allerdings: Bruno wurde in der Schule widerständiger. Er, bei dem bisher, selbst im vorigen Jahr, in der Disziplin „Betragen in der Schule“ immer ein gut, wenn nicht sehr gut stand, bekam am Ende des Schuljahres in dieser Rubrik ein „nicht ohne Tadel“. Zum ersten Male hatte er über sich selbst nachgedacht und die Konsequenz daraus gezogen. Diese neu entdeckte Fähigkeit stärkte sein Selbstbewusstsein und seine Widerständigkeit gegen die Lehrer, die ihm Tadel eintrug.
Schon mit Beginn der neuen Klasse störte Bruno zum ersten Mal, dass er zu dick war. Dieser Gedanke war ihm nicht neu. In der Schule wurde er schon lange Zeit „Dicker“ genannt. Beim Baden wurde er gehänselt, er habe Brüste wie ein Mädchen. Bruno sah die anderen Knabenkörper, schlank, sportlich, und sich selbst, unbeweglich, der im Sportunterricht nicht die einfachsten Aufgaben bewältigen konnte. Der Sportlehrer legte seinen Ehrgeiz darein, Bruno den Aufschwung am Reck beizubringen. Bruno hing am Anfang wie ein nasser Sack an der Stange, zum Spott seiner Mitschüler, unfähig, sich zu bewegen.
„Ich bringe dir den Aufschwung bei“, sagte der Sportlehrer.
In der neuen Klasse war auch Margarete, die Ahlers ihm ein Jahr vorher gezeigt hatte. Bruno hatte jetzt Augen für sie: ein ovales, fein gezeichnetes Gesicht, mit geschwungenen Augenbrauen, einem schönen Mund. Was Bruno aber am meisten faszinierte: ihr Lächeln, sie hatte eine Art, fast schüchtern zu Boden zu blicken, während ihr Gesicht in dem Lächeln erstrahlte und schön wurde. Bruno hätte viel gegeben, wenn Margaretes Lächeln ihm gegolten hätte.
Am Abend kam er, als die Mutter ihn zum Essen rief, nur kurz herunter: „Mama, ab heute esse ich abends nicht mehr, ich bin zu dick!“, gab er kurz bekannt und verzog sich wieder zum Lesen auf sein Zimmer. Seine Mutter kam sofort hinterher: „Bruno, du musst doch essen, ohne Essen geht es nicht, du verhungerst mir doch.“ „Nein, ich bin zu dick, ich bin weit davon entfernt, zu verhungern“, antwortete er und blieb dabei, nicht nur an dem Tag, an den folgenden Tagen, sondern eine ganze Zeit lang, so lange, bis er sich nicht mehr zu dick fand; das war ungefähr nach einem Jahr. Da konnte er dann auch den Aufschwung. „Siehst du?“, sagte der Lehrer.
16.
In der Welt war Bundeskanzler Adenauer, der die Kindheit Brunos begleitet hatte, gerade abgelöst worden. Die Mauer in Berlin wurde gebaut, Kennedy wurde ermordet, die Franzosen rückten aus Vietnam ab, in das Vakuum stießen die Amerikaner nach, gleich energisch bekämpft von den Kommunisten aus Nordvietnam. Die ganzen fünfziger Jahre lang hatten sich Adenauer von der CDU und Kurt Schumacher von der SPD erbitterte Wortgefechte geliefert. Von alledem war nur ein schwaches Echo nach Neuburgheim gedrungen, und von dem schwachen Echo wiederum nichts in die Familie, in der Bruno aufwuchs. Der Vater war zunächst ein Anhänger einer Gruppierung gewesen, die sich „Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten“ nannte. Diese Partei plädierte für die sofortige Rückkehr in die Ostgebiete, so dass der Vater ihr mit einiger Plausibilität anhing. Als die Partei aufgelöst wurde, wählte der Vater die CDU. Sein bevorzugter Politiker, seit Bruno sich erinnern konnte, war Franz Josef Strauß von der CSU.
Trotz der Wortgefechte, die sich die Politiker lieferten, lag eine bleierne Starre über dem Land. 1945 war Deutschland zusammengebrochen. Die meisten Deutschen waren den Parolen der NSDAP gefolgt, die gegen die Kommunisten, die Juden und alle anderen hetzten, die nach ihrer Ansicht an der Misere Deutschlands Schuld waren. Die Kommunisten wollten Deutschlands Verderben, das war auch die oft geäußerte Auffassung von Brunos Vater, wenn in der Familie über Politik geredet wurde. „Ich habe gesehen, wie die Kommunisten in einem Dorf die Kirche zerstört haben, die die Nazis dann wieder aufgebaut haben“, erzählte er oft. Nun war zwar der Krieg verloren, die Nazis wie vom Erdboden verschwunden, die Ostgebiete und damit das eigene Gut in fremden Händen, aber waren dadurch die Kommunisten besser geworden? Wollten sie nicht immer noch alles enteignen? Und die Juden? Galt die jüdische Weltverschwörung nicht mehr, nur weil Deutschland den Krieg verloren hatte? Brunos Eltern konnten das nicht glauben. Richtig heraus mit ihrer Meinung trauten sie sich aber auch nicht, sie wären dann von ihrer Umgebung als unverbesserlich und rückständig verschrien worden, von Menschen, die vielleicht das Gleiche dachten, aber sich ebenfalls nicht trauten, immerhin hatte Deutschland den Krieg verloren.
Und nicht nur Brunos Eltern waren auf diese Weise verunsichert. Keiner traute sich, eine politische Meinung zu haben. Verbal vertraten alle die Meinung, die Nazizeit sei falsch gewesen, falsch auch der Krieg. Bruno kam viel später ein Zitat des von seinem Vater bewunderten Strauß in den Sinn: „Dem Deutschen soll die Hand abfallen, der noch mal eine Waffe in die Hand nimmt“. 1955 kam die Wiederbewaffnung Westdeutschlands und die Gründung der Bundeswehr.
Das Ahlener Programm der CDU las sich wie eine linke SPD Postille. Von der Verantwortlichkeit des Eigentums gegenüber dem Ganzen war die Rede, von friedlicher, unbewaffneter Entwicklung Deutschlands. In die Verfassung schrieben die Väter in Artikel 14, das Eigentum sei sozial verpflichtend. Wenn es dem Wohl der Allgemeinheit diene, könne umfassend enteignet werden. „Ein Weg“, wie 20 Jahre später ein Verfassungsrechtler schrieb, „der zwar möglich ist, aber nie gegangen werden wird.“
Die all diese Reden führten, diese Programme schrieben, waren ja 1945 nicht neu geboren worden. Die Biographien vieler Männer, die jetzt die Politik bestimmten, reichten bis zum Jahre 1933 und fuhren bruchlos 1945 fort. Was in der Zwischenzeit geschehen war, war unbekannt oder bedeutungslos. So geschehen in Biographien von Strauß und Hanns Martin Schleyer, dem späteren Arbeitgeberpräsidenten und vielen anderen.
Einige wenige wurden, hohe Ämter innehabend, als ehemalige Nazifunktionäre entlarvt und widerwillig aus ihren Positionen geholt, wie der Kanzleramtsminister Adenauers, Globke, oder der frühere NS Marinerichter Filbinger, der Ministerpräsident von Baden – Württemberg war und erst spät von einem Schriftsteller als Richter entlarvt wurde, der noch zum Ende des Krieges Todesurteile für die Nazis verkündet hatte. Sie alle waren nur kurz verunsichert. Sie hatten sich blitzartig auf die neue Situation eingestellt und in der neuen Bundesrepublik Karriere gemacht; 40 Jahre später hätte man sie Wendehälse genannt.
Alle diese Ereignisse und Personen führten dazu, dass über den Krieg, die Nazizeit und wer die Nazis eigentlich gewählt und gefördert hatte, nicht geredet wurde. Filme wurden gedreht, die sich nicht mit Politik, mit Nazis, mit Verbrechen beschäftigten, sondern mit „Ferien am Wörtersee“, dem „Wirtshaus im Spessart“ und die Schauspieler wie Peter Kraus, Sabine Sinjen, Nadja Tiller und Walter Giller hervorbrachten: unpolitisch, freundlich, harmlos. Wenn Filme ernsthaft wurden, beschäftigten sie sich mit unpolitischen Heldentaten deutscher Soldaten im Krieg, die natürlich alle den Nazis fern gestanden hatten
Im Übrigen war man in Deutschland mit Geld - Verdienen beschäftigt. Deutschland musste aufgebaut werden. Bruno sah erst sehr spät auf Fotos das Ausmaß der Zerstörung, die der Krieg angerichtet hatte. In Neuburgheim war nicht viel zerstört, nicht für Bruno sichtbar. Hunger, ja, den hatte er als Kind miterlebt, Armut, aber nicht die direkten Folgen. Der Aufbauphase in den Städten folgte die Essphase, man hatte die Hungerzeit hinter sich gelassen, dann die Autophase, die Reisephase und so weiter. Mit der Vergangenheit sich zu beschäftigen, nein, dazu hatte man keine Zeit.
Wohl gab es schon in den fünfziger Jahren auch die anderen, die mahnten, die sich 1955 gegen die Bewaffnung Deutschlands stemmten, die die Vergangenheit unter Hitler aufgearbeitet haben wollten, Kabarettisten wie Neuss und Hildebrandt, Schriftsteller wie Rühmkorf, später Ulrike Meinhof. Ihre Stimmen reichten nicht sehr weit in jenen Tagen, keinesfalls aber bis nach Neuburgheim, in Brunos Familie und damit zu Bruno selbst.
Bruno entwickelte sich spät, sehr spät.
Traurig lächelte Bruno vor sich hin. Soeben hatte ihn Margarete verlassen, er saß allein in seiner Villa, die er mit Margarete zusammen bewohnt hatte, und dachte über Nazis, Krieg und Adenauer nach. Was ging ihn, und dazu noch jetzt, Adenauer an? Das alles lag doch weit zurück und dennoch, auch das, die Zeit der fünfziger Jahre, gehörte zu seiner Geschichte, die ihn zu dem gemacht hatte, was er heute war. Zwar reich und angesehen, aber von Margarete verlassen, die nichts von ihm wissen wollte.
17.
Bruno erinnerte sich: Die Fragen, die er sich damals stellte, kamen nicht aus ihm selbst. Von den politischen Problemen hatte ein Lehrer erzählt, der in der Klasse Kunstunterricht gab. Weil sie aber mit seinem Fach, Kunst, nach Meinung des Lehrers nicht viel zu tun hatten, vertiefte er sie nicht weiter.
Die Fragen nach Gut und Böse kamen nicht von der Schule, sondern aus seinen Gesprächen mit dem Pfarrer. Schon vor einigen Jahren hatte Bruno seinen Körper, seine Geschlechtsteile entdeckt und zu onanieren begonnen. Er hatte keine Ahnung, woher er wusste, dass das schlecht war, er wusste es einfach. In seiner Familie verleugnete man Sexualität, sogar die eigenen Körper, Nacktheit war verpönt, Bruno hatte seine Mutter nie bewusst, seine ältere Schwester zum letzten Mal mit 8 Jahren nackt gesehen. Was er über den Unterschied zwischen Männern und Frauen wusste, hatte er von Peter erfahren. „Mädchen haben Tittis, hast du schon gesehen?“ Ja, das hatte Bruno gesehen, beim Baden in den Flussgewässern. „Aber unten haben sie Löcher, da steckt man seinen Pimmel rein. Sie haben eins mehr als wir, glaube ich, eins zum Pinkeln und eins, wo man den Pimmel reintut.“ Bruno glaubte das nicht. Peter war auch nicht so sicher.
Bruno wusste daher, dass alles, was mit dem Unterschied von Mädchen und Jungen, von Männern und Frauen, zu tun hatte, böse war. Was er im Konfirmandenunterricht hörte, auch von Pastor Volkmann, entsprach dem: „Lasst die Finger von den Mädchen“, hieß es dann, „dazu seid ihr zu jung“. Mit Grauen erzählte man sich von dem einen oder anderen Bauernmädchen, das sich mit Jungen eingelassen hatte. „Jetzt muss sie heiraten“, hieß es hinter vorgehaltener Hand, „er hat sie wohl hinter einen Heuhaufen gezogen, das hat sie jetzt davon.“ Das hieß, dass sie ein Kind bekam. Wenn in der Kirche ein Paar heiratete, trug sie einen weißen Schleier. Wenn die Braut allerdings schwanger war, dann war ihr der weiße Schleier verboten, sie musste dann ein graues Hochzeitskleid tragen, so dass sie für jeden als Sünderin gebrandmarkt war.
Noch schlimmer war es, wenn eine Braut in einem weißen Schleier geheiratet hatte und dann ein Kind kam, bevor neun Monate herum waren. Dann nahm die ganze Gemeinde die Finger zur Hand, um zu zählen: „Im Mai haben sie geheiratet, Juni,“ der erste Finger wurde gehoben, „Juli,“ der zweite kam hoch, und auf diese Weise ,“August, September, Oktober, November, Dezember, Januar; aber das sind doch nur acht Monate!“ Man versuchte, herauszufinden, ob das Kind vielleicht eine Frühgeburt war, der Arzt wurde befragt, antwortete nicht; Wehe, wenn die Diagnose Frühgeburt sich nicht bestätigte, dann hatte sie in weiß geheiratet, obwohl sie hatte heiraten müssen. Sie war für ihr Leben gezeichnet.
Bruno kannte daher den Unterschied zwischen Gut und Böse besonders gut, wenn Mädchen im Spiel waren. Das, was man mit ihnen gerne getan hätte, war böse und damit Schluss. Und deshalb war Bruno so sicher, dass Onanieren auch böse war.
18.
Die Schule war zu klein geworden, Anbauten verunzierten das ursprüngliche Gebäude. Eine Erweiterung nach Osten hin, den Flügel des winkligen Gebäudes verlängernd, ein unschöner Bau, ein weiterer nach Norden, den anderen Winkel des Gebäudes verlängernd, ein neuerer Bau, fünfziger Jahre, schnörkellos, nüchtern, ebenfalls unattraktiv. In diesem Flügel hatte Bruno in diesem Jahr seinen Klassenraum, quadratisch gebaut, aus einfachem Sichtbeton, mit einer Decke aus Kunststoff, niedrig im Gegensatz zu den hohen Decken des Ursprungsbaus, das Zimmer nur geschmückt durch eine halb vertrocknete Palme, die dort stand, nicht leben konnte, weil keiner sich um sie kümmerte, aber auch nicht sterben, weil immer einer im letzten Augenblick sich erbarmte und ihr einen Tropfen Wasser gab, und durch einen Kalender mit Landschaftsbildern.
In der Pause standen sie im Klassenraum. Es war eine kurze Pause, in der sie nicht auf den Hof mussten. Draußen war es winterlich kalt, regnerisch und ungemütlich, drinnen war die Heizung voll aufgedreht. Sie standen an einer Wand, vor dem Kalender, das Blatt zeigte diesen Monat eine einsame Heidelandschaft, das in Bruno eine Erinnerung an die Heide in Neuburgheim wach rief.
„Nun, Bruno, denkst du nicht an schöne Stunden, wenn du das Bild ansiehst?“
Bruno war wie elektrisiert. Da war sie, Margarete, die er seit Wochen von ferne anhimmelte, das ovale, ebenmäßige Gesicht, mit gerader Nase, hoher Stirn, mit lächelndem Mund und Augen, Augen! Sie strahlten ihn an, diese Augen, Bruno wusste genau, wie sie es machte, ihn so anzustrahlen: Indem sie erst leicht den Kopf neigte, dann die Augen langsam hob, während sich dieses Lächeln über ihr Gesicht zog, und sie ihn jetzt voll ansah. Bruno traute sich kaum, diesem Lächeln zu begegnen, Schauer durchfuhren ihn. Sie, Margarete, sie hatte ihn angesprochen, Margarete, die er nur von fern anhimmelte, ihn hatte sie angesprochen und ihr Lächeln, mit dem sie alle Menschen bezauberte, galt allein ihm!
Bruno stand regungslos. Er konnte nicht glauben, dass diese Worte ihm galten, diese Augen ihn ansahen und er Adressat des Lächelns war, aber doch, es galt ihm, nach wie vor. Er lief weg, flüchtete zu seinem Platz, setzte sich und tat, als müsse er dringend noch für die nächste Stunde etwas lesen, etwas machen, irgendetwas, um zu verbergen, dass er vor Schüchternheit keinen Ton herausbringen, dass er ihr nicht antworten konnte, dass er nicht geschickt genug war, wie er sich später in der Erinnerung ausmalte, keck zu antworten: „Wieso, waren wir beide da schon einmal?“. Aber er konnte es nicht. Träumte er denn nicht seit Wochen von ihr? Freute er sich nicht jeden Morgen aufs Neue, in die Schule zu gehen, weil er sie, ihr Gesicht dort sehen konnte? War er nicht seit Wochen in sie verliebt, heimlich, sah sie an, quer durch den Klassenraum, wenn er meinte, dass sie ihn nicht sah? Lag er nicht nachts schlaflos, weil er an sie dachte, und fieberte er nicht den ganzen Nachmittag, den Abend, die Nacht und den Morgen der Schule entgegen, fuhr ihm die Bahn nicht schnell genug, damit er in die Klasse zu ihr kam, um in ihrer Nähe zu sein, sie zu sehen? Und nun sprach sie ihn einfach an, ihn, Bruno. Und er lief weg.
Die nächsten Tage träumte Bruno von dieser Ansprache, dann wieder verzweifelte er: Margarete „ging“ mit Hans-Hermann, einem Mitschüler aus der Stadt, der natürlich attraktiver, intelligenter und sportlicher war als ausgerechnet er, Bruno. Dem könnte er nie das Wasser reichen, er versuchte es nicht einmal. Und übrigens: man nahm einem Klassenkameraden nicht das Mädchen weg, das gehörte sich nicht, was sollten denn die anderen denken. Ganz unmerklich fand Bruno Begründungen dafür, sich Margarete nicht zu nähern.
Der Geist der Zeit, der die Jungen seiner Generation bewegte, erleichterte ihm das Ausweichen: Musste das Mädchen, das ich einmal heirate, Jungfrau sein? Bruno, fromm und pietistisch kirchlich, wie er durch den Pfarrer in Neuburgheim war, legte sich zurecht, dass es dann natürlich auch verboten war, mit einem Mädchen zu gehen. Er brachte zwar die Diskussion um die Jungfräulichkeit nicht mit Margarete in Verbindung. Rein, keusch und himmlisch, wie Bruno sie sah, war sie ohnehin Jungfrau und würde es bleiben. Und so ging dieser Tag, gingen diese Tage vorüber, Tage, Wochen und Monate, ohne dass Bruno auch nur den geringsten Versuch machte, sich ihr zu nähern. Auch Margarete wiederholte ihren Versuch nicht, nachdem er fluchtartig weggelaufen war.
19.
Bruno dachte nun Tag und Nacht an Margarete, er wachte auf und hatte ein Gefühl, ihm sei etwas Wunderbares widerfahren, obwohl er nicht wusste, was es war. Und dann fiel sie ihm ein, Margarete, und er wusste, warum er glücklich war. Er konnte an ihr Gesicht denken, daran, wie sie ging und daran, dass er sie heute wiedersehen würde. Sein Herz brannte, aber es glühte nach innen, er sah keine Möglichkeit, ihr nahe zu kommen, um ihr seine Zuneigung zu gestehen. Er war ratlos und verbrannte, ohne sich bei anderen Rat suchen zu können. Seine Eltern fielen als Ratgeber aus, sie würden ihn wieder zurück stoßen, ihn auslachen. Aber auch sein Freund Hans kam als Gesprächspartner nicht in Betracht. Hatte er doch ihn, Bruno, auf ein anderes Mädchen aufmerksam gemacht, Lieselotte, die sehr schöne Beine hatte. Sie gingen bewusst, die beiden Freunde, hinter ihr die Treppe hinauf, damit sie von unten die Beine betrachten konnten, ziemlich hoch hinauf. Hans war begeistert und hatte in seiner spöttischen Art Lieselottes Beine mit den „dicken Beinen“ von Margarete verglichen. Also auch Hans nicht und andere kannte Bruno nicht näher.
Und so spielte sich auch seine Leidenschaft für Margarete ebenso wie alles, was ihm wichtig war, im Innern ab, im Gegensatz zu dem äußeren Leben, das er führte. In der Schule hatte er sich erholt. Seine Leistungen waren jetzt befriedigend, so jedenfalls die Zeugnisse, und ganz langsam löste er sich auch von der Abgeschlossenheit des Elternhauses.
In der Schule brachte ihm ein Deutschlehrer mit großem Verständnis die Literatur nahe: Bruno hat immer gelesen, viel, wahllos, und auch früh schwierige Bücher, Oscar Wildes Dorian Grey und den Tristam Shandy, daneben aber auch immer noch und immer wieder Karl May. Herr Lührsen, der Deutschlehrer, brachte ihn, er war mittlerweile in der 11. Klasse, zum ersten Mal mit Goethe in Kontakt, mit Thomas Mann, weniger begeisternd, mit Schiller. Goethe, besonders den Faust, dort besonders die Liebesgeschichte zwischen Faust und Gretchen, hatten es ihm besonders angetan, ebenso die Leiden des jungen Werther. War das nicht seine Liebe zu Margarete, die da beschrieben wird, fragte er sich verwundert, aber woher kannte Goethe das? Bis ihm aufging, dass es außerhalb seiner Existenz und seiner Zeit, noch andere Existenzen und Zeiten gegeben hat, die sein, Brunos, Erleben, zeitlos machen, ihm aber auch die Bedeutung des Einzigartigen nahmen.
Und mit der Erkenntnis, dass er eben nicht einzigartig in seinen Erlebnissen war, wuchs in ihm die Neugier, was sonst in der Welt geschah. Herr Nordhausen, der Lehrer für Gemeinschaftskunde, war hier wegweisend für ihn. Er ermunterte seine Schüler, Zeitung zu lesen, sich zu informieren, ermunterte sie nicht nur, sondern fragte auch aktuelle Ereignisse der letzten Woche ab. Herr Nordhausen wurde von den Schülern für einen Tyrannen gehalten, er hatte braune Augen, die höhnisch blinzelten, wenn ein Schüler vor ihm stand und nicht gelernt hatte oder nicht wusste, was in der Welt geschehen war. Und so las Bruno mit neuem Interesse die Zeitungen. Von Vietnam, diesem winzigen Land weit hinten in Südostasien, las er, wie erst die Franzosen ihre ehemalige Kolonie verließen, wie die Amerikaner die „Lücke füllten“, wie sie und Herr Nordhausen das nannten, wie sie „den Vietcong“ bekämpften, die Guerillas, Kommunisten, wie Amerikaner und Herr Nordhausen nicht müde wurden, zu betonen.
„Die Amerikaner müssen aus Vietnam heraus“, war die Meinung der Schüler in Bruno Klasse, aber da kamen sie schlecht an.
„Die Kommunisten verfolgen die Salamitaktik“, dozierte der Lehrer, „erst Russland, dann China, dann Nordvietnam, dann Südvietnam, dann Laos, Kambodscha und so, nach kurzer Zeit, die ganze Welt.“
Erschlagen und genervt schwiegen die Schüler, unter ihnen Bruno. Es war nicht gut, Lehrern, und schon gar nicht diesem Lehrer, zu widersprechen, und so sicher waren sie, die das Denken gerade erst lernten, auch nicht.
Aber abends, nach der Schule, trafen sich die Schüler in Gruppen oder zu Klassenfesten und schärften in leidenschaftlichen Diskussionen ihren Verstand. Baudelaire lasen sie in kleinen Zirkeln, Villon, als Kontrast zu den in der Schule präsentierten Klassikern Goethe und Mann. Davon wusste Bruno noch nichts. Immer noch stockte ihm die Zunge, wenn er über Dinge reden sollte, die außerhalb des Alltäglichen lagen und er nicht spötteln konnte. Er las, und das war für ihn geradezu revolutionär, seit Neuestem den „Spiegel“, den sein Vater für linksradikal und kommunistisch hielt, den er aber seinem Sohn dennoch weder verbieten noch ausreden konnte. Langsam, ganz langsam lernte Bruno, was es außerhalb Neuburgheims und seiner Familie sonst noch gab. Großartig, drohend und bis an die Zähne mit Atomwaffen gerüstet, standen sich die beiden großen Ideologien der Zeit gegenüber, der Kommunismus und die „Marktwirtschaft“, von den anderen Kapitalismus genannt, Amerikaner und Russen, die „westliche Welt“ und die Barbaren. Wir lebten in der Marktwirtschaft, die Demokratie bedeutete Freiheit, in der jeder sagen konnte, was er wollte und reisen konnte, wohin er wollte. Und ging es uns nicht glänzend, hatten wir mit unserem System nicht ein blühendes Land aufgebaut? Leise Zweifel kamen auf: War nicht das Eigentum völlig ungerecht verteilt? Hatte nicht die Währungsreform, in der „jeder mit vierzig Mark angefangen hatte“, schon den Kern zu Ungerechtigkeiten gelegt, indem die einen nach wie vor Eigentum an Produktionsmitteln hatten, die anderen eben die vierzig Mark? Und bedeutete das Eigentum an Produktionsmitteln nicht Herrschaft über die, die arbeiteten? Aber weggefegt wurden diese Zweifel in der Welt Brunos. Die anderen, das waren Kommunisten, der Sowjet, der unser Land, unser Eigentum und unser Leben bedrohte. Und der Sowjet hatte eben auch die Auseinandersetzung in Vietnam begonnen.
Bruno hatte übrigens wahrhaftig andere Sorgen. Er traf Margarete in den Zirkeln, in denen die Schüler diskutierten. Treffen seiner Freunde, zu denen sie kam, machten ihn besonders glücklich, konnte er sie doch an Nachmittagen ebenfalls sehen. Er blieb dann mittags in Hermstadt und fuhr abends zurück. Das Glück war aber nicht ungetrübt, sprach sie doch zwanglos auch mit den Klassenkameraden, lächelte sie an, und war sie nicht zu Johannes, einem Schüler aus der oberen Klasse, besonders nett? Margarete, so träumte er Tag und Nacht, so träumte er nachmittags in seinem Zimmer im elterlichen Hause. Schularbeiten brauchte er kaum zu machen, wenn er um halb vier nach Hause gekommen und Mittag gegessen hatte, konnte er träumen und denken. Und wie viel hatte er zu denken! Am Ende der 11. Klasse, Bruno war jetzt achtzehn Jahre alt, hatte es ein Klassenfest gegeben. Bruno hatte sich einen Anzug angezogen und war mit Schlips und Kragen mit dem frisch erworbenen Führerschein und mit Vaters Auto in die Stadt zum Fest gefahren. Mitschüler führten Sketche auf, die in Mode waren und dann wurde getanzt. Irgendwann nahm Bruno all seinen Mut zusammen, zu sehr litt er unter seiner Liebe, stand auf, ging zum Platz von Margarete und forderte sie formell zum Tanzen auf. Und Margarete lehnte nicht ab, sie lächelte ihn freundlich an, sagte „Gern“, stand auf und sie tanzten! Bruno brachte kein Wort heraus. Selig schwebte er über die Tanzfläche, Margarete im Arm, und folgte den Rhythmen der Musik. Nachher führte er sie zum Tisch, wie er es gelernt hatte, verbeugte sich und schwebte an seinen Platz zurück. Später wusste Bruno nicht mehr, wie der Rest des Abends verlief, er wusste auch nicht, wie er und wann nach Hause gekommen war. Er wachte am nächsten Morgen auf, sein weißes Nyltesthemd, das er am Abend getragen hatte, an seine Nase gepresst: es atmete noch den schwachen Geruch von Margaretes Parfüm.
Bruno hatte im großen Elternhaus jetzt ein Zimmer für sich. Karg war es eingerichtet, nüchtern bis zur Lieblosigkeit, ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl davor, ein Bücherregal und daneben ein Sessel. An der Lehne eine Klemmleuchte. Bilder gab es keine, schon gar nicht Pflanzen, nichts, was den kahlen Raum verschönert hätte. Auf dem Sessel wurden alle seine Phantasien Wirklichkeit. Hier träumte er von Margarete, hier las er, bis ihn die Müdigkeit übermannte. Seine Verweigerung des Abendessens hatte Erfolg gehabt. Bei gleich bleibendem Gewicht war Bruno in einem Jahr zwanzig Zentimeter gewachsen, war jetzt ein schlanker, großer Jüngling, mit gerader Nase, vollen Lippen, dunkelbraunem Haar und hoher Stirn. Finster blickte er zumeist in seine Umgebung, nur selten lachte er oder lächelte auch nur. Wenn er aber lachte, strahlten seine Augen in einem hellen Glanz, sein ganzes Gesicht war Licht. Er fand sich aber immer noch zu dick, er betrachtete mit Misstrauen seinen Körper, war hier nicht noch etwas zu viel Fett und da nicht auch? Bestärkt wurde sein Gefühl von seinen Kameraden, die ihn immer noch „Dicker“ nannten.
20.
Bruno erinnerte sich genau, wie er sich täglich gefragt hatte, wann er Margarete wieder so nah sein oder wenigstens mit ihr sprechen konnte. Ein Tag, an dem sie ihn ansprach, war ein guter Tag, wenn er auch noch passabel geantwortet hatte, war das noch besser, ein Moment, von dem er tagelang zehrte. Er hätte in den Pausen sich ihr nähern können, in den großen Pausen mussten sie alle auf den Schulhof gehen, ob es auch regnete und schneite. Die Kleinen tobten dort herum, die Großen, zu denen Unterprimaner allemal zählten, gingen in kleinen Gruppen und Grüppchen auf dem Schulhof auf und ab. Natürlich hätte Bruno zu Margarete gehen und ihr seine Begleitung antragen können, aber was würde sein Schulfreund Hans dazu sagen Außerdem würde Heike, mit der Margarete jede Pause verbrachte, ja nicht weggehen, man müsste also zwei Mädchen fragen. Außerdem, was hätte er sagen sollen? Bruno nahm die Bedeutung von Worten sehr genau, lieber verzichtete er auf den Gebrauch eines Wortes, als dass er in Kauf nahm, dass es nicht genau das traf, was er hatte sagen wollen. Ein Satz wie „ich liebe dich“ war für ihn nicht auszusprechen, nie, unter keinen Umständen, nicht einmal Margarete gegenüber, denn, war er sich seiner Sache sicher? Wie konnte er sich sicher sein, dass es Liebe war, die er empfand? Er schwieg und Schweigen war tatsächlich das ihm angemessene Verhalten, obschon er schmerzlich das Unpassende des Schweigens empfand, zumal, wenn er in der Nähe von Margarete war, der er gerne mit Eloquenz imponiert hätte. Nein, Margarete in der Pause einfach ansprechen und mit ihr über den Schulhof gehen, das ging nicht. Aber wie sollte es weitergehen?
Wie konnte er wieder eine Situation herbeiführen, in der er Margarete näher begegnen, vielleicht sie wieder zum Tanzen auffordern konnte? Bruno war mittlerweile in der Klasse, mit der er dem Abitur zustrebte, integriert, hielt mit allen gute Kameradschaft, war beliebt. So fiel sein Vorschlag, man könne doch häufiger Klassenfeste feiern, auf fruchtbaren Boden. Alle zwei Monate trafen sie sich jetzt zum Tanzen. Bruno war nie ein Liebhaber moderner Musik gewesen, jetzt begann er sie zu schätzen: Wild oder ganz langsam tanzte er mit Margarete zu den Rolling Stones mit Satisfaction, Beatles mit Sergeant Pepper, immer wieder, für Bruno am liebsten ohne Pause, schnell, langsam und an irgend einem Abend, nach irgend einem wilden Tanz mit ihr, legte jemand sehr langsame, sehr sanfte Musik auf. Er hielt Margarete am Arm, mit Abstand, wie sie immer wieder und wieder getanzt hatten und da kam sie auf ihn zu, legte ihre Arme um seinen Hals, tanzte Körper an Körper mit ihm. Er drückte sie fest an sich, ohne dass ein Wort fiel, so tanzten sie, den ganzen Abend, immer unterbrochen von schnellen, wilden Tänzen, in denen sie sich widerwillig voneinander lösten und nach denen sie wieder in ihre Umarmung zurückkehrten. Der Himmel stand Bruno offen.
Irgendwann war der Abend vorbei. „Darf ich dich nach Hause bringen?“, war der erste Satz, den er leise zu ihr sagte und sie nickte. Im Auto saß sie neben ihm, er war sich ihrer Anwesenheit, wie den ganzen Abend, auch hier mit schmerzlicher Intensität bewusst. Fahrend legte er den Arm um sie. „Margarete“, begann er und wollte ihr nun seine tiefe Liebe gestehen. „Nein, bitte, sieh auf die Straße und halte beide Hände am Lenkrad, ich habe sonst Angst.“ Er nahm den Arm zurück, nahm innerlich auch das „Margarete“ zurück und fuhr sie nach Hause. Dort angekommen, stellte er den Motor ab. Sie saßen nebeneinander, er hörte sie atmen, bemerkte ihr Zögern und traute sich nicht, noch einmal anzufangen, das „Margarete“ gleichsam wieder aufzunehmen. Sie wartete und, nachdem auch sie nur sein Atmen hörte und er sich ihr nicht näherte, flüsterte „Gute Nacht“, stieg aus und verschwand im Haus, nicht ohne sich an der Tür um zudrehen und ihm zuzuwinken.
Bruno fuhr nach Hause und verbrachte eine weitere Nacht mit seinem Nyltesthemd, das diesmal viel stärker ihr Parfüm ausströmte.
21.
Eines Nachmittags saß er zu Hause, die Schularbeiten waren gemacht, er hatte gelesen, Thomas Mann war sein neuester Favorit, nun sehnte er sich, Margarete wiederzusehen. Vorsichtig fragte er bei seinem Vater an, ob dieser das kleine Auto, einen Opel Kadett, heute Abend brauche. „Nein, brauche ich nicht“, antwortete der Vater, „aber du kennst ja die Konditionen. Fünf Pfennig pro Kilometer ziehe ich dir vom Taschengeld ab.“ Zitternd ging Bruno zum Telefon, verzagt, in sich die Frage: Soll ich oder soll ich nicht? Er griff zum Telefon, wählte die Nummer in Hermstadt, die er längst auswendig wusste, obwohl er sie noch nie gewählt hatte, und hoffte, dass sie abnahm, und nicht die Eltern. Erleichtert atmete er auf, als er ihre Stimme hörte, die reine Altstimme „Ja? Hier Margarete Leuchtenfeld?“ „Bruno ist hier“, zögernd und schwankend zwischen Hitze und Kälte, Schüchternheit und Draufgängertum. „Bruno, wie schön, was möchtest Du?“ „Ich hatte gedacht, wir könnten heute Abend tanzen gehen, in den Club, wir beide.“ Sie zögerte. „Ja, ich überlege, doch, das geht, soll ich nicht Anna anrufen und Karl, dann gehen wir zu viert?“ Mit Anna redete Bruno sehr gern, Anna war mit Karl befreundet, wie Bruno vom Land stammend, der aber häufig in der Stadt war, um Anna zu besuchen. Bruno wäre gern auch mit Margarete allein gegangen, aber mit Anna und Karl war er einverstanden, Hauptsache, Margarete ging mit. „Ich hole Dich um ½ acht ab. Sagst Du Anna Bescheid?“ „Ja, ich erwarte Dich.“
Hoch klopfte das Herz Brunos, als er los fuhr, es klopfte immer noch, als er bei ihr klingelte und sie öffnete und er ihr Gesicht sah, das ihn anstrahlte, mit ihren Augen, mit ihrem Mund und er sehen konnte, dass sie sich freute.
Sie tanzten. Bruno hatte sich daran gewöhnt, sie eng an sich zu ziehen und er war glücklich mit ihr, ohne zu reden. „Hast Du mich denn ein bisschen gern?“ fragte sie ihn und riss ihn damit aus seinen Träumen. Er hatte von ihr geträumt, die er doch in den Armen hielt. Ja, er hatte sie gern, und mehr als nur ein bisschen? Nein, er hatte sie nicht gern, er liebte sie doch, mit seinem ganzen Herzen und mit der ganzen Seele, er schrie nach ihr. Aber traf das Wort Liebe den Kern? Durfte man, durfte er, Bruno, ihr so etwas sagen, mit diesem Wort, rein, hehr, keusch, war er dieses Wortes und dieses Gefühls würdig? Wie sollte er ihrer würdig sein, was tun, um ihr zu zeigen, wie tief seine Gefühle für sie gingen? Er konnte das nicht. „Wie soll ich Dir das denn beweisen?“, fragte er, fast barsch, und „gar nichts sollst du beweisen, nur sagen“, antwortete sie, danach war wieder Schweigen, und wieder brachte er sie nach Hause, und wieder war nicht mehr, was hätte auch sein sollen? Was wollte er von ihr? Sie küssen? Das ging nicht, er traute sich das nicht und das war auch unkeusch, unsittlich, vertrug sich nicht mit seinem Glauben. Christus hatte doch, so hatten ihn die Pastoren gelehrt, zur Enthaltsamkeit gemahnt. Und so schlief Bruno diese Nacht wiederum an sein Hemd gekuschelt, das nach ihr roch.
22.
Sie hatten ein Motorrad gekauft, Bruno und sein jüngerer Bruder, eine 250 iger BMW, die sie abwechselnd und nach Absprache nutzten. In diesem Jahr war Bruno an der Reihe, damit in Urlaub zu fahren. Mit einem Freund auf dem Sozius fuhr er los, nach Holland, nach Brüssel, nach Paris. Eine furchtbare Reise, fast ununterbrochen regnete es. Die beiden Freunde schliefen im Zelt, das in der zweiten Nacht durchregnete. Am Tage kämpften sie sich gegen die Kälte und den Regen nach Süden vorwärts, hielten sich in Brüssel vier Tage auf, weil dort die Sonne schien, fuhren weiter nach Paris, zelteten dort, besichtigten Eiffelturm, Louvre und die Clochards und fuhren den ganzen Rückweg durch Regen, Kilometer um Kilometer. Sie ernährten sich die ganzen vierzehn Tage lang von Dosen, Linsen in Dosen, die sie mit dem Messer öffneten und kalt auslöffelten. Aus Paris schrieb er eine Ansichtskarte an Margarete, in der er die Erlebnisse kurz und spöttisch schilderte.
„Das muss ja abenteuerlich gewesen sein“, sprach sie ihn nach den Ferien an, „vielen Dank für die Karte.“ Bruno erzählte von der Fahrt.
„Und das Motorrad, hast Du das noch? Ich bin noch nie mit einem Motorrad gefahren.“ „Willst Du mal mit mir fahren?“, fragte er zurück. „Ich kann Dich am Wochenende abholen, wenn das Wetter gut ist, nicht im Regen“, bot Bruno an. „Am Sonntag wäre toll“, lächelte sie. „Ich bin Sonntag um 11 Uhr mit dem Motorrad bei Dir und hole Dich ab, wenn es regnet, rufe ich Dich an.“
Und Bruno betete drei Tage lang, Donnerstag, Freitag und Sonnabend, um Sonne für Sonntag. Jeden Tag sah er sie, war aber immer noch zu schüchtern, um sie noch einmal darauf anzusprechen oder ihr seine Vorfreude mitzuteilen.
Und Sonntag schien die Sonne mit aller Kraft, es schien, als wolle sie Bruno Mut machen. Mit lachendem Herzen stieg er auf die BMW und fuhr los, der Wind wehte ihm warm ins Gesicht, die Haare flatterten ihm am Kopf. Jubelnd genoss er die Landschaft, die sonst meistens grau und flach war und auf ihn etwas trist und melancholisch wirkte, jetzt aber, im Sonnenlicht, leuchtete. Bruno sah die Frucht auf den Feldern, den Roggen, golden die Ähren, reif, die Kartoffelpflanzen in grünen Reihen und zwischen den Feldern die Bäume, hochsommerlich dicht belaubt. Nie hatte er diese Landschaft in so herrlichen Farben gesehen, die Dörfer, Kampshausen, Altkirchen, Neukirchen. In Neukirchen läuteten die Glocken einer Kirche, voll, dunkel, sonntäglich und bezeugten sein Glück.
Sie fuhren spazieren, gingen im Waldsee baden, trafen einen Schulkameraden, der Hand in Hand mit seiner Freundin ebenfalls den sommerlichen Tag genoss, gingen aber nebeneinander, ohne dass Bruno sich getraute, ihre Hand zu fassen, gingen durch Wälder, an Feldrainen vorbei, spürten das Land, die Natur, sogen die Kraft in sich auf, die Wärme, den leichten Wind.
Auf dem Rückweg fühlte er ihren Körper hinter sich auf dem Soziussitz.
Vor ihrem Haus angekommen, stieg sie von der BMW, er blieb sitzen. Schweigend stand sie, schweigend saß er auf dem Motorrad. Sie sah ihn an: „Was willst Du eigentlich von mir?“, fragte sie ihn und sah ihn liebevoll an. Bruno fühlte sich ertappt. Ja, was wollte er eigentlich von ihr? Mit ihr durch das Land fahren, ja, und weiter? Bruno wagte nicht, weiter zu denken, sie vielleicht küssen? War das das Äußerste, das er sich vorstellen konnte? Aber das würde sie bestimmt ablehnen, wie könnte eine so strahlende schöne Frau mit einem hässlichen dicken Mann wie ihm auch nur gehen wollen, geschweige denn ihn küssen oder gar noch mehr? „Ich will dich nicht heiraten“, antwortete er wieder fast barsch, gab Gas, ließ die Kupplung kommen und fuhr davon, ließ sie stehen.
23.
Bruno verlor sich in seinen Büchern, denn er traute sich kaum, von Margarete zu träumen, er ängstigte sich, seinen Phantasien nachzugeben. Er las all das, was in der Schule nicht gelehrt wurde. Zeit hatte er genug, die Schule forderte ihn nicht ernsthaft, er war wach in den Unterrichtsstunden. Hier kam ihm die Eigenschaft zugute, die er erst in späterer Zukunft schätzen lernte: er fasste sehr schnell auf, was Lehrer in der Stunde erklärten, er war aufmerksam und konzentriert, was den Vorteil hatte, dass er nicht nacharbeiten musste. Die eigentlichen Schularbeiten erledigte er in kürzester Zeit und hatte dann Muße, um mit Hans durch das Dorf zu schlendern. Nun sprachen sie mehr, aber immer noch spöttisch, über Politik. Sie tauschten sich aus über das, was sie gelesen hatten. Die DDR war es, an der sich die Freunde abarbeiteten. Bruno, konservativ von seinem Vater geprägt, war „gegen die Kommunisten“. Die hatten die Mauer gebaut, und im Übrigen waren Kommunisten von vornherein unakzeptabel. Hans war da noch unentschlossener. Klar, Ulbricht war ein Unterdrücker, aber Sozialismus, das hatten auch die Sozialdemokraten auf dem Banner, und das war gut. So stritten die Jungen.
Und dann wurde ruchbar, was die Amerikaner in Vietnam trieben. Sie bekämpften die Kommunisten, damit war Bruno noch ungeteilt einverstanden, aber sie brachten Zivilisten um, wahllos, in Mengen, mit furchtbaren Waffen, sie verbrannten ganze Wälder. Konnte, durfte man ein ganzes Land entvölkern, entlauben, verbrennen, verwüsten, nur um den Kommunismus zu bekämpfen?
Und je älter sie wurden, desto schärfer wurden die Debatten, desto mehr entfernte sich allerdings auch Bruno von den Ansichten seines Vaters. Sicher, immer noch verstand er, wie behindernd das Verbot zu reisen sein konnte, er wusste die Pressefreiheit zu würdigen, alles das gab es in den Ländern, in denen der Sozialismus die herrschende Lehre war, nicht. Aber Pressefreiheit? Wer hatte die denn in den sechziger Jahren in Westdeutschland? Sah Bruno nicht jeden Morgen die hetzenden Schlagzeilen der Bildzeitung, die, ebenso wie „Die Welt“ und alle Zeitungen des Springerverlages die tatsächlichen Gegebenheiten nicht akzeptieren wollten, die noch von der „sowjetisch besetzten Zone“, der „sogenannten DDR“ schrieb und die DDR in Gänsefüßchen setzte, als alle anderen schon längst die Existenz dieses zweiten deutschen Staates anerkannt hatten? Und schließlich, jenseits aller dieser praktischen Erwägungen, war das nicht eine großartige Idee, die von der Überwindung von Klassen und dem Absterben des repressiven Staates? Und die Russen? Warum hatte der Vater und hatten alle seiner Generation solche Angst vor den Russen? Bruno hatte Gräuelgeschichten gehört von den Taten der russischen Armee 1945 und hatte sie auch geglaubt. Aber anders als die Alten fürchtete Bruno nicht den Überfall der Sowjetarmee auf Westdeutschland, Bruno hatte die neuere Geschichte sorgfältig gelesen: Nie waren es die Russen gewesen in der Neuzeit, die zuerst nach Deutschland gekommen waren, immer waren entweder die Deutschen in den beiden Weltkriegen, oder vorher Napoleon mit seiner Armee, nach Russland einmarschiert und hatten erst so die russische Armee auf den Plan gerufen. Warum sollten eigentlich jetzt, in den sechziger Jahren, die Russen erstmals einfallen, ohne vorher überfallen worden sein? Bruno stellte die Frage ruhig, unprovokant seinem Vater, der darauf seinem Sohn überlegen antwortete, er kenne eben den Sowjet, den Ivan, nicht. Bruno schwieg.
Bruno schwieg mittlerweile zu allen Ansichten seiner Eltern. Sie waren gefangen in ihrer eigenen Geschichte, ihren eigenen Wertvorstellungen und Erinnerungen. Sie hatten mit den Dingen, die er lernte, nichts zu tun und konnten dazu wohl auch keinen Zugang haben.
Seine Eltern sprachen von den Dorfbewohnern immer noch als den „einfachen Leuten“. Wohl fühlten sie sich, wenn sie mit Mitgliedern der eigenen „Kiste“, so nannten sie das, zusammen waren, das waren Verwandte oder andere Flüchtlinge, die wie die Eltern von großen Gütern geflohen waren. Alle anderen waren einfach. Die tägliche Existenz der Eltern und der Familie sah komplett anders aus: Bruno hatte bei der „einfachen“ Frau Koopmann und der Schlachterin um Einkaufskredit betteln müssen. Wieso sollte er, der betteln musste, vornehmer sein als die, die er anbetteln musste? Bruno hatte dies nie verstanden. Und als Primaner sah er den Vater in seinem bürgerlichen Beruf als Versicherungsvertreter mit Herrn Hansmeyer konkurrieren, der ebenfalls Versicherungsvertreter war. Herr Hansmeyer ein „einfacher Mann“, der Vater dagegen nicht?
„Junge, sieh doch nicht aufs Geld, wenn du darüber nachdenkst, das ist doch nicht eine Frage des Geldes oder des Reichtums!“, war die Ermahnung der Eltern, wenn er sie darauf ansprach. Bruno schwieg wieder. Er wusste selbst, dass es nicht der Reichtum war, den die Eltern meinten. Aber zum einen, was denn sonst, was war das Unterscheidungsmerkmal, wenn nicht das Vermögen? An dem Namensbestandteil „von“ konnte es nicht liegen, im Dorf gab es eine Familie „von Twistern“, einfache Leute, wie die Eltern sagten. Es musste irgendetwas aus der Vergangenheit sein, das aber Brunos Gegenwart nicht berührte. Bruno fühlte sich daher der „bürgerlichen Klasse“ zugehörig, wie sie von den Theoretikern genannt wurde. Langsam, ganz langsam machte sich mit diesen Überlegungen, Diskussionen, mit der Lektüre Brunos Verstand geltend, bestimmte zunehmend seine Ansichten.
Auch mit Margarete sprach er nie über diese Erkenntnisse. Er wusste, dass ihr Vater Arzt war. Sie hatte nach Brunos Eindruck Armut nie kennen gelernt, wohl auch nie anschreiben lassen müssen. Margarete hatte eine Schwester, von der sie liebevoll sprach. Zu ihrem Vater, den Bruno nur einmal gesehen hatte, hatte sie ein sehr gespanntes Verhältnis. Margarete erzählte ebenso wenig wie Bruno von dem Verhältnis zu ihren Eltern, Bruno fragte auch nicht danach. Auch nach ihrem Leben in der DDR fragte er sie nie. Ihr Vater war, so hatte er von anderen gehört, aus der DDR geflüchtet, als sie zwölf Jahre alt war. Sie war dort also schon zur Schule gegangen, erzählte aber von sich aus nie darüber.