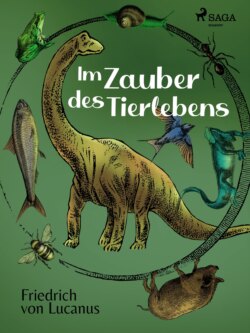Читать книгу Im Zauber des Tierlebens - Friedrich von Lucanus - Страница 4
Tiere der Vorwelt
ОглавлениеDie Fauna, die heute die Erde belebt, ist nicht das Werk eines einmaligen Schöpfungsaktes. Sie ist aus bescheidenen Anfängen hervorgegangen und hat sich allmählich zu jenen Formen ausgewachsen, die heute die jeweiligen Endglieder in der Stufe der stetig fortschreitenden Entwicklung und Umwandlung bilden.
Ebenso wie die Erde selbst vielfachen Umformungen unterworfen war, und unter dem Wechsel des Klimas die Vegetation eine wiederholte Umbildung erfuhr, war auch der Charakter der Tierwelt in den verschiedenen Erdperioden ein ganz anderer.
Die Paläontologie unterscheidet fünf Zeitalter der organischen Erdgeschichte: Das Archozoische Zeitalter oder Primordialzeit, das Paläozoische Zeitalter oder Primärzeit, das Mesozoische Zeitalter oder Sekundärzeit, das Känozoische Zeitalter oder Tertiärzeit und das Anthropozoische Zeitalter oder Quartärzeit, jene Zeit, in der der Mensch in die Welt tritt.
Innerhalb dieser Zeitabschnitte lassen sich verschiedene Unterabschnitte erkennen. Während die Primordialzeit nur eine Formation, die Laurentische, aufweist, setzen sich die übrigen Zeitalter aus mehreren Formationen zusammen. Es würde zu weit führen, sie alle einzeln zu nennen. Hervorgehoben sei nur, dass die Steinkohlenformation der oberen Primärzeit angehört, dass die Sekundärzeit sich in drei Formationen, Trias, Jura und Kreide, die Tertiärzeit ebenfalls in drei Formationen, Eozän, Miozän und Pliozän, und die Quartärzeit in zwei Unterabschnitte, Diluvium und Alluvium, das die heutige Zeitepoche ist, gliedert.
Diese Zeitperioden sind eine mehr oder weniger willkürliche Einteilung, ein System der paläontologischen Wissenschaft. In Wirklichkeit gibt es keine scharfen Trennungsstriche, sondern allmähliche, über Jahrtausende sich erstreckende Übergänge reihen die Erdperioden unmerklich aneinander und verschmelzen sie zu einem einheitlichen Ganzen. Langsam und allmählich entstand das Tier- und Pflanzenleben. Jahrtausende und Jahrmillionen waren notwendig, um eine Veränderung der Formen hervorzurufen, Altes vergehen und Neues entstehen zu lassen. „πáυτα ξɛг”, wie Heraklit so treffend sagte, „Alles dauernd im Fluss”. —
Das älteste Gestein der Laurentinischen Formation ist der kristallinische Schiefer. Da er Kohlensubstanz, Graphit und Anthrazit sowie Kalk enthält, so ist die Annahme eines organischen Lebens in dieser Zeit durchaus berechtigt; denn Kohle ist der Rückstand einer ehemaligen Vegetation und Kalk der Rest von Muschelschalen und anderen tierischen Gehäusen. Von anderer Seite wird freilich gegen die Annahme eines organischen Lebens in jener Zeitperiode Einspruch erhoben, weil im kristallinischen Schiefer Versteinerungen nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden können. Dann müsste man freilich annehmen, dass Kalk und Kohle in diesem Falle ihren Ursprung nicht aus der organischen Welt herleiten, sondern auf eine andere Weise entstanden sind. Dies widerspricht jedoch unserer Auffassung von dem Wesen dieser Stoffe.
Im Laurentinischen Gestein in Kanada fand man eigentümliche Gebilde, die ein Netzwerk von Verästelungen darstellten. Namhafte Forscher sehen hierin die Versteinerungen von einzelligen Tieren aus der Ordnung der Wurzelfüsser oder Rhizopoden, die aus einem Protoplasmakörper mit einem kalkartigen Gehäuse bestanden haben. Trifft diese Erklärung zu, dann würde dies einzellige Wesen der Primordialzeit das älteste Tier der Erdgeschichte sein, jenes Wesen, auf das sich die spätere Entwicklung der ganzen Tierwelt aufbaut und das gewissermassen die Morgenröte in der Tierwelt darstellt. Man hat es daher das „Morgenrötetier” genannt.
Von anderen Forschern wird freilich der organische Ursprung dieser Zeichen in dem ältesten kanadischen Gestein geleugnet. Sie meinen vielmehr, dass es sich nur um eine anorganische Bildung im Gestein selbst handelt. Die Frage ist heute noch ungelöst, und infolgedessen sind organische Versteinerungen in der Primordialzeit noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen.
In der Primärzeit, dem Altertum der Erdgeschichte, gab es in den ersten Perioden bereits Würmer, Krebse, Schnecken und andere Weichtiere, wie uns Abdrücke ihrer Fussspuren und Versteinerungen erkennen lassen. Sogar die ersten Wirbeltiere traten auf in Gestalt eigentümlicher Fische mit gepanzertem Körper und einer einheitlichen Augenöffnung auf der Mitte der Stirn, die darauf hindeutet, dass diese Tiere vielleicht einäugig waren; jedoch können in der länglich geschlitzten Augenöffnung auch zwei Augen dicht nebeneinander gelegen haben. Insekten, die an die heutigen Grillen, Skorpione und Eintagsfliegen erinnern, lebten bereits zu jener Zeit. Auch die typische Meeresfauna, Korallen, Stachelhäuter und Quallen, war schon vorhanden. Am Ende dieser Zeitperiode traten die ersten Amphibien und Reptilien auf.
Noch heute lebt auf Neuseeland ein Vertreter jener ältesten Reptilien. Es ist dies die Brückenechse (Sphenodon punctatus), eine etwa 75 cm grosse Eidechse von plumper Gestalt mit grossem, eckigem Kopf. Kopf, Rücken und Schwanz tragen einen Kamm aus Stacheln. Die Farbe des Tiers ist olivgrün mit kleinen hellen Flecken. In ihrem inneren Bau, dem Skelett und den Organen vereinigt die sonderbare Echse Merkmale der Lurche, Schildkröten und Schlangen. So bildet die Brückenechse eine Mittelform, eine „Brücke”, zwischen diesen Tieren. Der heutigen Brückenechse sehr nahe verwandte Formen, die Urbrückenechse und der Protorosaurus, sind bereits aus den Versteinerungen der oberen Primärzeit bekannt. Die Brückenechse ist daher eins der ältesten Wirbeltiere, das sich aus den Anfängen der Erdgeschichte bis auf den heutigen Tag in fast unveränderter Form erhalten hat.
Ein würdiges Seitenstück zur Brückenechse ist der Lanzettfisch, ein kleines, nur wenige Zentimeter langes fischähnliches Wesen, das an den flachen Meeresküsten lebt. „Ein Schauer der Ehrfurcht”, sagt Otto Steche in der neuen Ausgabe von Brehms Tierleben, „müsste den Beobachter, dem unsere Vorstellungen über die Entwicklung der Tierreihe nicht blosse Worte sind, beim Anblick dieses unscheinbaren Tieres erfüllen. Gilt es doch für den Urahnen unseres Stammes, das älteste Tier, von dem wir mit einiger Sicherheit die Reihe der Wirbeltiere ableiten können, als deren höchste Blüte wir Menschen uns zu betrachten gewohnt sind.”
Der Lanzettfisch (Amphioxus) bildet mit wenigen Verwandten den besonderen Unterkreis der schädellosen Wirbeltiere (Acrania), denen, wie schon der Name verrät, ein Schädel fehlt. In seiner langgestreckten, flachen Gestalt ähnelt Amphioxus einem dünnen Weidenblatt. Ein Kopf ist nicht vorhanden, sondern das vordere Leibesende läuft ebenso wie das hintere Ende in eine Spite aus, die eine runde Öffnung besitzt.
Äussere Gliedmassen fehlen, nur ein schmaler Flossensaum steht auf dem Rücken und verbreitert sich hinten zu einer lanzettförmigen Schwanzflosse. Eine eigentliche Wirbelsäule ist noch nicht vorhanden, sie wird nur durch einen dünnen, knorpeligen Strang angedeutet, der Achsenstab (Chorda dorsalis) genannt wird. Unmittelbar über dem Achsenstab, und mit diesem durch eine Scheide verbunden, läuft ein Markstrang, der dem Rückenmark der höheren Wirbeltiere entspricht. Die vordere Leibesöffnung dient als Mund, die hintere als After. Beide Öffnungen sind durch einen Darm verbunden. Der Darm ist durch eine Einschnürung in zwei Hälften geteilt. Der vordere Teil dient ausschliesslich der Atmung. Das zur Atmung durch die Mundöffnung eingezogene Wasser sickert durch die Darmwand in die Leibeshöhle und läuft durch eine besondere Leibesöffnung nach Verbrauch des Sauerstoffs wieder nach aussen ab. Der hintere Teil des Darmes besorgt die Verdauung der aus Infusorien bestehenden Nahrung, die mit dem Wasser aufgenommen wird. Ein am hinteren Darmteil befindlicher Sack funktioniert in einfachster Form als Leber. Ein Herz fehlt; der Kreislauf des farblosen Blutes wird durch die Adern selbst verursacht. Der Lanzettfisch ist getrennten Geschlechts. Ei- und Samenzellen befinden sich in kleinen Taschen im Leibe und werden durch die Mundöffnung ausgestossen.
Amphioxus stellt offenbar den Urtyp des Wirbeltieres dar. Er zeigt uns in seiner wurmähnlichen Gestalt die Umformung des Wurmes zum Wirbeltier. Mit Recht dürfen wir daher den Lanzettfisch als das älteste Wirbeltier betrachten, das jedenfalls noch bedeutend älter sein muss als die Brückenechse mit ihrer schon vollendeten Wirbeltiergestalt und jene Fische, die schon in der oberen Primärzeit die Gewässer bevölkerten. Sein Ursprung liegt viel weiter zurück, er ist eine Schöpfung mindestens der ältesten Primärperiode, der Kambrischen Formation, vielleicht sogar der allerältesten Zeitepoche, des archozoischen Erdalters.
Die typischen Tiere der Sekundärzeit sind jene gewaltigen Riesenechsen, die Saurier, die zusammen mit riesenhaften Froschähnlichen Amphibien die Erde belebten.
Das Gebiss dieser Reptilien erinnert mit seinen mächtigen, spitzen Eckzähnen teils an das Gebiss der heutigen Raubtiere, teils mit seinen gleichförmigen Zahnreihen an das Gebiss der Pflanzenfresser und des Menschen.
In der Jurazeit finden wir die Fischechsen Ichthyosaurus und Plesiosaurus, beides echte Wasserbewohner mit zu Flossen gewordenen vorderen und hinteren Gliedmassen, die ihr Wesen nach Art der Walfische im Weltmeer trieben. Der kurzhalsige Ichthyosaurus hatte eine lange, schnabelartige, mit zahlreichen Zähnen bewaffnete Schnauze, während der langhalsige Plesiosaurus mit seinem gestreckten, geschmeidigen Körper einen kleinen, schlangenartigen Kopf besass und in hervorragender Weise dem Leben im Wasser angepasst war. Der Plesiosaurus übertraf den Ichthyosaurus bedeutend an Grösse. Das Tier erreichte eine Länge von etwa 15 m, wovon fast die Hälfte auf den Hals kam, der je nach der Art 40 — 72 Wirbel besass. Dieser lange, offenbar sehr bewegliche Hals machte das Tier zu einem gewandten Fischfänger.
Noch gewaltiger waren die Körperdimensionen der Landsaurier jener Zeit. Der aufgefundene Oberschenkelknochen eines Atlantosaurus zeigt bei einer Dicke von 0,63 m eine Länge von nicht weniger als 2 m. Die Gesamtlänge dieses Riesen schätzt man auf etwa 30 m.
Ein gewaltiges Saurierlager entdeckte vor zwei Jahrzehnten die Berliner Tendaguru-Expedition in unserer einst so stolzen Kolonie Ostafrika. Ihre Ausgrabungsarbeiten, die wertvolles und hochinteressantes Material zutage förderten, werden heute von den Engländern mit Eifer fortgesetzt. Ganz gewaltige Knochen Jahrmillionen alter Drachentiere sind im Tendagurugebiet gefunden worden. Oberarmknochen von mehr als 2 m Länge kamen zum Vorschein. Man hat das Wesen, das diesen massigen Arm getragen hat, Brachiosaurus genannt, das vielleicht das grösste Geschöpf war, das jemals auf der Erde als Landtier gelebt hat, und das den berühmten Diplodocus Amerikas, der bei 25 m Gesamtlänge das grösste völlig erhaltene Saurierskelett ist, was bisher aufgefunden wurde, wohl noch übertroffen hat.
An dem Skelett des Diplodocus (Abbildung 1), das eine Höhe von 4 m hat, fallen besonders der ungeheuer lange Schwanz und der sehr lange Schwanenhals auf, die beide an Länge den Rumpf ganz erheblich übertreffen. Der lange Hals trägt einen sehr kleinen, flachen, breitschnauzigen Kopf, der zu der Körpergrösse des Tieres in gar keinem Verhältnis steht. Der lange Hals wurde wahrscheinlich beim Schreiten in die Höhe gestreckt, so dass das Tier im hohen Farn- und Schachtelhalmwald einen freien Überblick hatte. Die vier Beine sind ungefähr gleich gross und haben den Körper in wagerechter Haltung getragen. Der Diplodocus führte wahrscheinlich eine amphibienartige Lebensweise, d. h. er hielt sich sowohl im Wasser wie auf dem Lande auf. Dem Gebiss nach zu urteilen, das aus langen, dünnen Zähnen im vorderen Teil der Kiefer besteht, ist der Diplodocus ein Pflanzenfresser gewesen. Er hat wohl Algen und Wasserpflanzen vom Wassergrunde aufgenommen, wobei ihm der lange Hals zum Tauchen und Gründeln zustatten kam. Die gewaltigen Knochen des Tieres sind im Verhältnis zu ihrer Grösse ausserordentlich leicht, da sie nicht massiv sind, sondern grosse Hohlräume enthalten, worin man eine gute Anpassung an ein Wasserleben erblicken kann. Das trotz seiner Grösse sehr leichte Knochengerüst befähigte das Tier zum Schwimmen und Tauchen.
Das Gewicht eines lebenden Diplodocus kann auf 20000 kg geschätzt werden. Der Diplodocus war also fünfmal so schwer als ein ausgewachsener Elefant, der etwa 4000 kg wiegt.
Einen noch kleineren Kopf hatte der in Grösse und Aussehen dem Diplodocus ähnliche Brontosaurus. Sind schon die Halswirbel zum Teil grösser als der Schädel, so erreicht das Rückenmark seine grösste Ausdehnung in den Lendenwirbeln, wo sein Umfang das Hirn um das Dreifache übertrifft, so dass man geradezu von einem „Beckenhirn” reden kann.
Die geistigen Fähigkeiten dieser Tiere können nicht gross gewesen sein; sie wirkten lediglich durch die Masse ihres Körpers.
Dasselbe Missverhältnis zwischen Kopf und Rumpf zeigt auch der Stegosaurus, eins der wunderlichsten Geschöpfe, das jemals die Erde beherbergt hat. Bei diesem Tier ist der Markraum der Lendenwirbel sogar zehnmal so gross als der Hirnraum des winzigen, spitzen Kopfes. Der ganze Körper der 10 m langen Echse war mit einem Panzer aus Knochenplatten bedeckt. Auf dem Rücken und dem hinteren Schwanzende stand ein gewaltiger Kamm aus hohen, breiten und flachen knöchernen Platten. Das Schwanzende war mit langen, spitzen Stacheln bewehrt, die zweifellos eine fürchterliche Waffe bildeten. Das Tier erwehrte sich seines Gegners mit Schwanzschlägen, wobei die Stacheln wie Speere den Angreifer durchdolchten. Die Hinterfüsse waren länger als die Vorderfüsse, und man darf daher vermuten, dass das Tier sich ähnlich wie ein Frosch hüpfend fortbewegte. Man stelle sich ein solches Ungetüm, mit Panzerplatten und Speeren bewaffnet, vor, wie es langsam dahinkriecht oder hüpfend auf einen zukommt, und man wird die grotesken Tiergestalten der Sekundärzeit bei reicher Phantasie einigermassen begreifen können.
Im Gegensatz zu Diplodocus und Brontosaurus hatte Stegosaurus nur einen kurzen Hals.
Kurzhalsig war auch der dreigehörnte Ochsensaurier Triceratops. Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Formen hatte er einen sehr grossen Schädel von geradezu abenteuerlicher Form. Der hinten sehr breite Kopf verjüngt sich nach vorn auffallend und läuft in eine Schnauze aus, die einem Papageischnabel nicht unähnlich ist. Auf der Stirn stehen zwei lange, nach oben gerichtete Hörner, wie beim Ochsen, und auf der Nase ein drittes kürzeres Horn wie beim Nashorn, die Waffen von Ochse und Nashorn auf einem Tier vereint! Den Abschluss des Hinterkopfes zum kurzen Hals bildet ein breiter Hornkragen. Der grosse Kopf hat eine nur winzige Hirnhöhle. Die geistige Begabung des Triceratops war also auch nicht grösser als bei den kleinköpfigen Verwandten.
Der Körper des wunderlichen Unholds war anscheinend gepanzert.
Ausser dem Ochsensaurier sind noch andere gehörnte Reptilien aus dieser Zeit bekannt, die jedoch meist eine geringere Körpergrösse hatten.
Wieder andere Formen hatten sehr kurze Vorderfüsse, aber sehr lange Hinterfüsse, mit denen sie nach Känguruhart in aufrechter Haltung hüpften. Diese Springsaurier, Compsognathus genannt, waren nicht grösser als eine Springmaus, also Zwerge neben den Riesenformen.
Eine aufrechte Körperhaltung hatte auch das etwa 10 m lange Iguanodon, das sich mit seinen kurzen Hinterbeinen nicht springend, sondern schreitend oder trabend vorwärts bewegte und dabei auf den langen, kräftigen Schwanz stützte.
Eine andere Form der Saurier waren die Flugsaurier, die wie die Fledermäuse eine Flughaut besassen, die an den Hinterfüssen begann, sich an den Körperseiten entlangstreckte und an den Händen der vorderen Gliedmassen sich zu einer weiten Flugfläche entfaltete. Sie hatten eine spitze Schnauze, die an den Vogelschnabel erinnerte. Mit den heutigen Vögeln haben jedoch diese Flugsaurier nichts zu tun. Sie können nicht als ihre Vorfahren betrachtet werden, da ihre Flugwerkzeuge nach einem ganz anderen Prinzip gebaut waren. Die Flugsaurier waren Fallschirmflieger, die nach Art der Fledermäuse im Flatterflug sich durch die Luft bewegten (Abbildung 2).
Durch die aufgefundenen Knochenreste und teilweis völlig unversehrten Skelette sind wir über das Aussehen der Saurier der Sekundärepoche ganz vorzüglich unterrichtet. Die Drachen, von denen eine Siegfriedmär und andere Sagen alter Zeit berichten, treten in den gewaltigen Sauriern als lebende Geschöpfe vor unser Auge. Sie sind keine Erfindung dichterischer Phantasie, die Sage wird hier zur Wahrheit!
Im Jahre 1923 machte eine amerikanische Ausgrabungsexpedition in Asien am Fusse des Altai eine neue, hochwichtige Entdeckung. Sie fand die ersten versteinerten Sauriereier, die in ihrer Gestalt und mit der gekörnten Oberfläche den Eiern der heutigen Reptilien sehr ähnlich sind. Sie waren mit erhärtetem Sand gefüllt. In einem Ei liessen sich sogar Knochenreste eines Embryos nachweisen. Die Eier haben eine Länge von 20 cm. Etwa zehn Millionen Jahre sind diese Eier unberührt an dem Platz geblieben, wo sie einst von einem gewaltigen Saurier abgelegt worden sind. Sie wurden viele Hundert Meter tief verschüttet, versteinerten hier und wurden nach langer Zeit durch die Erosion, welche an dem mongolischen Felsen Jahrtausende und aber Jahrtausende nagte, wieder ans Tageslicht befördert.
Auf welche Weise konnten sich überhaupt die Knochen der Saurier Jahrmillionen erhalten? Die Tiere versanken durch das Gewicht ihres gewaltigen Körpers in den Schlamm und erlitten den Erstickungstod. Der Schlamm schloss die Luft ab und bewahrte den Riesenleib vor Verwesung. Das Fleisch vertrocknete, die Knochen blieben erhalten. Der Schlamm wurde im Laufe der Zeit durch die Umwandlung der Erde zu hartem Gestein, auch die darin geborgenen Knochen versteinerten und wurden zum Fossil. An der Stätte, wo der Forscher heute freudestrahlend den verborgenen Schatz hebt, hat sich ehemals ein grausiges Drama im Kampf ums Dasein abgespielt.
Die Riesensaurier der Sekundärzeit dürfen wir nicht als Stammformen der heutigen Säugetiere betrachten. Jene gewaltigen, ungeschlachten Geschöpfe mussten von der Bühne des Lebens abtreten, als die Erde eine andere Oberflächengestalt erhielt, in die sie nicht hineinpassten.
Als Ahnen der heutigen Säugetiere kommen kleinere Reptilienformen in Betracht, deren Knochenbau und vor allem Zahnbildung sehr an die heutigen Säugetiere erinnert. So wurde in der Triasformation Afrikas der Schädel eines Reptils gefunden, der ein vollständiges Raubtiergebiss besitzt. Man hat dies Tier, das vielleicht der Urahn der Raubtiere ist, Lycosaurus curvimola benannt. Das Gebiss eines anderen Tieres, Pareiosaurus serridens, hat grosse Ähnlichkeit mit einem Pferdegebiss. Wieder ein anderer Schädel besitzt das Gebiss des Jgels. Das Problem, ob diese vorweltlichen Tiere, die man als Gruppe der „Theromorphen” zusammengefasst hat, wirklich als die Stammväter der heutigen Säugetierwelt und damit auch des Menschen anzusetzen sind, ist freilich noch nicht gelöst. Die Ansichten der Paläontologen widersprechen sich zum Teil. Soviel ist aber sicher, dass die Theromorphen in der Phylogenie der Säuger eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. —
Die Funde aus der Sekundärzeit zeigen uns, dass es schon damals Säugetiere gegeben hat. Unter den versteinerten Knochen befinden sich Schädelfragmente, die mit Sicherheit als Säugetierreste angesprochen werden können. Überbleibsel dieser Säuger, die etwa die Grösse eines Hasen gehabt haben, sind sowohl in Südafrika wie in Europa aufgefunden worden. Die Tiere müssen also bereits eine weite Verbreitung gehabt haben. Man hat dies älteste, bis jetzt bekannte Säugetier Tritylodon longaevus benannt. Welche Rolle dieses Tier in der Phylogenie spielt, lässt sich nach den nur spärlichen Knochenresten vorläufig nicht feststellen.
Auch heute noch trägt die Erde Lebewesen von gewaltiger Grösse: den Elefanten als grösstes Tier des Festlandes und den Walfisch als grösstes Wassertier. Im Diluvium, also in der Zeitepoche, die der Jetztzeit unmittelbar vorangeht, lebten noch Elefanten, die ihre heutigen Nachkommen ganz bedeutend an Grösse übertrafen. Hierzu gehört das Mammut, der zottig behaarte Elefant der Eiszeit, der noch mit dem Menschen zusammen gelebt hat. Seine langen Stosszähne waren nicht, wie man früher annahm, nach aussen und oben gewunden, sondern, wie Pfizenmayer neuerdings nachgewiesen hat, nach innen und unten. Mit diesen nach unten gerichteten Stosszähnen hat das Mammut den Schnee fortgeschaufelt bei der Suche nach Gräsern und Halmen auf der Erde, die seine Nahrung bildeten. Im Unterschied zu den heute lebenden Elefanten besass das Mammut nur vier Zehen an den Füssen. Es bildet also eine besondere Art und kann nicht zu ihren Ahnen gehören.
Vom Mammut sind nicht allein wohlerhaltene Skelette, sondern sogar ganze Kadaver im Eise des nördlichen Sibiriens aufgefunden worden, deren Fleisch noch völlig frisch war. Die Tiere sind offenbar in der Eiszeit im Morast oder auf grossen Schneefeldern versunken, dann eingefroren und im Eise bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben.
Das ausgewachsene Mammut übertraf die heute lebenden Elefanten ganz bedeutend an Körpergrösse. Seine Länge betrug 3 m, die Höhe 2 m. Ganz unverhältnismässig gross waren die Stosszähne, die bei einer Länge von 4—5 m ein Gewicht von 250 Pfund hatten. Der Schädel eines in Sibirien aufgefundenen grossen Mammuts wog mit den Stosszähnen 200 kg.
Der deutschen Oldoway-Expedition gelang es noch kurz vor dem Weltkriege, Knochenreste ausgestorbener Altelefanten aus Deutsch-Ostafrika heimzubringen, die in den Besitz des Museums für Naturkunde in Berlin gelangten. Ein gewaltiges Beckenstück, ein 1,47 m langer Oberschenkel, ein Fuss mit einer Höhe von 1/2 m und über 3 m lange Stosszähne deuten darauf hin, dass diese Elefanten, die wohl als die Stammväter des heutigen afrikanischen Elefanten anzusetzen sind, im Vergleich zu diesem wahre Riesen gewesen sein müssen.
Unter den heute lebenden Landtieren reicht in der Körpergrösse kein einziges auch im entferntesten an die Riesen früherer Zeitepochen heran, und sogar der Elefant mit seinem gewaltigen, massigen Körper verschwindet gegen seine ausgestorbenen Vorfahren und die riesenhaften Saurier der Sekundärzeit. Dennoch birgt unsere Erde noch eine Tiergestalt, die den Kolossen vergangener Zeiten ebenbürtig zur Seite steht, ja diese vielleicht in der Körpergrösse übertrifft. Es ist dies der Riesenwal, der grösste unter den Walfischen, das grösste aller heutigen Tiere, ja vielleicht überhaupt das grösste Wesen, das die Natur seit Beginn der Erdgeschichte erschaffen hat. Mit einer Körperlänge von 30 m tritt er in die Reihe der gewaltigen Saurier der Sekundärzeit und übertrifft diese sogar noch, weil bei ihnen ein bedeutender Teil der Körperlänge auf den sehr langen Schwanz abgeht, was bei dem verhältnismässig kurzschwänzigen Walfisch nicht der Fall ist. Das Gewicht des Riesenwals beträgt 2000 — 3000 Zentner, der Umfang des Leibes etwa 12 m. Ein so gewaltiges Tier, das unbeschränkten Raumes für seine Bewegung bedarf, ist eben nur in den Fluten des Weltmeeres denkbar. —
Wenn der Besucher eines Zoologischen Gartens vor dem Wasserbecken steht, das mit grossen Alligatoren und Schildkröten besetzt ist, so begnügt er sich in der Regel damit, die trägen und nach seinen Begriffen hässlichen Geschöpfe eine Zeitlang lässig zu betrachten, um sich dann mit grösserem Interesse den Wasserbehältern zuzuwenden, in denen zierliche, buntfarbige Tropenfische in bizarrer Gestalt sich hurtig tummeln. Er ahnt aber nicht, dass Krokodil und Schildkröte schon vor Millionen Jahren auf der Erde gelebt haben, als die Weltmeere und Erdteile noch ganz andere Gestalt hatten und Gräser, Schachtelhalme und Farnkräuter in baumhohem Wuchs das Land beschatteten. Mit Ehrfurcht soll man daher diese Geschöpfe, die zu den ältesten Bewohnern unserer Erde gehören und schon in der Sekundärzeit lebten, und gegen die die Tradition des Menschengeschlechts verblasst, betrachten!
Der wichtigste paläontologische Fund stammt aus der Jurazeit, der Mittelperiode der Sekundärzeit. Im Jahre 1861 wurde auf der Langenaltheimer Haardt bei Solnhofen der versteinerte Abdruck eines Geschöpfes gefunden, das halb Vogel, halb Eidechse zu sein schien. Im Jahre 1877 folgte ein zweiter Fund, der ein besser erhaltenes Exemplar dieses interessanken Wesens zutage förderte. Nicht allein das Skelett ist fast völlig erhalten, sondern auch der Abdruck des Federkleides lässt sich gut erkennen. Dieser Urvogel, Archaeopteryx macrura benannt, vereinigtin nicht zu verkennender Weise Merkmale der Echsen und Vögel, und man kann ihn daher mit Recht als „Echsenvogel” bezeichnen.
Echsenartig ist der lange, aus zahlreichen Wirbeln bestehende Schwanz. Die vorderen Gliedmassen sind bereits zu Flugwerkzeugen nach Vogelart umgebildet, aber die Finger sind noch nicht wie bei den heutigen Vögeln verkümmert, sondern zum Teil frei und beweglich und mit langen, hervorstehenden Krallen ausgerüstet. Diese Krallen dienten als Kletterorgane, mit denen der Urvogel sich in Zweigen festhakte und kletternd fortbewegte. Die Hand ist also ein Mittelding zwischen der Eidechsenhand und Vogelhand. Echsenartig sind ferner die Rückenwirbel, welche jene eigenartige, doppelgehöhlte Sanduhrform zeigen, die für die Saurier der Sekundärzeit charakteristisch war, und die gewisse Amphibien und die Fische noch heute besitzen. Zum Unterschied von den jetzigen Vögeln besass Archäopteryx ausser den mit dem Brustbein verbundenen Rippen noch Bauchrippen, was ebenfalls an die Reptilien erinnert. Ober- und Unterkiefer sind bereits zu einem Vogelschnabel umgebildet, aber dieser Schnabel trägt wie das Maul des Krokodils oben und unten zwei Reihen Zähne. Kein heutiger Vogel besitzt Zähne, die mit Wurzeln in den Kiefern stecken. Die zahnartigen Ausschnitte am Schnabel der Entenvögel sind keine Zähne, sondern Fortsätze der Schnabelscheide, die als hornartiger Überzug die Schnabelhälften einhüllt.
Der Fuss der Archäopteryx war ein ausgesprochener Vogelfuss und besitzt bereits das typische Kennzeichen des Vogelfusses, den Lauf, jenen zwischen dem Unterschenkel und den Zehen eingeschalteten Knochen, der eine Verlängerung des Mittelfusses darstellt, und den der Laie häufig irrtümlich für den Unterschenkel hält, der bei vielen Vögeln im Gefieder verborgen und nur wenig sichtbar ist.
In höchster Vollendung zeigt sich die Vogelnatur der Archäopteryx im Federkleid, das das typische Wahrzeichen der Vögel ist und in keiner anderen Tierreihe wiederkehrt.
Der versteinerte Flügelabdruck lässt 17 Schwungfedern mit 6 oder 7 Handschwingen erkennen. Es handelt sich also um einen regelrechten Vogelflügel. Einige Lücken in der Reihe der Handschwingen legen die Vermutung nahe, dass der Urvogel bereits 10 solcher Federn getragen hat, wie es die Normalzahl der Handschwingen der heutigen Vögel ist.
Eigenartig ist die Befiederung des langen Schwanzes. Hier sitzen die Federn in zwei gegenüberstehenden Reihen an den Wirbeln. Jeder Wirbel trägt ein Federpaar. Der Schwanz hatte also das Aussehen eines Farnblattes.
Am Körper lässt die Versteinerung nur einige Federn am Halse erkennen. Man darf daher annehmen, dass Archäopteryx wie die heutigen Vögel am ganzen Leibe befiedert war.
Archäopteryx ist also ein Vogel mit teilweiser Eidechsengestalt, eine echte Übergangsform zwischen Vogel und Echse und somit das beste Beweisstück für die Richtigkeit der Entwicklungslehre. Die Abstammung der Vögel von Reptilien, die man auf Grund physiologischer Merkmale und aus der Embryologie der Vögel schon längst vermutet hatte, wird durch Archäopteryx bewiesen.
Es ist das Verdienst des genialen Ingenieurs Werner von Siemens, des um die Verwertung der Elektrizität so hochverdienten Mannes, dass die zweite wohlerhaltene Versteinerung von Archäopteryx nicht wie der erste Fund, den die britische Regierung kaufte, ins Ausland ging, sondern der deutschen Wissenschaft erhalten blieb. Werner von Siemens erwarb sofort den wertvollen Fund für die damals sehr ansehnliche Summe von 20000 Mark. Aus seiner Hand ging dann das bedeutungsvolle Fossil in den Besitz des Museums für Naturkunde in Berlin über, wo es das Glanzstück der paläontologischen Sammlung bildet. Werner von Siemens hat mit dieser hochherzigen Tat einen neuen Zweig in den Lorbeer gewunden, der seinen Namen ziert.
Archäopteryx war mit seinen Kletterflügeln noch kein so vollendeter Flieger wie die heutigen Vögel. Er war wohl nur imstande, im Flatterflug kleine Strecken zu durchmessen. Er lebte hauptsächlich im dichten Gebüsch, wo er sich flatternd und zugleich kletternd fortbewegte.
Auch unter den heutigen Vögeln gibt es noch Formen, die an Archäopteryx erinnern. Trägt doch das junge Schopfhuhn oder Hoatzin noch bewegliche und bekrallte Finger, mit denen es nach Archäopteryx-Art in Zweigen umherklettern kann. Mit dem Wachstum geht dann dies atavistische Merkmal verloren, das nach Häckels Biogenetischem Grundgesetz die Abstammung vom Archäopteryx oder von nahen Urformen bedeutet. Das alte Schopfhuhn hat normale Vogelflügel. —
Die Tertiärzeit ist die Bildnerin der heutigen Tierwelt. Unzählige Fische belebten die Gewässer; Frösche, Salamander und Kröten, von Gestalt und Aussehen ähnlich den heutigen, durchkrochen den Sumpf. Vögel mit vollendetem Flugvermögen, an Familien, Gattungen und Arten nicht minder zahlreich als heute, segelten im blauen Äther; Antilopen, Giraffen, Elefanten, Nashörner, Hirsche und Pferde durchzogen das Land, das ihnen überall geeignete Rastplätze und günstige Lebensbedingungen gab, denn der Mensch, der Störenfried der Natur, dessen Kultur der grösste Feind der Tierwelt ist, fehlte noch in dieser Zeit.
Affen schaukelten sich in den Bäumen, Fledermäuse gaukelten im Schatten der Nacht, Wale uno Haie durchzogen den Ozean, Robben sonnten sich auf den Handbänken des Meeres, und die Nagetiere trieben ihr Wesen wie heute.
Zahlreich vertreten waren die Raubtiere. Löwen, Bären, Wölfe, Tiger und Schakale durchstreiften blutdürftig das Land. Überall fanden sie bei dem grossen Tierreichtum damaliger Zeit willkommene Beute, ohne jedoch durch ihren Eingriff Schaden zu stiften und den gewaltigen Tierbestand zu dezimieren. Im Gegenteil, ihr Auftreten war nur nützlich, denn es veranlasste die Tiere zur Wachsamkeit, weckte ihre geistigen Fähigkeiten, schärfte ihre Sinne und verlieh ihnen so die wichtigste Lebensnotwendigkeit für den Sieg im Kampf ums Dasein und für die Erhaltung der Art.
Auch die Tertiärzeit hat ihre besonderen Tiere gehabt. In Ozeanien lebten gewaltige Beuteltiere von der Grösse des Nashorns. Der aufgefundene Schädel eines solchen Beutelriesen misst nicht weniger als 1 m.
Reich sind die Funde tertiärer Tiere in den Pampas Südamerikas. Hier hausten einst riesige Gürteltiere und ganz gewaltige Faultiere, die dem Elefanten an Grösse gleichkamen.
Der ältesten Tertiärschicht Nordamerikas verdanken wir einen Fund, der ein helles Licht auf die Entwicklung der Huftiere wirkt. Das Urhuftier (Phenacodus primaevus) hatte noch fünf Zehen, unter denen die dritte Zehe als längste hervortritt. Beim heutigen Pferd ist nur die dritte zum Huf gewordene Zehe erhalten geblieben, während die übrigen Zehen verkümmert sind. So darf man vielleicht Phenacodus mit seiner langen dritten Zehe als die Stammform des Pferdes ansehen, denn der Weg zur Rückbildung der Zehen mit Ausnahme der mittleren Zehe ist hier gewissermassen schon angedeutet. Die zunehmende Verkümmerung der Zehen lässt sich an anderen Fossilien gut verfolgen. Beim Hyracotherium, einem anderen tertiären Huftier, ist die Zahl der Zehen an den Vorderfüssen bereits auf vier und an den Hinterfüssen sogar schon auf drei zurückgegangen. Die dritte Zehe des Vorderfusses überragt die andern ganz erheblich an Länge, und eine Randzehe trägt unverkennbare Anzeichen der Verkümmerung. Im mittleren Eozän ist dann diese Randzehe bis auf ein kleines Rudiment völlig verschwunden, so dass das Huftier dieser Zeitperiode, Mesohippus genannt, hinten und vorn nur drei Zehen besass.
Während die Huftiere des unteren und mittleren Tertiär nur kleine Wesen waren, etwa von der mittleren Grösse eines Hundes, tritt im Pliozän, am Ende der Tertiärzeit, bereits ein Huftier von der Grösse des Esels auf, das Hipparion, das eine weite Verbreitung hatte, da zahlreiche Knochenreste in Amerika, Asien und Europa aufgefunden sind. Von den drei Zehen des Mesohippus kommt als Trittfläche nur noch die zum Huf gewordene Mittelzehe in Betracht, während die beiden anderen gehen zu Afterklauen geworden sind und den Boden nicht mehr berühren. In der weiteren Entwicklung gingen auch die Afterklauen verloren, und hiermit trat das Pferd als Einhufer auf.
Im Gegensatz zu den früheren Ahnenstufen, die in Körperbau und Gebiss noch katzenähnlich waren, ist das Hipparion schon ein richtiges Pferd gewesen.
Nicht alle Tiere der Tertiärzeit haben sich bis heute erhalten oder weiter fortentwickelt. Viele Formen haben sich überlebt und keine Nachkommen hinterlassen. Hierzu gehören mit Ausnahme des Pferdes alle Unpaarhufer. Ein solches Tier war der elefantengrosse Brontops, der im Körperbau dem Nashorn glich und zwei nebeneinanderstehende Hörner auf dem Kopfe trug. Die Füsse besassen vorn vier, hinten drei wohlentwickelte Zehen mit Hufbildung.
Die Hirsche im mittleren Tertiär unterschieden sich von den späteren Hirschen hauptsächlich durch eine reichere Verästelung des Geweihs, das mit seinen vielen Sprossen wie eine entblätterte Baumkrone aussah.
Ein riesengrosses, elefantenartiges Rüsseltier war das Dinotherium, dessen verhältnismässig kurze, hauerartige Stosszähne wie beim Walross nach unten gerichtet waren.
Unter den tertiären Affen finden sich Knochen von Halbaffen oder Makis, von grossen Pavianen und Gibbons. Auch der echte Schimpanse lebte damals schon, aber seine Reste sind wunderbarerweise nicht in seiner heutigen Heimat, in Afrika, sondern in Asien aufgefunden worden. Aus Frankreich sind tertiäre Menschenaffen bekannt, die teils dem Schimpansen, teils dem Gorilla nahestehen.
Das Vorkommen von Menschenaffen in Europa zur Tertiärzeit deutet schon darauf hin, dass damals andere klimatische Verhältnisse geherrscht haben müssen. Europa hatte zu jener Zeit ein warmes, tropenartiges Klima, und es lebte hier eine Tierwelt, die der heutigen Tropenfauna glich. Affen und Papageien schaufelten sich in Palmen, wo heute deutsche Eichen und Kiefern wachsen. Gazelle, Giraffe, Nashorn und Elefant zogen ihre Fährte im Lande des späteren Germanentums. Mit leuchtenden Farben geschmückte Vögel erstrahlten im Glanz der Tropensonne, die Europas Palmenwälder und Blütenpracht beschien.
Um die Wende dieser Zeitepoche brach eine gewaltige Katastrophe herein, die alles dies mit einem Schlage vernichtete. Es war die Eiszeit, die wie ein weisses Leichentuch die nördliche Hälfte der Erdkugel überzog, unter dem die Tropenpracht zerrann. Die Tiere, deren Lebensbedingungen an ein gleichmässig warmes Klima gebunden waren, fluteten zurück vor dieser Vereisung, um in den Äquatorialländern, die sich ihr warmes Klima bewahrten, Zuflucht zu suchen, viele gingen zugrunde, andere, deren Körperbeschaffenheit der Kälte zu trotzen vermochte, harrten aus und passten sich den neuen Verhältnissen an. Als Nachfolger der tropischen Elefanten trat in Europa das Mammut auf, das mit seinem zottig behaarten Leib eine typische Schöpfung der Eiszeit ist. Ein anderes diluviales Wesen der Eiszeit war der Riesenhirsch, in seinem Aussetzen unserem Rothirsch ähnlich, aber mit einem gewaltigen Schaufelgeweih auf dem Kopf, das eine Spannweite von 3,5 m erreichte. Es ist nicht unmöglich, dass der Riesenhirsch noch bis in die historische Zeit hinein gelebt hat. Vielleicht darf der „grimme Schelch”, den Siegfried in der Sage des Nibelungenliedes erschlug, als Riesenhirsch gedeutet werden. Dies ist jedoch nur eine kühne Phantasie, denn eine Urkunde aus alter Zeit über diesen mächtigen Geweihträger ist nicht vorhanden. In keinem Bilde wird er uns gezeigt, nirgends wird er beschrieben. In seiner Reliquienkammer befindet sich ein solches Geweih. Die Annahme, dass unter dem Schelch des Nibelungenliedes der Riesenhirsch zu verstehen ist, liegt nahe, weil mit dem Schelch ein anderes Tier gemeint sein muss als der Elch, der besonders genannt wird.
Andere diluviale Tiere waren Wisent, Bison und Auerocise, von denen nur die beiden ersteren erhalten geblieben sind.
Die Eiszeit brachte auch den Moschusochsen aus Nordamerika zu uns herüber, der dann später wieder aus Europa verschwand und nur in Grönland sich noch erhalten hat.
Das langhaarige Fell gibt dem Moschusochsen einen vortrefflichen Schutz gegen die Kälte. Der Moschusochse erinnert in seiner massigen, plumpen Figur zwar an einen Ochsen, hat aber sonst, besonders in der Kopfbildung, eine grosse Ähnlichkeit mit dem Schaf. Der sehr kurze, nur wenige Zentimeter lange Schwanz ist in dem dichten, langhaarigen Pelz verborgen.
Die Eiszeit vermochte auch die Raubtiere nicht völlig zu verdrängen. Höhlenbär, Höhlenlöwe und Höhlenhyäne trieben ihr Unwesen. Unter ihnen war der Höhlenbär am häufigsten vertreten, wie die überaus zahlreichen Knochenreste, die man in unterirdischen Höhlen des Diluvium aufgefunden hat, beweisen. Auch Tiger, Panther und Vielfrass lebten noch im Diluvium in unseren Breiten. „Aber zwischen diese reiche Musterkarte wilder Bestien”, sagt Bölsche, „schiebt sich ein mildes Bild: auch aus ihrer Reihe sonderte sich der Mensch damals einen unschätzbaren Freund, den Hund. Seine ersten Reste erscheinen in den uralten Menschensiedlungen der Schweizer Seen, den sogenannten Pfahlbauten und in gewissen Abfallhaufen, die sich ebenfalls als Spuren des vorgeschichtlichen Menschen in Dänemark noch erhalten haben. Aus der Art, wie in diesen Müllgruben aus urgrauer Zeit die weggeworfenen Tierknochen der Mahlzeiten charakteristisch benagt und dezimiert sind, hat man wohl mit Recht geschlossen, dass der Hund hier bereits ein ständiger Gesellschafter des Menschen war.” Über die Abstammung des Haushundes ist man auch heute noch nicht im klaren. Wahrscheinlich ist er aus verschiedenen Wildhundformen hervorgegangen, wofür in erster Linie Wolf und Schakal in Betracht kommen, während der Fuchs und seine Verwandten wohl auszuscheiden sind. Die ersten Haushundreste, die aus der Steinzeit bekannt sind, zeigen einen spitzartigen Typus. Dieser „Torfspitz” scheint ebenso wie die altägyptischen Hunde vom Schakal abzustammen. Die zahlreichen Hunderassen, die sich im Laufe der Jahrtausende herausgebildet haben, sind zum Teil anscheinend verschiedenen Ursprungs, zum Teil durch Vermischung der Rassen entstanden. —
Unter den Vögeln der Eiszeit ist an erster Stelle der Riesenalk zu nennen, ein etwa metergrosser Tauchvogel mit verkümmerten, zum Fliegen unfähigen Flügeln. Er hat sich bis in die Neuzeit hinübergerettet, und erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts sind die letzten Reste dieses interessanten Naturdenkmals durch den Menschen ausgerottet worden. Ausgestopfte Exemplare und Eier des Riesenalks stehen noch in den Museen als Zeugen verklungener Zeiten.
Eine andere erst in historischer Zeit ausgestorbene, uralte Vogelart ist die Dronte, eine flugunfähige Taube der Insel Mauritius. Dieser gänsegrosse, eigentümliche Vogel hatte einen dicken, plumpen Körper nach Art des gemästeten Federviehs heutiger Zeit, sehr kurze, stummelartige Flügel und einen aus gekräuselten Federn bestehenden, hochgerichteten Schwanz. Das Gefieder war hellgrau, Schwanz- und Flügelfedern gelb, der Schnabel gelb mit roter Spitze. Leider ist dieser am Ende des 17. Jahrhunderts ausgerottete Vogel der Nachwelt nicht erhalten geblieben, denn das letzte ausgestopfte Stück vernichtete der Unverstand des Konservators des Museums in Oxford im Jahre 1755, weil der Balg von Motten angefressen war. Sic transit gloria mundi!
Die Eiszeit hat uns hinübergeführt zu dem jüngsten Abschnitt der Erdgeschichte, zur Quartärzeit, die ihre besondere Bedeutung dadurch erhält, dass jetzt auch der Mensch in die Reihe der Lebewesen tritt. Die Spuren des Menschen lassen sich mit Sicherheit nur bis in das Diluvium verfolgen. Der Streit über den tertiären Menschen ist noch keineswegs geschlichtet. Noch immer fehlen sichere Anhaltspunkte für das Vorhandensein des Menschen in der Tertiärzeit.
Während zahlreiche, versteinerte Knochenreste uns über die Entwicklung vieler Tiere Aufschluss geben, fehlen solche Wahrzeichen früherer Ahnenstufen beim Menschen. „Wahrlich, wenn ein verbriefter Stammbaum”, sagte Branco in seinem Vortrag über den fossilen Menschen auf dem V. Internationalen Zoologen-Kongress 1901 zu Berlin, „eine lange Ahnenreihe, wie viele meinen, die Berechtigung gewährte, auf andere herabzublicken, die solchen Stammbaum nicht besitzen — die Schweine und Rhinozeronten, das Rindvieh und manch andere Wiederkäuer, Kamele, Pferde, Elefanten, die könnten volk Stolz und volk Hochmut auf den Menschen niederblicken, der als ahnenloser Parvenü plötzlich in ihrer Mitte dasteht.” —
Der Neandertalmensch kann nach heutiger Anschauung der Anthropologen nicht als Vorläufer der heutigen Menschen betrachtet werden. Zwar zeigt der lange Schädel mit seinen vorspringenden Augenbrauenbögen und der nach rückwärts fliehenden Stirn eine grössere Ähnlichkeit mit dem Schädel der Menschenaffen, als es bei den heutigen Menschenschädeln, den Kurzköpfen, der Fall ist, aber er kann trotzdem nicht als frühere Ahnenstufe gelten, da er nicht ausschliesslich diluvialer Herkunft ist, sondern gleiche Schädel zusammen mit normalen Kurzschädeln auch im Alluvium gefunden sind. Die Neandertalmenschen haben also mit den Kurzschädeln zusammengelebt. Es handelt sich daher nicht um eine Vorstufe in der Ahnenreihe des Menschen, sondern nur um eine Rasse. Man darf wohl annehmen, dass die Flachköpfe geistig weniger begabt waren als die Rundköpfe mit ihrem grösseren Hirnraum und daher im Kampf ums Dasein unterlegen sind.
In grosser Zahl sind Flachkopfschädel, die völlig den Typ des Neandertalmenschen tragen, in Krapina in Kroatien ausgegraben worden. Sie stammen alle aus dem Alluvium, aus der jüngsten Zeit der Erdgeschichte. Eier scheint sich also die Flachkopfrasse neben der kurzköpfigen Form am längsten erhalten zu haben.
Nicht viel besser als mit dem Neandertalmenschen steht es mit dem berühmten, heiss umstrittenen Pithecanthropus, jenem Schädelfragment, das der Holländer Dubois 1891 auf Java fand, und das das grösste Aufsehen erregte. Das sehnsüchtig gesuchte Mittelding zwischen Mensch und Affe sollte endlich entdeckt sein! Pithecanthropus ist wie der Neandertalschädel ein Flachkopf, aber die Affenmerkmale sind noch ausgeprägter. Er ist flacher, und die Augenbrauenbögen treten noch stärker hervor. Die Höhe des Schädeldachs über der Längsachse beträgt 61 mm gegen 85 mm beim Neandertalschädel und 100 — 110 mm beim heutigen Menschen. Die Höhe des Schimpansenschädels beträgt 45 bis 50 mm. Pithecanthropus steht also in dieser Beziehung in der Mitte zwischen dem modernen Menschen und den Menschenaffen. Die Gelehrten stritten sich, ob man es mit einem Menschenaffen, einem Menschen oder gar mit einem Übergang zwischen beiden zu tun habe, und noch heute ist dieser Streit nicht endgültig ausgefochten, und er wird kaum jemals ausgetragen werden können, wenn nicht weitere Funde folgen, denn das Schädelfragment genügt nicht, um ein endgültiges Urteil zu fällen.
Ausser dem Schädelbruchstück wurde in 15 m Entfernung noch ein Oberschenkelknochen zutage gefördert, der jedoch so menschenähnlich ist, dass er zu dem affenartigen Schädel wenig passt, sondern vielleicht von einem richtigen Menschen stammt. Beide Knochenreste lassen sich daher kaum miteinander in Beziehung bringen, denn sie scheinen nicht demselben Wesen anzugehören, sondern zwei ganz verschiedenen Geschöpfen. Infolgedessen hat auch der Entdecker dieses rätselhaften Fundes Dubois in seiner neuesten Abhandlung über Pithecanthropus in den Veröffentlichungen der Kgl. Akademie der Wissenschaften in Amsterdam, den Schenkelknochen bei seinen Ausführungen ganz ausgeschaltet. Dubois sucht in dieser Schrift nachzuweisen, dass Pithecanthropus bereits ein Mensch gewesen sei, jedoch mit sehr flacher Schädelbildung. Hiermit würde Pithecanthropus seine ihm von vielen Seiten bisher zuerkannte Bedeutung als Übergangsform zwischen Mensch und Affe verlieren. Das letzte Wort über diesen interessanken Fund ist jedoch auch hiermit noch nicht gesprochen. —
In jüngster Zeit wurden in Südafrika zwei neue Funde gemacht, die für die Frage nach der Stammesgeschichte der Menschheit von grösstem Interesse sind.
Im Jahre 1921 wurde in Broken Hill in Nord-Rhodesia ein Menschenschädel ausgegraben, der durch stark hervortretende Augenbrauenbögen, flache Stirn und weit vorgeschobene Riefer noch affenähnlicher erscheint als der Neandertalmensch, und nach dem Urteil des französischen Anthropologen Marcellin Boule sogar eine gewisse Übereinstimmung mit dem Gorillaschädel zeigt. Hiernach scheint also der Rhodesiaschädel eine ältere Stufe in der Entwicklung der Menschheit darzustellen als der Neandertaler. Im Widerspruch zu dieser Erscheinung steht jedoch ein anderes sehr merkwürdiges Merkmal. Während am Neandertalschädel das Hinterhauptloch, durch das das Rückenmark in den Schädel tritt, so liegt, dass der Kopf nicht aufrecht, sondern etwas nach vorn geneigt getragen wurde, weist die Stellung des Hinterhauptlochs am Rhodesiaschädel bereits auf eine völlig aufrechte Kopfhaltung hin, wie sie der rezente Mensch hat. Im Gegensatz zu dem stark ausgeprägten Affentyp spricht dies Merkmal für eine höhere Entwicklungsstufe als der Neandertalmensch.
Die jüngste Untersuchung des interessanken Fundes durch den deutschen Anatom Maurer ergab nun eine überraschende Aufklärung über sein Alter. Maurer erkannte nämlich eine Verletzung, die durch den Schuss eines modernen Geschosses hervorgerufen zu sein scheint. Es lässt sich deutlich ein Ein- und ein Ausschuss im Schädel feststellen. Trifft dies Merkmal zu, das von englischen Gelehrten wunderbarerweise bisher nicht beachtet worden ist, dann kann es sich nicht um einen Fund aus prähistorischer Zeit handeln, sondern der Mensch, der den Schädel getragen hat, muss in unserer Zeit gelebt haben. Nicht mit Unrecht hat man daher darauf hingewiesen, dass vielleicht in einer unbekannten Gegend im Innersten Afrikas noch heute Menschen leben, die der Neandertalrasse nahestehen. Eine solche Vermutung ist durchaus nicht unglaubwürdig, wenn man bedenkt, dass erst vor einem Vierteljahrhundert ein neues Säugetier, das Okapi, dessen Vorfahren bereits aus dem Miozän Europas bekannt waren, entdeckt wurde. Das Okapi ist ein etwa 1,5 m hoher, den Giraffen nahverwandter Paarhufer. Ebenso wie die Giraffe trägt das Okapi zwei Kornzapfen auf der Stirn. Von dem rotbraun gefärbten Fell des Körpers heben sich die zebraartig schwarz und weiss gestreiften Läufe und Hinterschenkel eigenartig ab. Das Okapi wurde 1901 im Kongostaate entdeckt.
Dem Rhodesiaschädel folgte im Jahre 1924 ein zweiter, vielleicht noch bedeutungsvollerer Fund. Im Dezember des genannten Jahres wurde in Taungs in Betschuanaland in Südafrika ein Menschenaffenschädel ausgegraben, der mit ziemlicher Gewissheit als tertiär angesprochen werden kann. Es ist der Schädel eines dem Schimpansen nahestehenden grossen Affen, dessen Lebensalter nach dem Gebiss auf 3 — 4 Jahre einzuschätzen ist. Es handelt sich also um den Schädel eines noch im Kindesalter stehenden Menschenaffen. Für die Jugend des Schädels spricht auch sein sehr menschenähnlicher Bau, denn bei allen Affen ist in der Kindheit der Gesichtsteil viel menschenähnlicher als im Alter, wo das Tierische mehr zum Ausdruck kommt. Der Kopf des jungen Affen mit der gewölbten Stirn ist runder und besser proportioniert. Die Augenbrauenbögen treten noch nicht wulstartig hervor, und die Prognathie der Riefer, die gerade den tierischen Ausdruck erhöht, ist noch weniger ausgeprägt. Erst mit dem zunehmenden Alter schieben sich die Kiefer vor, erscheinen die Wülste über den Augen und flacht sich die Stirn ab, wodurch sich der menschenähnliche Ausdruck des Gesichts mehr verliert und das Tierische stärker betont wird. Der sehr menschenähnliche Typ des Taungsaffen, den der britische Anatom Raymond Dart in Johannesburg „Australopithecus africanus” benannt hat, darf also nicht stammesgeschichtlich bewertet werden. Es ist nur eine natürliche Folgeerscheinung des sehr jugendlichen Alters des Affen, aber nicht ein Hinweis auf eine höhere Entwicklungsstufe in der Richtung zum Menschen.
Australopithecus zeigt aber ein anderes, sehr auffälliges Merkmal, das ihn zweifellos über die heutigen Menschenaffen erhebt und ihn dem Menschen näherstellt. Der Gehirnraum des Schädels ist nämlich auffallend gross und entspricht etwa dem Hirnraum eines erwachsenen Gorillas. Dart hat nun für den erwachsenen Australopithecus eine Schädelkapazität von 650 — 700 ccm berechnet. Australopithecus hat also ein grösseres und besser entwickeltes Gehirn besessen als die heutigen Menschenaffen, deren Schädelkapazität im Höchstmass 500 ccm beträgt.
Für den wahrscheinlich diluvialen Pithecanthropus wird eine Schädelkapazität von ca. 900 ccm angegeben. Australopithecus reiht sich also in bezug auf die Hirngrösse zwischen Pithecanthropus und die rezenten Menschenaffen ein.
Wie wir sahen, ist Pithecanthropus, bevor keine weiteren, besser erhaltenen Schädel aufgefunden werden, für die Stammegeschichte des Menschen kaum zu verwerten, da noch nicht einmal aufgeklärt ist, ob es sich um einen Affen oder einen Menschen handelt. Dagegen ist Australopithecus zweifellos ein Affe gewesen, und zwar ein Menschenaffe, mit auffallend hoch entwickeltem Gehirn. Ebenso wie einst Pithecanthropus als Bindeglied zwischen Mensch und Affe betrachtet wurde, trägt auch Dart kein Beckenken, seinen Australopithecus als Übergangsform zwischen Mensch und Tier anzusetzen, ob mit Recht oder Unrecht, das wird erst die weitere Forschung zeigen.
Spärlich sind bis heute die Funde, die für die Stammesgeschichte der Menschheit Bedeutung haben. Aber die spärlichen Funde haben doch einen grossen, nicht zu unterschätzenden Wert. Sie zeigen uns, dass der Mensch nicht immer so beschaffen war, wie er heute ist, sondern dass auch er sowohl körperlich wie geistig manche Umwandlung erfahren hat. Der Neandertalmensch mit seinem flacheren, mehr tierischen Schädel stand zweifellos auf einer geringeren Stufe der Intelligenz als der heutige Mensch. Dasselbe gilt wohl in noch höherem Masse vom Rhodesiamenschen, von dem vielleicht letzte Überreste noch heute ihr Dasein fristen in unbekannter Gegend Afrikas. In Gegensatz zu diesen primitiven Armenschen tritt der Überschimpanse Australopithecus mit seinem für einen Affen auffallend hoch entwickelten Gehirn. Die Kreise berühren sich. Hier der Mensch auf niedriger Entwicklungsstufe, dort der Affe in hoher geistiger Vollkommenheit! Überall leuchtet das eine Wort „Entwicklung” hervor!
Welche Überraschungen haben uns die paläontologischen Funde bereits gebracht, und wieviel Neues dürfen wir bei der rastlosen Forschung der Wissenschaft noch erhoffen. Jeder Tag kann einen neuen Fund bringen, der unerwartetes Licht in den Schatten der Stammesgeschichte der Menschheit wirft, die zweifellos die interessanteste Frage der Wissenschaft bildet.