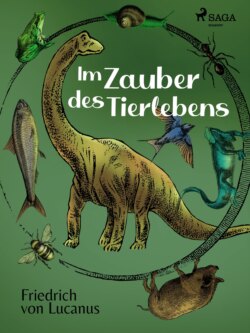Читать книгу Im Zauber des Tierlebens - Friedrich von Lucanus - Страница 5
Fortpflanzung und Liebesleben
ОглавлениеGeburt, Aufstieg, Niedergang, Tod. Dies sind die Gesetze, die des Lebens Kreislauf mit eiserner Strenge umschliessen, und doch gibt es Lebewesen, die das Angesicht des Todes nicht zu schauen brauchen, denen die Natur ein ewiges Dasein geschenkt hat. Es sind jene kleinsten Organismen, die wir als Infusorien im Wassertropfen unter dem Mikroskop bewundern.
Die Infusorien gehören zu den einzelligen Tieren, Protozoen, die im Wasser, auf dem Lande oder parasitär im Körper anderer Tiere wohnen. Der Körper aller Lebewesen ist aus unzähligen kleinsten Bausteinen, Zellen genannt, zusammengesetzt, die die Grundform, den Urstoff alles Lebens bilden. Jede Zelle besteht aus einer flüssigen Masse, dem Protoplasma mit einem inneren Kern. Solche Zelle, als Einzelwesen gedacht, ist das Urtier oder der Einzeller.
Die einfachste Art der Fortpflanzung geht durch eine Teilung des Urtiers in zwei neue Lebewesen vor sich. Der Körper spaltet sich entweder in der Länge oder in seiner Breite in zwei gleiche Teile, die jeder ein neues Tier darstellen. Das Muttertier stirbt nicht, sondern lebt in veränderter Form weiter.
Häufig erfolgt anstatt der Zweiteilung auch eine Vielteilung. Der Zellkörper löst sich in zahlreiche Sporen oder Gameten auf, welche sich paarweise verschmelzen und zu einem neuen Einzeller werden. Die einzelnen Gameten sind entweder gleichwertig oder aber verschieden in der Grösse. Im letzteren Falle vereinigt sich stets eine grössere Gamete mit einer kleineren, so dass man die beiden Gametenformen mit der Ei- und Samenzelle höherer Tiere vergleichen kann und ihre Verschmelzung, wissenschaftlich „Kopulation” genannt, als der Beginn einer geschlechtlichen Fortpflanzung angesehen werden darf.
Bei einigen Infusorien kommt neben der Teilung und der Kopulation sogar eine regelrechte Paarung zweier Elterntiere vor. Zwei Infusorien schwimmen umeinander herum, suchen sich zu berühren, bis eine vorübergehende Vereinigung erfolgt, bei der die Kerne ihres Innenkörpers sich teilen und Kernstücke gegenseitig ausgetauscht werden, die dann wieder in jedem Tier zu einem einheitlichen Kern verschmelzen. Auf diese Weise wird der Zelle neue Kernsubstanz zugeführt, wodurch die Lebensenergie erhöht wird. Diese Paarung, die man „Konjugation” nennt, scheint für viele Einzeller eine Lebensnotwendigkeit zu sein. Versuche ergaben, dass eine dauernde Fortpflanzung durch Teilung ohne zeitweise Konjugation zur Entartung führt. Die neuen Generationen werden immer kleiner, verlieren die Beweglichkeit und damit auch die Fähigkeit, sich zu ernähren, und gehen schliesslich zugrunde. Die fehlende Konjugation wirkt also ähnlich wie eine übertriebene Inzucht bei höheren Tieren.
Wieder andere Urtiere pflanzen sich durch Knospung fort, indem sich vom Muttertier kleine Einzelzellen abschnüren.
Die Zählebigkeit der Urtiere ist ausserordentlich gross. Die Infusorien umgeben sich, wenn das Wasser austrocknet, mit einer Hülle (Zyste) und trotzen in diesem Zustande allen Witterungseinflüssen. Sie irren im Staube vom Winde getragen umher, bis sie schliesslich wieder ins Wasser gelangen, um zu neuem Leben zu erwachen. Hierauf beruht die Erscheinung, dass reines, destilliertes Wasser, wenn es unbedeckt hingestellt wird, in kurzer Zeit mit Infusorien erfüllt ist. Eine Urzeugung, wie man früher glaubte, findet im Wasser nicht statt, sondern die kleinen Lebewesen gelangen durch die Luft im enzystierten Zustande hinein.
Die Gestalt der Urtiere ist sehr verschieden, sackförmig, becherförmig, rund oder länglich, und wechselt bei der flüssigen Körpermasse ausserordentlich leicht. Ferner finden sich formunbeständige Fäden und Anhängsel am Körper, die der Fortbewegung und der Nahrungsaufnahme dienen. Andere haben zahllose kleine Wimpern, mit denen sie im Wasser rudern. Alle diese Anhängsel, die keine eigentlichen Organe sind, sondern Ausstülpungen des Protoplasmas, nennt man „Organellen”. Sogar Sinnesorganellen treten in Form keiner Borsten auf, die ein Tastvermögen ermöglichen. Bei den Strahlentierchen (Radiolaria) finden wir bereits die ersten Anfänge einer Skelettbildung in Form von kleinen, feinen Stäbchen aus Kiesel, Kieselsäure oder Quarz, also aus mineralischer Substanz. Sie liegen entweder lose in dem Protoplasmakörper eingebettet oder bilden ein Gitterwerk von allen möglichen zierlichen und absonderlichen Gestalten, wie Blüten, Reusen, Flaschen, Körbchen, Schalen, Spangen, Kreuze oder mehrarmige Leuchter. Schier unerschöpflich ist die Fülle der eigenartigen Formen, die bisweilen von bezaubernder Schönheit sind, so dass die Begeisterung, mit der ein Haeckel von diesen „Kunstformen der Natur” spricht, vollauf zu verstehen ist.
Die Urtiere zeigen Reaktionen auf gewisse Reize. Sie schwimmen dem Lichtschein nach, verändern ihre Gestalt bei starker, plötzlicher Belichtung oder bei Erschütterung und werden durch chemische Einflüsse angezogen oder abgestossen. Man hat geglaubt, hieraus auf ein Seelenleben der Urtiere schliessen zu dürfen. Andere Forscher widerlegen nicht mit Unrecht diese Annahme mit dem Hinweise, dass z. B ein Quecksilbertropfen durch chemische Einwirtung zu einer höchst auffallenden Beweglichkeit und Veränderung seiner Gestalt veranlasst werden kann. Sie sehen daher in den Bewegungen der Urtiere weiter nichts als mechanische, unbewusste Reaktionen auf äussere Reize, die mit bewusster Empfindung und Seelenleben nichts zu tun haben, ebensowenig wie wir auch bei der Pflanze von einem wirklichen Seelenleben sprechen können.
Welche von beiden Anschauungen die richtige ist, lässt sich freilich schwer entscheiden, doch kann man immerhin vermuten, dass das Urtier mit seinem einzelligen Körper, der die elementarste Stufe des Lebens darstellt, wohl kaum ein seelisches Empfinden besitzt, das ein zielbewusstes Handeln zur Folge hat.
Alle vielzelligen Lebewesen, die Tiere sowohl wie der Mensch, beginnen ihr Dasein als Einzeller. Die Eizelle des weiblichen und die Samenzelle des männlichen Geschlechts sind solche Einzeller.
Der Anfang der Reimesgeschichte führt also stets auf das einzellige Urwesen zurück. Der Aufbau des aus der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entstehenden Körpers lässt sich ebenfalls mit der Entwicklungsgeschichte der Urtiere vergleichen, denn der Prozess ist ein gleicher. Das Urtier pflanzt sich fort durch Teilung in mehrere Einzelwesen. Ebenso spaltet sich auch die befruchtete Eizelle in verschiedene Produkte, aus denen sich im Laufe der weiteren Entwicklung die Teile des Körpers und seiner Organe bilden. Während bei dem Urtier aus der Teilung selbständige Einzelwesen hervorgehen, die ein individuelles Leben führen, bleiben bei der Teilung der Eizelle die Abschnitte im Zusammenhang, um in engster Gemeinschaft einen Einheitsstaat zu gründen, der in seiner Zusammengehörigkeit einen einheitlichen Körper darstellt. Die einzelnen Zellen des ersten Teilungs- oder Furchungsprozesses hat der um den Ausbau der Entwicklungslehre so verdiente Forscher Ernst Haeckel „Blastula” genannt. Mit der Blastulabildung beginnt die Embryonalentwicklung aller höheren Lebewesen. Ernst Haeckel sieht in diesen Vorgängen der Ontogenie der Vielzeller einen Beweis für ihre Abstammung von einzelligen Urtieren und begründete hierauf sein „Biogenetisches Grundgesetz”, das besagt, dass die Ontogenie (Reimesgeschichte) eine Wiederholung der Phylogenie (Stammesgeschichte) ist.
Die Richtigkeit dieser vielfach befehdeten Lehre tritt in der weiteren Reimesentwicklung deutlich zutage. Auf das Stadium der Blastula folgt die „Gastrulation”. Gastrulation heisst „Magenbildung”, abgeleitet von dem griechischen Wort „gaster” Magen. Die Larvenform der Blastula bildet im weiteren Zellenaufbau eine äussere und eine innere Schicht. Aus ersterer, dem Ektoderm, geht in der weiteren Entwicklung die Haut und das Nervensystem hervor. Letztere, das Entoderm, ist die erste Anlage für die Ernährungswerkzeuge. Der Embryo ist jetzt sozusagen ein Magentier, das nur aus einem hohlen Magen und einer äusseren Wand besteht, und gleicht hierin den Schwämmen, die sich den Urtieren unmittelbar anreihen, und zwar der einfachsten Form, den Kalkschwämmen. Der Kaltschwamm ist ein unten festgewachsener Becher, der an seinem oberen Ende eine Öffnung hat. Der ganze Innenraum wird von der Magenhöhle gebildet. Die äussere Hülle ist mit unzähligen seinen Poren durchsetzt. Durch dieses Netz dringt fortwährend ein Wasserstrom in das Innere des Körpers, der aus der oberen Öffnung, Osculum genannt, wieder abfliesst. Mit dem Wasser gelangen kleinste Teile pflanzlichen und tierischen Ursprungs in die Magenhöhlung und werden so weit als möglich von den Körperzellen aufgesogen und verwertet. Der Rest wird mit dem Wasser wieder nach aussen befördert. So ein Kalkschwamm ist also weiter nichts als ein einzelner, lebender Magen, und ebenso sieht auch der auf der Gastrulationsstufe stehende Embryo des vielzelligen Wesens aus. Also auch hier wieder eine Wiederholung einer niederen Stufe im Tierreich, die nach dem biogenetischen Grundgesetz als Ahnenstufe anzusetzen ist.
Auch in der späteren Entwicklung behält das Gesetz seine Gültigkeit. Es bilden sich bei allen Embryonen an den Halsseiten vorübergehend Kiemenbögen, und die äusseren Gliedmassen erscheinen zuerst als flossenartige Plättchen, beides ein Hinweis auf eine ehemalige Fischnatur vor Millionen von Jahren. Der Vogelembryo trägt anfangs einen wohlentwickelten Schwanz, der dann durch Verwachsung der Knochen wieder zurückgebildet wird. Die Abstammung der Vögel vom langschwänzigen Reptil tritt hier deutlich hervor. Auch der Embryo des Menschen trägt vorübergehend einen Schwanzansatz und einen Haarpelz, was nach Haeckel auf seine tierische Abstammung und seine Verwandtschaft mit dem Affen hindeutet. —
Bei den Schwämmen kommt neben einer Fortpflanzung durch Knospung bereits eine geschlechtliche Fortpflanzung durch Eier und Samen vor. Wie bei den Blüten der Pflanzen sind häufig männliche und weibliche Reimzellen in demselben Organismus vereint, bei anderen Schwämmen sind die Geschlechter individuell getrennt. Die Eier entwickeln sich im Muttertier zu Larven, die nach ihrer Geburt mit Hilfe besonderer Bewegungsorgane, der Geisseln, im Wasser umherschwimmen, um sich bald festzusetzen und zum fertigen Schwamm auszubilden.
Die Schwämme besitzen ein Skelett, das bei den Kaltschwämmen aus Kieselsäure besteht und bei den schon früher erwähnten Glasschwämmen aus einem wunderbaren, Formenreichen Kieselnetzwerk, das feinen Glasfäden gleicht.
Unser allbekannter Badeschwamm, der in seinem Toilettenzimmer fehlt, ist das Hornskelett der „Hornschwämme”, das nicht wie beiden Kieselschwämmen aus Mineralsubstanz, sondern aus Sponginfasern aufgebaut ist. Im lebenden Zustande ist ein Schwamm ein gelblicher, brauner oder schwarzer fleischiger Klumpen. Zum Gebrauch wird von dem Hornskelett das weiche Körpergewebe durch Pressen entfernt. Der Werk eines Schwammes hängt von der Art der Skelettbildung ab. Je feinmaschiger es gebaut ist, je fester und zugleich elastischer die Fasern sind, um so grösser ist die Saugfähigkeit und die Haltbarkeit, und um so höher der Wert.
Ebenso wie die Schwämme stehen auch die Hohltiere, zu denen die Quallen, Blumentiere und Polypen gehören, noch auf dem Standpunkt der Gasträa. Sie sind Magentiere, die aus einem magenartigen Hohlraum mit einer Öffnung und einer Aussenwand bestehen. Ihre Fortpflanzung geht teils wie bei den Urtieren durch Knospung oder Teilung vor sich, teils geschlechtlich durch Bildung von Ei- und Samenzelle. Neben einer Trennung der Geschlechter kommt auch Zwitterbildung vor. Im ersteren Falle erfolgt die Befruchtung durch Übertragung des Samens durch das Wasser.
Die Hohltiere sind zum Teil mit langen Nesselorganen ausgerüstet. Viele sind von bezaubernder Gestalt und herrlicher Farbenpracht. Die zarten Quallen und die vielfarbigen Seerosen müssen immer wieder von neuem unsere Bewunderung erregen.
Zwischen den festsitzenden Polypen und den frei schwimmenden Quallen oder Medusen besteht ein eigenartiger Zusammenhang, der zur Fortpflanzung in innigster Beziehung steht. Beides sind dieselben Tiere, nur in veränderter Form. Die Quallen entstehen aus Polypen. Durch Einschnürung wird der Körper des Polypen in mehrere scheibenförmige Abschnitte zerlegt, die sich allmählich loslösen und dann als Quallen frei umherschwimmen. Die Medusen sind bei diesen Polypenquallen die eigentlichen Geschlechtstiere, welche Eier ablegen, aus denen Larven hervorgehen, die sich festsetzen, um zum Polyp auszuwachsen. Quallen und Polypen stellen also zwei verschiedene Generationen dar. Der Polyp, der sich durch Knospung fortpflanzt, ist die ungeschlechtliche Generation, die Qualle die geschlechtliche. Dieser Generationswechsel findet aber nicht immer statt. Es gibt auch Quallen, die nicht aus Polypen entstehen, sondern sich unmittelbar aus Eiern fortpflanzen, ebenso bilden nicht alle Polypen Medusen. Auch kann die Qualle am Polyp haftenbleiben und hier Eier ausscheiden, aus denen sich neue Polypen entwickeln. Die Art und Weise der Fortpflanzung ist ausserordentlich, mannigfaltig. Bei vielen Medusen kennt man noch nicht die zugehörige Polypenform, und ebenso ist auch die Quallenform vieler Polypen noch unbekannt.
Die Stachelhäuter oder Strahlentiere (Echinodermata) sind radiare Tiere, d. h. ihr Körper lässt sich durch eine Anzahl strahlenförmiger Schnitte in gleiche Teile zerlegen. Dem Bau des Körpers liegt in der Regel die Fünfzahl zugrunde. Um einen zentralen Hauptteil gruppieren sich fünf gleiche Körperteile, die bei den Seesternen die Figur eines Sternes bilden, bei den Seelllien wie die Blütenblätter einer Blume aus einem Stiel hervorspriessen. Bei den Sterntieren ist die geschlechtliche Fortpflanzung die Regel. Sie legen Eier, aus denen Larven schlüpfen, die eine vielseitige Umwandlung durchmachen, ehe sie die Gestalt des erwachsenen Tieres annehmen. Bei manchen Arten findet eine Brutpflege statt, indem die Eier und Jungen in besonderen Bruttaschen sich entwickeln. Die Sterntiere, und zwar besonders die Seesterne, haben die Fähigkeit, verstümmelte oder verlorene Organe in kurzer Frist zu ersetzen. Abgeschnittene Arme wachsen sofort wieder neu. Ja sogar ein abgetrennter Arm wächst sich zu einem ganzen Tier aus, indem eine Mittelscheibe mit vier neuen Armen hervorspriesst. So kann also auch eine Vermehrung durch gewaltsame Teilung erfolgen. Bei einigen Seesternen findet diese Fortpflanzung durch Teilung regelmässig neben der geschlechtlichen Fortpflanzung statt. Ihr Körper schnürt sich in zwei Hälften durch, deren jede durch Regeneration die fehlenden Teile ersetzt und so ein neues Individuum bildet. —
Der grosse Kreis der Würmer, die sich im allgemeinen durch einen schlauchförmigen oder bandartigen Körper kennzeichnen, zeigt entsprechend der mannigfachen Organisation des Körpers auch eine grosse Verschiedenheit in bezug auf die Fortpflanzung. Ungeschlechtliche Fortpflanzung durch Teilung oder Knospung wechselt mit geschlechtlicher. Viele Würmer machen eine verwikkelte Metamorphose durch, mit der oft ein Parasitismus verbunden ist. Andere Würmer führen im Larvenstadium eine freie, im Alter dagegen eine parasitäre Lebensweise, wieder andere bleiben während ihres ganzen Daseins Parasiten. Die fortpflanzungsreife Trichine wohnt niemals im Muskelfleisch, sondern stets nur im Darm. Die legereifen Weibchen bohren sich in den Darm ein und setzen hier ihre Brut ab. Die jungen Trichinen werden durch den Blutkreislauf fortgeführt und gelangen so in andere Körperteile. Sie durchbrechen die Wände der Blutgefässe, um sich schliesslich im Muskelfleisch zu verkapseln. In diesem Zustande bleibt die Trichine Jahrzehnte lebensfähig. Es bildet sich mit der Zeit eine Kalkschale um den eingekapselten Körper. Gelangen die eingekapselten Trichinen durch Genuss des Fleisches in den Darm anderer Tiere oder des Menschen, so löst sich die Kalkschale auf, die Trichine wird frei und bildet sich zum Fortpflanzungsfähigen Tier aus.
Noch komplizierter ist die Entwicklung der Bandwürmer, die ein Zwischenstadium als Finne haben und als solche in der Regel nur in ganz bestimmten Wirtstieren leben.
Der gewöhnliche Bandwurm besteht aus einem Kopfteil, der durch einen kurzen Halsansatz mit dem aus einzelnen Gliedern sich zusammensetzenden Körper verbunden ist. Weder besitzt der Kopf eine Mundöffnung, noch der Leib einen Magen und Darm. Die Ernährung erfolgt durch zahlreiche, kleine Poren, die auf der ganzen Oberfläche des Leibes verteilt sind, und die aus dem im Darm liegenden Speisebrei die geeigneten Stoffe aufsaugen. Der Kopf ist ein knopfartiges Gebilde und mit Saugnäpfchen oder Widerhaken versehen, die sich im Darm anheften. Jedes Glied besitzt seine eigenen Fortpflanzungsorgane in Gestalt von männlichen und weiblichen Geschlechtsteilen. Jedes Glied des Bandwurms ist also ein Geschlechtstier für sich, in dem sich durch Zwitterbildung das Geschlechtsleben abspielt. Man kann daher den Bandwurm als eine Tierkolonie auffassen.
Die Glieder mit legereifen Eiern stossen sich ab und gelangen mit dem Kot des Wirtstieres ins Freie. Die Eier enthalten einen kugelförmigen Embryo, der mit sechs Haken versehen ist, und haben eine feste, zähe Umhüllung, die allen Witterungseinflüssen trotzt. Sie befinden sich vorzugsweise in Dunghaufen, werden aber auch vom Winde überallhin verschleppt. Gelangen sie später in den Magen eines Tieres, z. B einer Maus, einer Ratte oder eines Kaninchens, so schlüpft der Embryo aus, bohrt sich vermittels seiner Haken durch die Magenwand und wandert in ein Organ oder auch in das Muskelfleisch. Hier legt sich der Embryo fest und wird zur Finne, die eine mit wässriger Flüssigkeit angefüllte Blase darstellt, in derem Innern die Anlage des späteren Bandwurmkopfes eingebettet ist. Die Finne, auch Blasenwurm genannt, bleibt in diesem verkapselten Zustande lange Zeit, unter Umständen bis zu 20 Jahren lebensfähig. Wird mit Finnen behaftetes Fleisch von einem Tier oder vom Menschen in rohem Zustande genossen, so verwandelt sich die Finne im Darm zum Bandwurmtopf, an den dann allmählich die Glieder heranwachsen. Die abgestossenen, legereifen Glieder werden vom Kopf aus durch neue Glieder ersetzt. Der grösste Bandwurm ist der Grubenkopf (Dibothriocephalus latus), der mit 3000 — 4000 Gliedern eine Länge von 9 m erreichen kann. Die Finne lebt in Fischen, besonders im Hecht und in der Quappe.
Die Eierproduktion der einzelnen Gliederist ungeheuer gross. Ein Glied des gewöhnlichen Menschenbandwurms (Taenia solium) enthält etwa 50000 Eier. Wenn täglich nur drei Glieder legereif werden, so würden im Jahre 90 Millionen Eier erzeugt werden, von denen freilich nur ein geringer Teil zur weiteren Entwicklung gelangt, etwa von fünf bis zehn Millionen nur eins. Die gewaltige Eiproduktion ist also notwendig, um ein Aussterbendes Bandwurms zu verhindern. Die Natur verfolgt überhaupt das Prinzip, Tiere, die grossen Gefahren ausgesetzt sind, durch eine reiche Fortpflanzung vor dem Untergang zu schützen. Die Vermehrung der Maus, die überall, wo sie sich sehen lässt, bedroht wird, ist sehr gross. Die jungen Tiere werden früh geschlechtsreif, die Würfe sind sehr zahlreich und folgen sich sehr schnell. Die Hausmaus wird bereits im Alter von sechs Wochen Fortpflanzungsfähig und bringt im Laufe eines Jahres fünf- bis sechsmal Junge zur Welt. Bekannt ist die grosse Fruchtbarkeit des Kaninchens. Ebenso wie die Mäuse ist das Kaninchen unmittelbar nach dem Werfen wieder begattungsfähig und bringt im Laufe des Sommers 5 — 6 Würfe mit 4 — 12 Jungen zur Welt.
Die grossen Raubvögel, Adler und Geier, die keinen Gefahren ausgesetzt sind, legen nur 1 — 2 Eier und machen jährlich nur eine Brut, die kleinen Singvögel, die viel Feinde haben, und deren Bestand ausserdem durch die im Frühjahr und Herbst stattfindenden Wanderungen erheblich gelichtet wird, machen meist zwei, bisweilen sogar drei Bruten mit Gelegen von 4 — 6 Eiern. Überall also das Prinzip der schnellen und reichlichen Vermehrung, wenn die Art sehr gefährdet ist, und im Gegenteil dazu das Prinzip der Sparsamkeit, wenn eine natürliche Bedrohung fehlt. Auf diese Weise bleibt das Gleichgewicht in dem Tierbestande der Natur erhalten. Die Tiere, die keiner Gefahr preisgegeben sind und meist ein Räuberleben führen, nehmen infolge spärlicher Vermehrung nicht überhand, während arg verfolgte Tiere, die anderen Geschöpfen zur Nahrung dienen, ihren gelichteten Bestand durch eine reiche Vermehrung genügend ergänzen.
Die Bandwürmer leben als Finnen und im fertig entwickelten Zustande nur in ganz bestimmten Tieren, und zwar die Finne stets in einem anderen Tier als der Bandwurm. Die Finne des Schweines und des Rindes wird im Darm des Menschen zum Bandwurm, die Finne der Maum Darm der Katze oder des Hundes. Die Finne des Quesenbandwurmes (Taenia coenurus), der im Darm des Bundes lebt, haust im Gehirn der Wiederkäuer, besonders der Schafe, und erzeugt hier die gefährliche Drehkrankheit. Die befallenen Tiere verlieren die Orientierung, drehen sich im Kreise herum, verweigern die Nahrung und gehen zugrunde. Auf Schäfereien soll man daher streng vermeiden, das Gehirn solcher Schake an Hütehunde zu verfüttern, um eine weitere Verbreitung der Seuche zu verhindern.
Die den Bandwürmern nahestehenden Rundwürmer machen eine ähnliche Metamorphose durch.
Im Unterschied von den Bandwürmern sind bei den Rundwürmern die Geschlechter getrennt. Die Befruchtung der stets erheblich grösseren Weibchen erfolgt durch Begattung. Die Rundwürmer oder Kratzer haben vorn einen mit Widerhaken besetzten Rüssel, der sich tief in den Darm des Wirtstieres einbohrt und hier schwere Entzündungen, die häufig zum Tode führen, erzeugen kann. Besonders gefürchtet ist der Riesenkratzer (Echinorhynchus hirudinaceus). Seine Eier werden von Engerlingen der Mai- und Rosenkäfer gefressen, in deren Leiber die Larven ausschlüpfen und heranwachsen. Da die Schweine mit Vorliebe Engerlinge verzehren, so werden sie sehr leicht von dem gefährlichen Schmarotzer befallen, indem sich die Larve in dem Darm des Schweines zum Wurm umbildet. Eine gründliche Vertilgung der Maikäfer ist auch in dieser Beziehung für den Landwirt ausserordentlich wichtig.
Unter der niederen Tieren bieten die Schnecken viel Interessantes in ihrem Liebesleben. Die grosse Schlammschnecke (Limnaea stagnalis), die in unseren stehenden Gewässern überall vorkommt, ist ein Zwitter. Jedes Tier hat sowohl männliche wie weibliche Geschlechtsteile. Trotzdem ist eine gegenseitige Begattung die Regel, bei der das eine Tier als Weibchen, das andere als Männchen sich betätigt. Dasselbe Tier ist also imstande, einmal die Liebe als Frau, ein anderes Mal als Mann zu geniessen. Dagegen kommt eine gleichzeitige Betätigung der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane zweier Partner nicht vor. Wohl aber kann sich ein drittes Tier zu dem Liebesakt zweier Schnecken zugesellen. Es besteigt das obere Tier, welches sich als Männchen betätigt, und führt in dessen freiliegende weibliche Geschlechtsöffnung sein Zeugungsorgan ein. Diese dritte Schnecke wird häufig von einer vierten und diese wieder von einer fünften vergewaltigt. So entsteht eine Kette von Schnecken im Liebesrausch. Das unterste Tier tritt nur als Weibchen, das oberste Tier nur als Männchen in Tätigkeit, alle anderen Tiere geniessen die Freuden der Liebe doppelt. Verurteilt man die Schnecke zur Einzelhaft, so begattet das liebesdürstige Tier sich selbst, indem es das lang vorstreckbare Zeugungsglied in seine eigne Scheide einführt.
Bei den Landschnecken finden wir ebenfalls ein sehr ausgeprägtes Liebesleben, in dem die Tiere durch allerlei grausame Mittel, die geradezu sadistisch genannt werden können, sich gegenseitig reizen. Die Landschnecken sind gleichfalls Zwitter. Die liebesbedürftigen Tiere leiten Sie Begattung durch ein seltsames und lange dauerndes Vorspiel ein. Die Schnecken richten sich in heftiger Erregung aneinander hoch, sinken darauf wieder zurück, um eine Ruhepause von 15 — 30 Minuten zu machen. Dann beginnt das Spiel von neuem, das aber jetzt sehr lange, bisweilen bis zu zwei Stunden anhält, wobei die Tiere ihre Körper mit den Unterseiten aneinander reiben. Der Vorgang endet damit, dass das stärker erregte Tier seinen „Liebespfeil”, ein dolchartiges Kaltstück seines Geschlechtsteils, mit aller Gewalt tief in den Leib des Partners stösst. Das verwundete Tier zuckt vor Schmerz zusammen. Das Schmerzgefühl erhöht die Geilheit, und nun erfolgt die gegenseitige Begattung, bei der jedes Tier gibt und empfängt. Die gegenseitige Befruchtung dauert bei einigen Schneckenarten fast eine Stunde. Die afrikanischen Nachtschnecken besitzen ein ganzes Bündel solcher Liebespfeile, mit denen sie den Partner durchbohren. Andere Arten haben anstatt eines Pfeiles einen mit scharfen Dornen besetzten Lappen, mit denen die Tiere sich reiben.
Während der Paarung erfolgt eine starke Schleimabsonderung des Körpers, der noch lange die Spuren eines solchen Liebesdramas verrät, besonders wenn der Schleim mit rotem Farbstoff gemischt ist, wie bei einigen italienischen Schneckenformen.
Das komplizierte Liebesleben der Schnecken ist jedenfalls das Eigenartigste und Wundersamste, was die Natur, die unerschöpflich ist in ihrem Schaffen, auf diesem Gebiet ersonnen hat. —
Auch bei den Insekten zeigen Fortpflanzung und Liebesleben manch fesselnde und eigenartige Erscheinung.
Die Insekten oder Sechsfüssler bilden die artenreichste Klasse im ganzen Tierreich. Die Dreizahl beherrscht die Gliederung des Körpers, der in drei Abschnitte, Kopf, Brust und Leib zerfällt, die deutlich voneinander abgesetzt sind. Die scharfe Abschnürung des Leibes der Wespe von ihrer Brust ist ja als „Wespentaille” sprichwörtlich geworden. Auch die Brust gliedert sich wieder in drei Teile: Vorderbrust, Mittelbrust und Hinterbrust. Der Körper ist mit einer Chitinhaut bekleidet, die aus einer höchst eigentümlichen stickstoffhaltigen Holzmasse besteht. Das Chitin ist ausserordentlich widerstandsfähig gegen äussere Einflüsse, was am besten daraus hervorgeht, dass sich ausgetrocknete Insektenleiber ohne besondere Konservierung Jahrhunderte in Sammlungen aufbewahren lassen, ohne dass sie ihre Gestalt verlieren oder irgendeine Einbusse erleiden. Bei den Käfern bildet die sehr harte Chitinhülle einen festen Panzer, bei den Heuschrecken ist sie eine lederartige Haut und bei den Fliegen und Schmetterlingen dünn und weich.
Sehr wichtige Organe für das Leben der Insekten sind die am Kopf sitzenden Fühler, die in erster Linie dem Tastsinn dienen, aber auch das Gehör und den Geruch zu vermitteln scheinen. Die Fühler sind von ausserordentlich verschiedener Gestalt, so dass sich eine allgemeine Angabe überhaupt nicht machen lässt. Sie sind bald kolbenförmig, bald borstenförmig, becherartig oder fadenartig dünn und lang und bestehen aus zahlreichen Gliedern, deren Anordnung ebenso mannigfaltig ist, so dass man von gezähnten, geblätterten oder geschuppten Fühlern sprechen kann.
Bei den Bockkäfern erreichen die Fühler eine ausserordentliche Länge, die bei manchen Arten die Leibeslänge um ein Vielfaches übertrifft. Die Bockkäfer gebrauchen ihre langen Fühler als Balancierstangen beim Klettern, indem sie dieselben seitwärts ausstrecken.
Die Insekten atmen nicht durch den Mund, sondern durch Öffnungen (Stigmen) am Leibe und der Brust, die mit einem den Körper durchziehenden Röhrensystem, Tracheen genannt, in Verbindung stehen.
Fast alle Insekten machen in ihrer Entwicklung eine Metamorphose durch. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die sich verpuppen. Aus der Puppe entsteht dann erst das fertige Insekt, Imago genannt. Larve und Imago sehen ganz verschieden aus, wie es ja unverkennbar in der Raupe und dem Schmetterling sich ausprägt. Die Puppen sind „freie Puppen”, wenn die Gliedmassen des Insekts bereits frei liegen, man nennt sie „Mumienpuppen”, wenn sie ein geschlossenes Ganzes bilden, an dem die Leibesteile des fertigen Insekts nur durch Furchen oder geringe Erhöhungen angedeutet sind, und „Tönnchenpuppen”, wenn die Puppe mit einer besonderen Hülle, dem Kokon, umgeben ist.
Bisweilen fehlt das Puppenstadium. So bildet sich in der im Wasser lebenden Larve der Libelle allmählich das fertige Insekt aus. Die verwandlungsfähige Larve kriecht an einem Pflanzenstengel aus dem Wasser heraus, ihre Haut platzt auf dem Rücken auf und die fertige, geflügelte Libelle steigt heraus wie ein Phönix aus der Asche.
Die Dauer des Larvenzustandes und der Puppenruhe wie die Lebenszeit des fertigen Insekts sind sehr verschieden. Meist spielt sich der ganze Vorgang im Laufe des Sommers ab, und das Insekt stirbt gleich nach der Fortpflanzung noch vor dem Winter. Die Lebenszeit der Insekten ist also eine recht kurze. Häufig folgen sich sogar zwei oder mehrere Generationen im Laufe des Sommers. Nach ihrer kurzen, bisweilen nur nach Stunden zählenden Lebensdauer führt die Eintagsfliege ihren Namen. Die Eintagsfliegen entwickeln sich wie die Libellen ohne Puppenstadium unmittelbar aus der ans Land steigenden Wasserlarve, um sofort ihren luftigen Hochzeitsreigen zu beginnen. Ihr kurzes Dasein, das jedoch nicht immer nur auf einen Tag beschränkt ist, sondern bisweilen auch 2 — 3 Tage währen kann, ist einzig und allein dem Liebesleben gewidmet. Die zarten Tiere haben nur verkümmerte, unbrauchbare Mundteile und nehmen keine Nahrung zu sich. Alles ist auf das Geschlechtsleben eingestellt. Die Männchen vereinigen sich zu Tausenden und Millionen, um über dem Wasserspiegel ihre gemeinsamen Tänze aufzuführen, an denen die Weibchen nicht teilnehmen. Erscheint ein Weibchen in der Nähe des Tanzplatzes, so stürzen sich mehrere Männchen auf den begehrten Schatz. Eins von ihnen vereinigt sich mit dem Weibchen, während die übrigen sich wieder der tanzenden Schar zugesellen, um vielleicht das nächste Mal mehr Glück zu haben.
Das Männchen besiegelt die Freuden der Liebe mit dem Tode, und auch das Weibchen geht den Weg allen Fleisches, sobald es die Eier im Wasser abgelegt hat. Die Weibchen einiger Arten verbringen 10 — 14 Tage nach der Begattung regungslos an einem ruhigen Ort, ohne Nahrung zu sich zu nehmen. In dieser Zeit entwickeln sich die im Leibe befindlichen Eier zu Embryonen, die von dem Weibchen lebendig am Wasser zur Welt gebracht werden. Die grösste europäische Eintagsfliege, in Ungarn „Theissblüte” genannt, erscheint stets an gewissen Tagen in gewaltiger Menge, so dass Land und Wasser unter den Tanzplätzen der Männchen mit den Leibern der ermatteten Insekten dicht besät sind. Das Platzen der Larvenhüllen und das Ausschlüpfen der Fliegen, was stundenlang unaufhörlich vonstatten geht, erzeugt ein rieselndes Geräusch, wie ein leiser Regen. An der Lippe, besonders bei Hamm in Westfalen, an der Maas in Belgien, an der Donau und Theiss in Ungarn wiederholen sich jedes Jahr die gewaltigen Schwärme dieser Eintagsfliege.
Beim Maikäfer dauert das Larvenstadium 3 — 4 Jahre. Der erwachsene Engerling verpuppt sich im August. Im November kriecht der Käfer aus und verharrt unter der Erde, bis die Frühjahrssonne im Mai ihn aus seinem dunkeln Versteck herauslockt. Das Männchen stirbt während der lange währenden Begattung ab, wird dann vom Weibchen abgestreift, welches sich in die Erde verkriecht, um seine Eier abzulegen und dann ebenfalls zu sterben. Bei den Insekten sind Fortpflanzung und Tod auf das innigste miteinander verknüpft. Es gibt aber auch Ausnahmen. Bei den Läusen findet eine wiederholte Fortpflanzung statt. Eine Kopflaus bringt es in 2 Monaten auf etwa 5000 Nachkommen. Die jungen Läuse, die keine Metamorphose durchlaufen, sondern gleich fertig dem Ei entschlüpfen, sind bereits in 2 — 3 Wochen fortpflanzungsfähig. Ähnlich liegen die Verhältnisse beider Bettwanze, die den ganzen Sommer hindurch eine reiche Nachkommenschaft erzeugt und dann überwintert, um im nächsten Jahre ihre fruchtreiche Tätigkeit fortzusetzen. Die Wanzen sind überaus lebenskräftig, vertragen Kälte und langes Fasten. Ein Forscher hielt eine lebende Wanze ein halbes Jahr in Einzelhaft ohne Nahrung.
Ebenso wie das Puppenstadium oder Larvenstadium kann unter Umständen auch das Eistadium in der Entwicklung der Insekten fortfallen. Wir sahen schon, dass es lebendiggebärende Eintagsfliegen gibt. Auch die Schmeissfliegen legen keine Eier, sondern die Maden schlüpfen bereits im Mutterleibe aus.
Während bei vielen Insekten entweder die Eier oder Larven überwintern und dadurch die Art erhalten bleibt, überwintern bei den Wespen die Weibchen der letzten Sommergeneration, um im folgenden Frühjahr ein neues Staatenwesen zu gründen.
Bei den Bienen hat die Königin, welche bekanntlich die einzige fortpflanzungsfähige weibliche Biene im Bienenstaat ist, ein Leben von 4 — 5 Jahren und legt jährlich 50000 — 60000 Eier. Eine so lange Lebenszeit eines Insekts im Imago-Zustande ist aber eine Ausnahme. Die meisten Insekten verbringen den grössten Teil ihres Daseins als Larve, und die Umwandlung zum fertigen Insekt dient lediglich der Fortpflanzung und bildet den Abschluss des Lebens.
Bei den Bienen haben wir drei Geschlechter zu unterscheiden: die Königin, welche allein Eier legt, die männlichen Drohnen und die Arbeiter als unfortpflanzungsfähige weibliche Bienen. Die Königin wird zu Beginn ihres Lebens nur einmal von einer Drohne befruchtet. Sie unternimmt zu diesem Zweck einen Ausflug im Gefolge zahlreicher Drohnen, unter denen nur einer das Glück des Liebhabers zuteil wird. Dann kehrt sie als „Frau” in den Stock zurück, in dem sie als „Gefangene” unter sorgsamer Pflege der Arbeiterinnen lebt, bis sie von einer neuen, jungen Königin vertrieben wird. Ihre ganze Tätigkeit besteht einzig und allein darin, Eier zu legen. Der männliche Same wird in besonderen Samentaschen aufbewahrt und bleibt hier während der ganzen Lebenszeit der Königin „gebrauchsfähig”. Die Königin hat es nämlich ganz in der Gewalt, ob das Ei, welches sie legt, befruchtet werden soll oder nicht. Im ersteren Fall wird das Ei einen Augenblick an die Öffnung der Samentaschen angepresst, wodurch einige Samenfäden austreten und mit dem Ei verschmelzen. Soll die Befruchtung verhindert werden, so gleitet das Ei schnell an den Samentaschen vorbei. Aus den befruchteten Eiern gehen die Arbeiter hervor, aus den unbefruchteten Eiern die männlichen Drohnen. Ist der Inhalt der Samentaschen erschöpft, was bei zu langer Lebensdauer der Königin eintreten kann, dann werden nur noch Drohnen erzeugt, und da die Arbeiter fehlen, so geht ein solcher „drohnenbrütiger” Stock zugrunde.
Bei den Bienen haben wir also eine doppelte Art der Fortpflanzung, einmal eine geschlechtliche durch Zeugung, und zweitens eine „parthenogenetische”, d. h. jungfräuliche (Párthenos, griechische Bezeichnung für Jungfrau).
Die Parthenogenesis kommt bei vielen Insekten vor, jedoch immer in Verbindung oder Abwechslung mit geschlechtlicher Fortpflanzung. Den Wechsel beider Arten der Fortpflanzung nennt man „Heterogonie”. So spielt bei den durch ihre vorzügliche Mimikry ausgezeichneten Stabheuschrecken die Jungfernzeugung eine besondere Rolle. Die meisten Tiere sind weiblichen Geschlechts; die viel kleineren Männchen sind sehr selten. Die Fortpflanzung erfolgt fast immer ungeschlechtlich, und zwar gehen hier aus den parthenogenetischen Eiern stets Weibchen hervor. Die Jungfernzeugung setzt sich durch viele Generationen hindurch fort, hat man doch von gefangenen Stabheuschrecken schon mehr als 20 Generationen auf diesem Wege entstehen sehen. Eine ausschliessliche Jungfernzeugung scheint jedoch nicht möglich zu sein, denn sonst brauchte es überhaupt keine Männchen zu geben. Zur Erhaltung der Art ist, wenn auch selten, so doch hin und wieder eine geschlechtliche Fortpflanzung notwendig. Aus den befruchteten Eiern werden anscheinend nur Männchen erzeugt.
Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zur Honigbiene zurück. Wenn die Königin nur einmal in ihrem Leben begattet wird, wozu, kann man fragen, sind dann im Bienenvolk die vielen Drohnen notwendig? Im Bienenvolk entstehen im Laufe des Sommers junge Königinnen aus befruchteten Eiern, indem die Larven von den Arbeitsbienen mit einem besonders eiweisshaltigen Futterstoff, dem „Königinnenfutter”,versorgt werden. Durch bessere Ernährung wird also aus der weiblichen Larve anstatt einer unfruchtbaren Arbeitsbiene eine fortpflanzungsfähige Königin auf künstlichem Wege ausgebildet. Ist diese herangewachsen, dann verlässt die alte Königin ihr Heim, gefolgt von einer grossen Anzahl Bienen. Die Bienen „schwärmen”, wie der Imker sagt, um an anderer Stelle mit der alten Königin einen neuen Staat zu gründen. Die junge Königin des alten Stockes übernimmt dort die Regentschaft und macht im Verlaufe der ersten 14 Tage ihren Hochzeitsflug in Begleitung zahlreicher Drohnen. Wenn auch nur eine männliche Biene zur Befruchtung notwendig ist, so hat die Masse der Drohnen doch ihre Bedeutung. Die Königin wird bei ihrem Fluge durch die Drohnen, die sie von allen Seiten umschwärmen, gegen die Nachstellungen insektenfressender Vögel geschützt, und hierin ist wohl der Grund für die zahlreiche Drohnenansammlung im Bienenstock zu erblicken. Die meisten Drohnen kommen niemals in ihrem Leben zu einer geschlechtlichen Betätigung. Ihre Lebensaufgabe besteht einzig und allein darin, die junge Königin auf ihrem Hochzeitsfluge zu beschützen. Die Drohne, die von der Königin zum Liebhaber auserkoren wurde, besiegelt ihr Glück mit dem Tode. Aber nicht besser ergeht es den übrigen Drohnen, die die Königin begleiteten. Ihre Lebensaufgabe, den Hochzeitsreigen der jungen Herrscherin zu schützen, ist erfüllt, und ihr Dasein hat seine Berechtigung mehr. Bei ihrer Rückkehr in den Stock harrt ihrer ein trauriges Los. Die Arbeiterinnen, die sie früher sorglich fütterten und pflegten, fallen über sie her und töten die elenden Ritter, die sich wehrlos in ihr Schicksal ergeben. Einige ängstliche Gemüter suchen sich dem Blutgericht zu entziehen und verbergen sich in Schlupfwinkeln, wo sie elend verhungern.
Sind im Sommer keine weiteren Königinnen mehr zu erwarten, dann beginnt ein neues Blutgericht. Die Drohnen werden von den Arbeiterinnen abgeschlachtet, da sie als unnütze Fresser und Faulenzer überflüssig sind. Das Prinzip der Unterstützung für Nichtstun, das ein Volk zur Bequemlichkeit und Faulheit erzieht, kennt die strenge Zucht und Ordnung des Bienenstaates nicht!
Die erste Arbeit, welche die junge Königin in ihrem neuen Heim verrichtet, geht darauf aus, sich die Alleinherrschaft zu sichern. Sie tötet sämtliche noch vorhandenen Königinnenlarven in ihren Zellen. Nicht immer gelingt ihr das grausame Werk. Bisweilen wird wieder eine junge Königin flügge, der dann die Vorgängerin das Feld räumt, indem sie mit einem neuen Schwarm auswandert. Das Auswandern der Königin erfolgt, bevor die neue Königin ihre Wiege verlassen hat. Die Arbeitsbienen bewachen die Königinnenzelle mit grösster Sorgfalt und lassen die junge Herrscherin nicht eher frei, bis die alte Königin das Feld geräumt hat. Befindet diese sich ausnahmsweise noch im Stock, wenn ihre Nachfolgerin ausschlüpft, dann entspinnt sich sofort ein heftiger Kampf auf Leben und Tod zwischen den beiden Rivalinnen. Niemals dulden sich zwei Königinnen nebeneinander im Bienenstaat.
Verliert ein Stock durch Zufall seine Königin, dann ist er nicht dem Untergang preisgegeben, da die Arbeitsbienen jederzeit in der Lage sind, Larven ihresgleichen durch geeignete Fütterung zur Königin heranzubilden.
Ebenso wie Königin- und Arbeiterlarven wachsen auch die Drohnen in besonderen Zellen heran und werden mit einem eigenen Futter versorgt.
Die Lebensdauer der Arbeiterbienen währt im Sommer nicht länger als 6 Wochen. Nur die letzte Generation überwintert, um im Frühjahr, wenn das Bienenleben wieder beginnt, die erforderlichen Arbeiten verrichten zu können.
Bei den Staatenbildenden Ameisen ist ebenso wie bei den Bienen die Königin nur Eiermaschine, die die Fortpflanzung besorgt. Die Arbeiter sind verkümmerte Weibchen, zu denen sich noch eine andere Kaste, die „Soldaten”, gesellt, welche ebenfalls unfruchtbare Weibchen sind. Über ihre Lebensaufgabe wie über die Arbeitsteilung im Bienen- und Ameisenvolk wird uns das spätere Kapitel „Soziales Leben und Staatenbildung” eingehende Aufklärung geben.
Arbeiter und Soldaten sind ungeflügelt, die Königin und die Männchen der Ameisen tragen Flügel. Die Königin legt jedoch, sobald sie ihre Geburtsstätte verlassen und ein eigenes Heim gegründet hat, die Flügel ab. Sie wird zum unflugfähigen Insekt und führt bis an ihr Lebensende die Herrschaft im Ameisenstaat, während die jungen, anfangs geflügelten Königinnen auswandern. Der Vorgang ist also gerade umgekehrt wie bei den Bienen. Der erste und einzige Flug, den die junge Königin unternimmt, ist der Hochzeitsreigen, bei dem die einmalige Begattung erfolgt.
Die Königinnen der Ameisen kennen nicht die Eifersucht, die die Bienenköniginnen erfüllt. Dank ihrer verträglichen Natur dulden sich mehrere Weibchen nebeneinander.
Bei den Ameisen gibt es zwischen der Königin und den Arbeiterinnen noch Übergangsformen, d. h. Arbeiterinnen, die der Königin ähnlich sind und parthogenetische Eier legen, aus denen Arbeiter hervorgehen. Auch die Arbeiterinnen unterscheiden sich durch ein verschiedenartiges Aussehen, es gibt Formen mit sehr grossem Kopf (Makroergaten) und ganz kleine Tiere (Mikroergaten). Die letzteren sind gewöhnlich die ersten Nachkommen einer jungen Königin. Für die Geschlechtsbestimmung der Ameisen ist jedenfalls wie bei den Bienen die Nahrung, welche die Larve erhält, von Einfluss. —
In sehr eigenartiger Weise verläuft das Fortpflanzungsgeschäft der zu den Zweiflüglern gehörenden Ibisfliege (Atherix ibis), die am Wasser lebt. Zur Ablage der Eier bilden die Weibchen grosse Gesellschaften. Ein Weibchen klammert sich an einem über dem Wasser hängenden Zweig an, heftet den Eiklumpen fest und stirbt sofort. Auf den toten Körper lässt sich ein zweites Weibchen nieder, benutzt diesen als Brutstätte und bleibt als Leiche daran hängen. So geht es unaufhörlich fort, bis sich schliesslich ein grosser Klumpen toter Fliegen gebildet hat, der wie eine Traube herunterhängt. Die aus den Eiern schlüpfenden Larven ernähren sich zunächst von den toten Leibern ihrer Mütter und lassen sich dann ins Wasser herabfallen, um ihre weitere Entwicklung fortzusetzen. Die schwarze Ibisfliege mit glashellen Flügeln lebt in Mitteleuropa, ist aber nirgends häufig.
An den Blättern der Bäume sehen wir häufig eigentümliche, kugelförmige Gebilde. Sie rühren von einem Insekt her, der Gallwespe. Die Gallwespen bringen ihre Eier durch einen Stich in das Fleisch eines Blattes. Eier schlüpfen die Larven aus. Es bildet sich dann die Galle, die die Larve völlig umschliesst. Ihre Entstehung wird also nicht allein durch den Stich der Wespe hervorgerufen, sondern auch durch Einwirkung der Larve auf die Zellen des Blattes. Der Vorgang selbst ist jedoch unbekannt. In der Galle macht dann die Larve ihre ganze Entwicklung bis zum fertigen Insekt durch. Häufig enthält eine Galle mehrere Larven in besonderen Zellen. Bei den Gallwespen wechselt geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung ab.
Die Schlupfwespen oder Ichneumoniden legen ihre Eier in die Leiber anderer Insekten, deren Raupen und Puppen, oder in die Eier. Die Larven wachsen im Innern des Wirtstieres heran, verpuppen sich hier, um schliesslich als fertige Schlupfwespe zum Vorschein zu kommen. Bei einigen Arten verlassen die Larven vor der Verpuppung ihre lebende Behausung. Das Schmarotzertum hat in den meisten Fällen den Tod des Wirtstieres zur Folge. Da die Ichneumoniden mit Vorliebe die forstschädlichen Insekten zu ihrem Brutschmarotzertum auswählen, so sind sie ausserordentlich nützlich und tragen in erster Linie zur Bekämpfung von Insektenkalamitäten bei, vielleicht ebenso gut oder noch besser als die insektenfressenden Vögel, die durch Vertilgung von Schlupfwespen ihren sonst so grossen Nutzen, den sie als Insektenfresser stiften, teilweise wieder aufheben. Man hat infolgedessen versucht, die wirtschaftliche Bedeutung der Vögel herabzusetzen und den Vogelschutz aus diesem Grunde für unnötig zu erklären, eine Auffassung, die aber mit den wertvollen Versuchen unseres ersten Vogelschützers, des Freiherrn von Berlepsch, nicht im Einklang steht. Dieser verdienstvolle Ornithologe hat durch jahrelange Versuche in seiner Vogelschutzstation Seebach nachgewiesen, dass der Nutzen der Vögel zur Bekämpfung einer Insektenkalamität gewaltig gross ist. Während in seiner Forst, die durch Nistkästen und Vogelschutzgehölze ein wahres Vogelparadies ist, seit langen Jahren keine Raupenplage auftrat, wurde die angrenzende Staatsforst, in der kein organisierter Vogelschutz betrieben wird, zu gleicher Zeit wiederholt von schwerem Raupenfrass heimgesucht, der stets an der Grenze des vogelreichen Berlepschschen Reviers haltmachte — ein deutlicher Beweis, dass die Tätigkeit der Vögel bei weitem höher eingeschätzt werden muss als der Ruben der Schlupfwespen. —
Die Fortpflanzung der Schlupfwespen zeigt noch eine andere Eigentümlichkeit. Bei einigen Arten kommt aus einem Ei nicht eine einzelne Larve heraus, sondern es schlüpfen aus demselben Ei eine ganze Anzahl von Larven, die nach Hunderten zählen können. Diesen eigenartigen Vorgang, die Entwicklung vieler Individuen aus einem einzigen Ei, hat man „Polyembryonie” genannt. Alle aus demselben Ei hervorgegangenen Wespen haben stets das gleiche Geschlecht.
Ein ähnlicher Vorgang wurde sogar bei den Säugetieren festgestellt. Bei einem südamerikanischen Gürteltier spaltet sich das Ei in vier Teile, aus denen sich je ein Individuum entwickelt. Auch die Zwillingsgeburten des Menschen entstammen nicht immer zwei Eiern, sondern bisweilen nur einem Ei, das zwei Zellkerne enthält. Die Wissenschaft unterscheidet daher „eineiige” und „zweieiige” Zwillinge. —
Unter den Fischen gibt es einige Arten, die man als lebendiggebärend bezeichnen kann, da der Laich bereits im Mutterleibe auskommt und die jungen Fischchen also lebend geboren werden. Hierzu gehören Haifische, Rochen, einige Zahnkarpfen und mehrere andere Arten. Bei den lebendiggebärenden Fischen findet eine regelrechte Kopulation der Geschlechter statt, wobei häufig eigenartige Stellungen eingenommen werden. So schlingt bei den Haien sich das Männchen kreisartig um den Körper des Weibchens herum, um die zu einem Begattungsorgan umgebildete Bauchflosse in die weibliche Geschlechtsöffnung einzuführen. Die Vereinigung währt etwa 20 Minuten.
Bei den meisten Fischen ist eine äussere Befruchtung die Regel, indem beide dicht nebeneinander stehenden Geschlechter ihre Zeugungsprodukte ins Wasser entleeren, wo das Sperma sich mit den Eiern vermischt. Dem Laichakt gehen häufig erregte Liebesspiele voraus. Die Fische „reiben sich”, d. h. Männchen und Weibchen schwimmen dicht aneinander vorbei und berühren sich mit dem Bauch oder den Seiten. Schmerlen und Schleie reiben mit den verdickten Strahlen ihrer Bauchslossen die Weibchen, um sie geschlechtlich zu reizen.
Einen sehr erregten Liebestanz führt eine kleine Barbe (Danio rerio H.) auf, die ein beliebter Zierfisch in der Aquarienliebhaberei ist. Männchen und Weibchen wirbeln umeinander herum, wobei das Männchen das Weibchen fortwährend mit dem Maule stösst und pufft. Schliesslich hebt das Männchen von unten mit dem Kopf das Weibchen bis zur Oberfläche des Wassers empor, wo sich beide im Sinnenrausch mit zappelnden Bewegungen umeinander herumschleudern.
Die meisten Fische leben polygam, und zwar verkehrt entweder ein Weibchen mit mehreren Männchen (Polyandrie), oder es besitzt ein Männchen mehrere Weibchen (Polygynie). Die Haie und wenige andere Fische leben monogam. Die Haifische sollen sogar eine lebenslängliche Ehe schliessen.
Die Fruchtbarkeit der Fische ist ungeheuer gross. Die Scholle legt je nach ihrer Grösse 9000 — 500000 Eier. Der Dorsch produziert sogar mehrere Millionen Eier in einer Laichperiode. Im Gegensatz dazu legt der Stichling jährlich nur 80 — 100 Eier, was wohl die geringste bei den Fischen vorkommende Eizahl ist.
Die Eier werden entweder einzeln abgelegt, oder sie bilden Schnüre und Klumpen.
Der Laich wird teils an Pflanzen oder Steinen angeheftet, oder er sinkt vermittels seiner natürlichen Schwere zu Boden, oder schwimmt frei im Wasser in einer bestimmten Tiefe. Die letztere Art der Eier besitzen dann besondere Öltropfen, welche das spezifische Gewicht verringern, oder auch Schwebevorrichtungen in Gestalt von Fäden und Borsten.
Manche Seefische laichen in grossen Tiefen, der Aal z. B. in 1000 m Tiefe.
Die Entwicklung des Laiches ist hauptsächlich von der Temperatur des Wassers abhängig. Forellenlaich entwickelt sich bei 2 °C in 205 Tagen, bei 10°C dagegen in 41 Tagen.
Die Entwicklungsdauer der Eier unter normaler Temperatur schwankt je nach der Fischart zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten. Beim Karpfen beträgt sie etwa eine Woche, bei den Lachsen 2 — 3 Monate.
Nicht alle jungen Fische haben bei der Geburt gleich ihre richtige Fischgestalt, sondern besitzen bisweilen anfangs eine Larvenform, aus der sich erst allmählich der vollendete Fisch herausbildet. Dies ist bei den Neunaugen, dem Aal und den Plattfischen der Fall, worüber in dem Kapitel „Wanderungen der Tiere” noch näher berichtet werden soll.
Die meisten Fische kümmern sich nicht um den Laich und ihre Nachkommenschaft, einige machen jedoch eine Ausnahme und betätigen sich in einer mehr oder weniger ausgeprägten Brutpflege, die in höchster Weise bei den nestbauenden Fischarten hervortritt.
Andere Fische bauen zwar keine Rester, aber sie wissen in anderer Weise sehr geschickt, man könnte fast sagen sinnig, für eine geeignete Kinderstube zu sorgen. Das Weibchen des Bitterlings (Rhodeus amarus) bringt den Laich vermittels seiner langen, wurmartigen Legeröhre in die Kiemen der Malermuschel. Da die Schalen dieser Muschel in der Kiemengegend etwas klaffen, so kann die Legeröhre des Fisches nicht beschädigt werden, wenn die Muschel ihre Schalen schliesst. Während des Laichaktes hält sich das Männden in der Nähe auf, um seinen Samen in den Atemschlitz der Muschel zu ergiessen, sobald das Weibchen abgelaicht hat. Die Befruchtung des Laiches erfolgt also innerhalb der Muschel. Die in den Kiemen der Muschel ausgeschlüpfte Fischbrut gelangt durch die Kloakenöffnung ins Freie. Die Muschel erleidet durch den eigentümlichen Ammendienst keinen Schaden. Das Vorhandensein von Fisclaich in der Malermuschel wurde zuerst im Jahre 1787 bekannt, und 1869 entdeckte Noll, dass der Bitterling der Urheber dieser eigentümlichen Erscheinung ist.
Der Bitterling ist ein zu der Familie der Karpfen gehörender, kleiner europäischer Flussfisch, mit grünem Rücken und silberglänzenden Seiten. In der Fortpflanzungszeit legt das Männchen ein farbenprächtiges Kleid an. Der ganze Körper enthält einen schönen Schillerglanz, in dem Stahlblau und Violett besonders hervortreten. Die Körperseiten sind durch einen smaragdgrünen Längsstreifen geziert. Brust und Bauch sind orangegelb, Rücken- und Afterflosse hochrot.
Das Weibchen des Butterfisches (Pholix gunellus) wählt als Brutofen das Bohrloch einer Muschel, rollt sich in Schlangenwindungen um die Eier und verharrt in dieser Stellung, bis die Jungen ausschlüpfen. Eier findet also eine regelrechte Brutpflege statt. Der Butterfisch hat aalähnliche Gestalt und glatte Haut. Er lebt in den Küstengewässern Nordeuropas und im Nördlichen Eismeer.
Die Cichliden, welche Flüsse und Seen der Tropen bewohnen, brüten den Laich in ihrem Maule aus und führen daher auch den Namen „Maulbrüter”. Im Maule der Mutter verbleiben auch die embryonenhaften Jungen so lange, bis sie Fischgestalt erhalten haben, was etwa 14 Tage währt. Während dieser Zeit erweitert sich beim alten Fisch die Haut des Unterkiefers zu einem Sack, in dem die junge Brut heranwächst. Die Jungen werden nach Verlassen der sonderbaren Kinderstube noch längere Zeit von dem alten Fisch geführt. Bei Gefahr sammeln sie sich vor dem Kopf der Mutter. Diese öffnet das Maul und die Jungen schlüpfen hurtig hinein. Ist die Gefahr vorüber, so gibt die Alte ihre Kinder wieder frei.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Fischen üben bei den Maulbrütern nicht die Männchen, sondern meist die Weibchen die Brutpflege aus.
Das Fortpflanzungsgeschäft der Fische hat so viel Interessantes und Eigenartiges, dass wir auch noch einen Blick auf die absonderliche Brutpflege der Seepferdchen und Seenadeln werfen wollen. Das Männchen dieser sonderbaren Fische besitzt eine Bruttasche, in die das Weibchen den Laich legt. Nach Empfang der Eier wird die Bruttasche wasserdicht geschlossen. Die Eier werden in der Bruttasche befruchtet, betten sich in die Haut ein und werden hier durch eine eiweisshaltige Flüssigkeit, die aus der Haut kommt, ernährt. Wir sehen also bei diesen Fischen eine Einrichtung, die an die Placenta, den Mutterkuchen der Säugetiere, erinnert, der ja bekanntlich den Embryo ernährt. —
So finden wir bereits bei den Fischen die erste Anlage zur Entwicklung des Säugetiers — ein vortrefflicher Hinweis für die gemeinsame Abstammung aller Lebewesen. Umgekehrt zeigt die Ontogenie der Säugetiere den einstigen Fischahnen. Der Embryo aller Säugetiere erhält auf einer gewissen Stufe seines Wachstums am Halse Kiemenbögen, wie sie nur die Fische haben, die sich später wieder zurückbilden, und die Gliedmassen spriessen zuerst als flossenartige Plättchen aus dem Körper hervor, um sich dann zu Füssen und Händen umzubilden. Die ehemalige Fischnatur flackerte also noch einmal in der Keimesentwicklung auf.
Bei den Amphibien findet ähnlich wie bei den Insekten eine Metamorphose statt. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die im Wasser leben und sich erst allmählich zum fertigen Tier umwandeln, indem die Kiemen einschrumpfen, Lungenatmung eintritt und gleichzeitig die äusseren Gliedmassen am Körper herauswachsen. Auf diese Weise entsteht aus der Kaulquappe der Frosch.
Einige Frösche zeichnen sich durch eine absonderliche Brutpflege aus. Bei dem in Chile lebenden Nasenfrosch (Rhinoderma darwini) bildet die Brust- und Bauchhaut einen weiten Sack, der mit der Mundhöhle in Verbindung steht. In diese Bruttasche steckt das Männchen die vom Weibchen in seiner Gegenwart abgelegten und von ihm befruchteten Eier. Der Frosch lebt monogam, und das Weibchen legt die Eier einzeln oder paarweise innerhalb mehrerer Tage. Auch die Kaulquappen machen die ganze Metamorphose in dem Kehlsack des Vaters durch und werden erst als wohlentwickelte Frösche gewissermassen aus dem Maule des Vaters geboren. Der Nasenfrosch führt seinen Namen nach dem langen, spitzen Fortsatz seines Maules, der wie eine spitze Nase aussieht. Der sehr kleine, nur 3 cm lange Frosch ist grün, gelb oder auch rotbraun gefärbt mit dunkler Linienzeichnung auf der Oberseite.
Das Männchen der Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) wickelt sich den Laich des Weibchens, der in langen Schnüren abgelegt wird, um die Schenkel der Hinterfüsse und schleppt die Last mit sich umher, bis die Eier gereift sind. Dann begibt es sich ins Wasser, wo die Krötenlarven auskriechen, um hier ihre 2 — 3 Jahre währende Umwandlung durchzumachen.
Die amerikanische Wabenkröte oder Pipa (Pipa americana) besitzt im weiblichen Geschlecht auf dem Rücken eine grosse Anzahl wabenähnlicher Bruttaschen. Bei der Paarung umfasst das Männchen, wie es bei den Fröschen üblich ist, den Bauch des Weibchens mit den Vorderfüssen. Das Weibchen stülpt seine Kloake weit nach oben heraus; die Eier werden durch den Druck des Männchens herausgepresst und von dem ausfliessenden Sperma befruchtet. Durch den Druck des Männchens werden die Eier über den Rücken des Weibchens gleichmässig verteilt, so dass in jede Bruttasche ein Ei eingebettet wird. Die aus den Eiern schlüpfenden Larven bleiben in den Bruttaschen der Mutter, bis sich die Umwandlung zur fertigen Kröte vollzogen hat.
Ein brasilianischer Laubfrosch (Phyllomedusa hypochondrialis) legt seine Eier auf Blättern, die über dem Wasser hängen, ab und klebt dabei mit der Gallerte des Laiches das Blatt zu einer Tüte zusammen, in der die Eier auskommen. Der Schaum, der die Eier umgibt, wird flüssig, und in dieser in der Blattfalte stehenden Flüssigkeit fristen die Larven die erste Zeit ihres Lebens. Allmählich löst sich die Tüte auf, und die Jungen fallen ins Wasser, wo sie ihre Entwicklung vollenden.
Ein anderer Frosch, Arthroleptis seychellensis, der, wie der Name sagt, auf den Seychellen vorkommt, brütet seine Eier in feuchtem Laub aus. Die Larven heften sich mit dem Bauch auf dem Rücken des alten Frosches fest, werden durch dessen Haut ernährt und machen hier ihre Umwandlung durch. —
Im Gegensatz zu den Lurchen entschlüpfen die Reptilien im fertig ausgebildeten Zustande dem Ei. Eine Brutpflege tritt nur bei einigen Krokodilen auf, die die Eier bewachen und die Jungen ins Wasser führen, sowie bei einigen Riesenschlangen, welche ihre Eier ausbrüten. Sonst kümmern sich gerade die Reptilien am wenigsten um ihre Nachkommenschaft.
Die Nilkrokodile vergraben ihre Eier in den Sand in der Nähe des Wassers. Die amerikanischen Arten dagegen errichten regelrechte Brutöfen aus feuchtem Laub und Pflanzenteilen, die sie zu einem Haufen zusammenschichten, in dem die Eier geborgen werden. Das vermodernde Laub erzeugt hohe Wärme, die die Eier zeitigt.
Dieser künstliche Brutofen der Krokodile führt uns zu den Vögeln, unter denen die zu den Hühnervögeln gehörenden australischen Wallnister ebenso verfahren. Auch diese stellen aus Laub und Erde einen grossen Haufen her, in dem sie die Eier unterbringen. Sie brüten nicht selbst, sondern die Eier kommen in diesem Brutofen durch die hier sich bildende hohe Temperatur zur Entwicklung. Die jungen Wallnister verlassen in einem sehr entwickelten Zustande das Ei. Sie sind die einzigen Vögel, die mit einem fertigen Federkleid zur Welt kommen und schon im Alter von wenigen Tagen Flugfähig sind. Sie müssen sich vom ersten Tage ihres Lebens an allein durch die Welt schlagen, da ihre Eltern sich nicht um sie kümmern. Eine Ausnahme machen nur die Taubenwallnister, bei denen eine kurze Brutpflege stattfindet. Das Männchen bewacht die Brutstätte und deckt sogar bei anhaltend trockner Witterung eine neue Laubschicht darauf, um die zur Gärung notwendige Feuchtigkeit darin zu erhalten. In der ersten Zeit bringt es auch die Jungen abends wieder in dem Brutofen unter zum Schutz gegen die Kälte der Nacht. Doch schon nach wenigen Tagen überlässt der Vater seine Kinder ihrem eigenen Schicksal.
Die Nistweise der Wallnister ist offenbar die ursprüngliche Art der Fortpflanzung der Vögel, aus der sich erst im Laufe der Zeit Nestbau und Brutgeschäft entwickelt haben. So treten hier innige Beziehungen zwischen den Vögeln und den Reptilien hervor, die beide auch in bezug auf den Bau ihres Körpers manche Gleichheiten und Ähnlichkeiten zeigen, die darauf hinweisen, dass die Vögel sich aus den Reptilien entwickelt haben. Die Richtigkeit dieser Annahme bestätigt der Urvogel Archäopteryx aus der Kreidezeit, der, wie wir gesehen haben, den Übergang vom Reptil zum Vogel bildet.
Bei den Vögeln bieten Liebesleben und Fortpflanzung so viel Interessantes, dass es unmöglich ist, all die vielseitigen Erscheinungen erschöpfend zu schildern. Das Liebeswerben der Männchen erfolgt in verschiedenster Art. Die Singvögel lassen in der Brunst ihre Stimme zur vollsten Entfaltung gelangen. Der Schlag der Nachtigall in lauer Maiennacht mit den tiefen, so zu Herzen dringenden Flötentönen ist ihr Liebeslied. Andere Vögel, wie die Raubvögel, machen ihrem Weibchen durch prachtvolle Flugspiele den Hof, wieder andere führen liebestrunkene Tänze aus, wie es der Birkhahn tut, der sich mit gefächertem Spiel im Kreis herumdreht und hohe Luftsprünge macht, um sich den liebesbedürftigen Hennen bemerkbar zu machen. Die Paradiesvögel entfalten in der Balz ihre prachtvollen, buntfarbigen Schmuckfedern zu einem wallenden Schleier. Der verliebte Pfau schlägt mit seinen verlängerten, farbenprächtigen Rückenfedern ein Rad.
Bei den Vögeln sind die Männchen vor den Weibchen besonders von der Natur ausgezeichnet worden. Sie allein besitzen ein buntfarbiges. Hochzeitskleid, während das weibliche Geschlecht mit wenigen Ausnahmen ein unscheinbares Gewand trägt, das das Tier beim Brutgeschäft und bei der Führung der Kinderschar vor den Nachstellungen der Feinde schützt.
Eine Ausnahme machen die in Südeuropa und Asien heimischen Laufhühnchen, kleine etwa stargrosse Hühner. Bei ihnen ist das Männchen schlicht erdfarben gezeichnet, während das Weibchen mit einem buntfarbigen Brustschild geschmückt ist. Mit diesem eigentümlichen Geschlechtsdimorphismus steht auch das Liebesleben, das geradezu pervers verläuft, im Einklang. Nicht die Männchen, sondern die buntfarbigen Weibchen balzen und fordern ihre unscheinbar gekleideten Liebhaber zur Paarung auf. Nicht das Weibchen, sondern das Männchen baut das Nest und brütet die vom Weibchen hineingelegten Eier aus, das sich um seine Nachkommenschaft überhaupt nicht kümmert. Unter Führung des Vaters wachsen die Jungen heran. Bei den Laufhühnchen sind also die Rollen im Fortpflanzungsgeschäft vertauscht. Die Männchen übernehmen alle Pflichten der Weibchen, die sich völlig emanzipiert haben und die Rolle des männlichen Geschlechts spielen. —
Ein sonderbarer Gesell in Sachen der Liebe ist auch unser Kreuzschnabel, eine der charakteristischsten Erscheinungen unserer Nadelwälder. Dieser Zigeunervogel, der keine feste Wohnstätte kennt, sondern im Lande umherschweift, tritt bald hier, bald da in kleineren oder grösseren Trupps auf. So unstet wie sein Leben, sind auch seine Liebesgelüste. Während alle anderen Vögel bei uns im Frühjahr und Sommer zur Fortpflanzung schreiten, hält er sich an keine bestimmte Jahreszeit. Er brütet ebensogut wie im Sommer auch im Herbst und Winter. Tragen die Nadelhölzer reiche Zapfen, dann erwacht in dem bunten Schelm die Sehnsucht der Liebe. Vom Schneebedeckten Tannenzweig singt er fröhlich sein bescheidenes Lied der Liebsten ins Herz, baut sein Nest in rauhreifumsponnenen Zweigen und brütet in der Winterkälte sein Gelege aus. Während alle anderen Vögel in Schnee und Eis darben, zieht er sorglos seine Kinderschar auf, denn der reiche Samen der Nadelhölzer deckt ihm den Tisch.
Eine besondere Eigentümlichkeit des Kreuzschnabels ist der Farbenwechsel seines Gefieders. Nach dem Ablegen des grauen, dunkel gefleckten Jugendkleides erhält das Männchen zunächst ein gelbes oder auch grünes Gefieder, das im zweiten Jahre mit einem roten Federkleid vertauscht wird und im Alter an Schönheit und Reinheit der Farbe immer mehr zunimmt.
Die Zeit der Liebe ist in der Tierwelt keineswegs immer an den Wonnemonat Mai oder den Sommer gebunden. Im Herbst, wenn die Natur abstirbt, der Laubwald sich gelb und rot färbt, dann erwacht im König unserer Wälder, dem edlen Hirsch, die Macht der Liebe. Mit orgelndem Schrei durchzieht der Brunsthirsch den Wald und treibt sich sein Rudel Wild zusammen, um ein Haremsleben zu führen. Aber nicht in Ruhe kann er die Freuden der Liebe geniessen. Geringe Hirsche begleiten ständig den alten Pascha und seinen Harem in der Hoffnung, dass ein günstiger Augenblick auch ihnen einen kurzen Liebesrausch gewährt. Ständig umkreist der Platzhirsch sein Rudel und vertreibt mit dröhnendem Schrei die Beihirsche, die seine Schönen zu verführen drohen und sich gewandt den ernsten Angriffen des Starken zu entziehen wissen.
Eines Morgens schallt aus der Ferne der Brunftschrei eines Rivalen herüber. Der Platzhirsch antwortet mit kräftiger Stimme — eine Warnung für den Nebenbuhler. Doch dieser fühlt sich ebenbürtig. Näher und näher dringt sein Kampfruf herüber. Der Platzhirsch zieht ihm laut schreiend entgegen. Gesenkten Hauptes stehen sich die Recken gegenüber, dann ein lautes Krachen der Geweihe, und es beginnt ein heisser Kampf auf Leben und Tod. Mit fest ineinandergelegten Geweihen sucht jeder den anderen zu Fall zu bringen. Der Kampf wogt hin und her. Da gelingt es dem einen Kämpen, seine starke Augsprosse in die Weichen des Gegners zu bohren. Der Platzhirsch, der rechtmässige Inhaber des Rudels, bricht zusammen. Er ist von seinem Gegner abgekämpft und zu Tode geforkelt. Noch ein lauter, weithin schallender Siegesschrei, und der Gegnertrollt zu dem Mutterwild, um sogleich die Herrschaft zu übernehmen. Die Tiere, wie der Weidmann das weibliche Wild nennt, haben dem Kampf teilnahmlos zugesehen und erkennen ohne weiteres das Recht des Stärkeren an. Sie folgen unbewusst einem Naturgesetz, das durch die Auslese im Kampf ums Dasein dem Stärkeren das Vorrecht gibt, ein hartes und rücksichtsloses Geschick, aber doch ein sehr zweckmässiges Mittel, um die Art in ihrer Kraft und Ursprünglichkeit zu erhalten und sie vor Degeneration zu bewahren. Darum gilt es als weidmännisches Gesetz, die stärksten Hirsche und stärksten Rehböcke niemals frühzeitig im Jahre abzuschiessen, sondern bis zur Brunst leben zu lassen. Nur hierdurch ist eine gute Geweih- und Gehörnbildung gewährleistet. Leider wird gegen diese Regel noch immer sehr gesündigt, wozu der Jagdneid und die Furcht, dass die gute Trophäe von einem anderen Schützen erbeutet werden könnte, meist die Veranlassung geben.
Nicht immer wird von den Hirschen ein Kampf auf Leben und Tod ausgefochten. Dies gehört sogar zu den Ausnahmen, da meist der Schwächere beizeiten freiwillig das Feld räumt.
In der Brunst des Rothirsches liegt eine tiefe Poesie des deutschen Waldes. Die Jagd auf den Brunfthirsch ist die Krone edlen Weidwerks, und nicht mit Unrecht bilden der schreiende Hirsch und sein Kampf mit dem Rivalen das bevorzugte Motiv für den Jagdmaler. Wer den Zauber der hohen Jagd kennt, der weiss die herrlichen Gemälde, die die Künstlerhand eines Kröner, Deiker, Friese, Drathmann oder Wagner schuf, in ihrer Grösse und Gewalt zu würdigen.
Noch später als beim Rotwild erwacht die Liebe in dem ritterlichen Schwarzwild, das erst im Winter in die Rauschzeit eintritt. Auch unter den stärkeren Keilern wird bisweilen ein Liebesduell ausgefochten. Doch vermögen sich die Tiere mit ihren „Gewehren” oder „Gewaff”, wie der Jäger die Hauer des Wildschweins nennt, keinen besonderen Schaden zuzufügen, da die dicke, mit Borsten bekleidete Schwarte einen vorzüglichen Schutz bildet.
Im Gegensatz zum Rot- und Schwarzwild brunstet das Reh schon im Sommer. Das Ritz wird im Mai gesetzt. Die Tragzeit beträgt 9—10 Monate. Das ist für ein so kleines Tier im Vergleich zu anderen Säugetieren eine auffallend lange Zeit. Infolgedessen glaubte man früher, dass die Brunst im Juli und August nur eine Scheinbrunft sei, ein Vorspiel der Liebe ohne ernstliche Folgen, und dass die Befruchtung erst später im November erfolge, da dann die Böcke bisweilen die Ricken wieder treiben.
Diese Auffassung beruht jedoch auf einem Irrtum. Durch anatomische Untersuchung wurde nachgewiesen, dass die Befruchtung bereits im Sommer stattfindet, und dass die Nachbrunft im Winter nur ein aufflackerndes Liebesspiel einiger Böcke ist, bei dem kein Beschlag erfolgt. Das im Sommer befruchtete Ei macht zunächst nur den ersten Furchungsprozess durch, wandert dann in den Uterus und ruht hier lange Zeit ohne weitere Entwicklung, die erst im Dezember einsetzt und dann in der normalen Weise verläuft. Dieser eigenartige Vorgang in der Fortpflanzungsgeschichte des Rehes ist eine vorzügliche Anpassung an die klimatischen Verhältnisse. Im Sommer, wo bei reicher Äsung Bock und Ricke auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen Kraft stehen, erfolgt die Paarung, und das Kitz wird erst zu Beginn des nächsten Sommers gesetzt, wo das friche Grün der säugenden Ricke wieder kräftige Nahrung spendet.
Ähnlich verhält es sich mit der Fortpflanzung der Fledermäuse. Die Paarung findet im Herbst vor Beginn des Winterschlafes statt. Der Same des Männchens ruht in der Gebärmutter des Weibchens während des Winters und befruchtet erst im Frühjahr die am Eierstock sich bildenden Eier. Im Mai und Juni werden die Jungen geboren, also in einer für ihre Entwicklung sehr günstigen Jahreszeit. Während des Gebäraktes hängt sich die Mutter nicht wie bei der üblichen Ruhestellung mit den Hinterfüssen auf, sondern mit den Händen, so dass also nicht der Kopf, sondern der Leib nach unten gerichtet ist. Dann krümmt sie den Schwanz nach oben, so dass das Ende der Flughaut einen Sack bildet, in den das Junge hineinfällt. Einige Arten legen während der Geburt den Schwanz auf den Rücken, so dass sich keine Geburtstasche bilden kann. Sie haben am Ausgang der Schamteile zwei Drüsen, an die sich das Junge noch während der Geburt ansaugt, um nicht herabzufallen. Später kriechen die Jungen von den Drüsen oder aus der Geburtstasche zur Brust der Alten herauf und saugen sich an den Zitzen fest. Sie verharren aber nicht dauernd in dieser Stellung, sondern haken sich auch mit den Krallen im Pelz der Mutter ein, die sie ständig mit sich umherträgt.
Das zoologisch interessanteste Gebiet der ganzen Erde ist Australien. Mit Ausnahme eines Wildhundes, des Dingos, einiger Fledermäuse und Ratten stehen alle Säugetiere Australiens noch auf einer primitiven Stufe der Entwicklung, die in der Art der Fortpflanzung zum Ausdruck kommt und sie von allen anderen Säugetieren scharf trennt.
Im Jahre 1884 machte der Jenenser Zoologe Wilhelm Haacke während seines Aufenthalts in Australien eine aufsehenerregende Entdeckung. Er zog aus der Hautfalte am Leibe eines Ameisenigels (Abbildung 3) ein Ei hervor. Ein eierlegendes Säugetier! Wohl hatte man schon in früherer Zeit die Behauptung aufgestellt, dass die Schnabeltiere, zu denen der Ameisenigel gehört, Eier legen. Aber die Nachricht klang doch zu märchenhaft, um ernst genommen zu werden, bis es schliesslich Haacke gelang, ihre Wahrheit nachzuweisen.
Die Schnabeltiere tragen einen Hornüberzug über die Kiefer, die hierdurch wie beim Vogel zu einem Schnabel werden. Bei den aus mehreren Arten bestehenden Ameisenigeln ist der zahnlose Schnabel lang und dünn, beim eigentlichen Schnabeltier das gegen flach und breit wie ein Entenschnabel (Abbildung 4). Letzteres ist ein ausgesprochenes Wassertier, das nach Art der Enten mit dem breiten Schnabel auf dem Grunde des Wassers seine aus Insekten und Würmern bestehende Nahrung aufschnabelt. Das Schnabeltier ist ein vortrefflicher Schwimmer, da seine Zehen mit Schwimmhäuten ausgerüstet sind. Es baut sich unterirdische Wohnungen am Ufer, in denen es den Tag schlafend verbringt.
Im Gegensatz zum Schnabeltier sind die Ameisenigel Landtiere. Ihre Hauptnahrung bilden Ameisen, die sie mit ihrer langen Zunge aus Ameisenhaufen herausholen. Der Rücken des Ameisenigels ist mit Stacheln bedeckt, während das Schnabeltier einen dunkelbraunen Pelz trägt.
Das eigenartige Fortpflanzungsgeschäft dieser absonderlichen Tierformen verläuft in folgender Weise. Das Weibchen legt ein oder auch zwei Eier und schiebt sie mit dem Schnabel in die am Leibe befindliche Bruttasche. Die Schale des Eies ist lederartig wie die Schale der Reptilieneier. Im Brutbeutel nimmt das Ei mit der Entwicklung des Keimlings ganz beträchtlich an Grösse zu, indem es sich ausdehnt. Während die Länge eines dem Uterus entnommenen Eies im Durchmesser nur 4,5 mm beträgt, hat das reife Beutelei eine Länge von 15 mm. Dieses Wachstum des Eies steht also ganz im Gegensatz zum Vogelei, das seine Grösse nicht verändert, und entspricht dem Vorgang des Säugetiereies und Embryos im Mutterleibe, nur dass die Entwicklung sich nicht im Uterus, sondern ausserhalb des Körpers vollzieht. Es ist daher möglich, dass eine Ernährung des Eies im Beutel durch Drüsenausscheidung aus dem Körper der Mutter stattfindet, indem das Sekret durch die weiche Schale aufgesogen wird.
Das gänzlich hilflose, embryonenhafte Junge, das beim Ameisenigel nur eine Körperlänge von 5,5 mm hat, macht seine weitere Entwicklung im Beutel durch, den es erst verlässt, wenn es behaart ist und die Stacheln durchbrechen. Es wird dann von der Mutter in einer Erdhöhle untergebracht und nur zum Nähren wieder in den Beutel genommen.
Der alte Ameisenigel hat kein Gesäuge, sondern es wird ein Sekret aus Drüsen abgesondert, das von dem Jungen im Beutel aufgeleckt wird. So sehen wir beim Ameisenigel und Schnabeltier die ersten Anfänge des Säugetiers, aus denen sich erst später das vollkommene Säugetier, das lebendige Junge zur Welt bringt und diese säugt, entwickelt hat.
Auch sonst zeigt der Körperbau der Schnabeltiere noch manche Eigenarten, die im Vergleich zu anderen Säugetieren eine viel primitivere Entwicklung erkennen lassen. Ebenso, wie bei den Reptilien und Vögeln, münden Darm, Harnleiter und Fortpflanzungsorgane in einem einheitlichen Ausgang, der Kloake. Man bezeichnet daher Ameisenigel und Schnabeltier als „Kloakentiere”. Von den Eierstöcken des Weibchens bringt nur der linke reife Eier hervor, während der rechte zwar Eier bildet, die aber niemals zur Entwicklung gelangen. Die Tätigkeit des weiblichen Geschlechtsapparats ist also ganz auf die linke Hälfte beschränkt. Hierin tritt eine nahe Beziehung zu den Vögeln hervor, deren Weibchen nur einen Eierstock auf der linken Seite haben. Bei den männlichen Kloakentieren liegen die Hoden nicht aussen, sondern im Innern der Leibeshöhle, was durchaus dem Geschlechtsapparat der männlichen Vögel und Reptilien entspricht. Das an der hinteren Kloakenwand liegende Zeugungsglied dient lediglich der Samenentleerung, aber nicht wie bei anderen Säugetieren der gleichzeitigen Urinentleerung. Dasselbe ist auch bei jenen Vögeln der Fall, welche, wie Strausse und Enten, einen Penis besitzen.
Das Gehirn der Kloakentiere unterscheidet sich wesentlich von dem Gehirn aller anderen Säuger und zeigt nahe Beziehungen zum Reptiliengehirn.
Die übrigen Säugetiere Australiens haben im Vergleich zu den Schnabeltieren schon eine höhere Entwicklungsstufe erreicht, die aber noch immer gering ist gegenüber allen anderen Säugetieren. Wohl gibt es in Australien die verschiedenartigsten Formen von Säugetieren, die unverkennbar den Charakter des Raubtiers, Nagetiers, Insekten- und Pflanzenfressers tragen, aber dennoch durch eine weite Kluft von diesen getrennt sind. Ihre Jungen kommen in einem ganz unentwickelten, völlig embryonenhaften Zustande zur Welt und werden wie bei den Kloakentieren noch längere Zeit in einem Brutbeutel getragen, in dem sie erst heranreifen. In dem Brutbeutel saugt sich das winzig kleine Junge, das beim Riesenkänguruh nur wenige Zentimeter lang ist, an die Zitze der Mutter fest. Die Mundränder des Jungen verwachsen um die Zitze, welche anschwillt und das ganze Maul des Jungen ausfüllt. Das Junge hängt dann dauernd fest an der Zitze. Um eine ausreichende Atmung zu ermöglichen, schiebt sich der Kehlkopf des Jungen in die innere Nasenöffnung hinein. Diese besonderen Vorrichtungen am Maul und an den Atmungsorganen verlieren sich später, wenn sie infolge des vorgeschrittenen Wachstums des Jungen nicht mehr erforderlich sind. Man kann also geradezu von einem „Larvenstadium” bei den Beuteltieren sprechen, das der Larvenform der Amphibien und niederen Tiere ähnlich ist. Die Jungen verlassen den Beutel erst, wenn sie völlig entwickelt sind, was beim Riesenkänguruh etwa 8 Monate dauert, kehren aber zum Saugen noch einige Zeit lang regelmässig wieder in den Beutel zurück. Das junge Beuteltier wird gewissermassen zweimal geboren, das erstemal, wenn es dem Mutterleibe entsteigt, und das zweitemal, wenn es den Brutbeutel verlässt.
Das bekannteste Beuteltier ist das Känguruh, und jeder aufmerksame Besucher eines Zoologischen Gartens hat wohl schon einmal die Freude gehabt, ein junges Känguruh aus dem Beutel der umherspringenden Mutter herausschauen zu sehen. Ausserdem gibt es Beutelwölfe, Beutelmarder, Beuteldachse, Beutelratten, Beutelspitzmäuse, Beuteleichhörnchen und Flugbeutler (Abbildung 5). Wir setzen also, dass ein grosser Teil der Säugetiere in Australien in Form des Beuteltiers vorkommt, d. h. in einer ursprünglicheren Gestalt, in einer primitiveren Stufe der Entwicklung. Dass tatsächlich eine gewisse Beziehung zwischen den Beuteltieren Australiens und den entsprechenden Tierformen anderer Erdteile besteht, beweist die Feststellung des Gekehrten Hans Friedenthal, dass der Bau der Haare beider Tierformen der gleiche ist. Eine Beutelspitzmaus hat Spitzmaushaar, und der Beutelmaulwurf trägt Maulwurfsfell. Wohl nicht mit Unrecht hat man daher angenommen, dass die Säugetierwelt Australiens mit ihren eierlegenden Arten und mit den Beuteltieren in dem abgeschlossenen Erdteil auf einer früheren Entwicklungsstufe stehengeblieben ist. Australien ist das Land der „lebenden Fossilien”.
Die einzigen Tiere, die als vollwertige Säuger aus der Reihe der Beuteltiere heraustreten, sind der Dingo, einige Fledermäuse und Ratten. Der Dingo ist zugleich die einzige in der Wildnis vorkommende Hunderasse. Er ist nicht wie Wolf, Schakal oder Fuchs ein naher Verwandter des Hundes, sondern ein echter Hund. Seine Farbe ist rot oder rot mit Schwarz und Weiss gemischt. Der Schwanz ist buschig und hat eine helle Spitze. Ob der Dingo wirklich ein ursprünglicher Wildhund ist, oder ob er, was wahrscheinlicher ist, vom Haushund abstammt, der erst vom Menschen nach Australien verpflanzt wurde und verwilderte, ist heute eine noch ungeklärte Frage. Den Aufschluss hierüber kann uns allein die Paläontologie geben. Freilich glaubt Frederick McCoy in der mittleren Tertiärschicht Australiens Reste des Dingo nachweisen zu können — eine Annahme, die freilich noch der Bestätigung bedarf. Erweist sie sich als richtig, dann ist der Dingo als Wildhund zu betrachten, denn dass er in der Tertiärzeit schon vom Menschen eingeführt sein sollte, ist kaum glaubhaft, zumal der tertiäre Mensch noch nicht nachgewiesen ist und, falls er gelebt hat, wohl noch keine Haustiere besessen hat.
Neben dem Dingo leben in Australien noch einige Fledermäuse und Ratten, die nicht Beuteltiere sind. Letztere sind jedenfalls erst später durch Schiffe eingeschleppt worden, und die Fledermäuse können infolge ihres Flugvermögens sich unschwer verbreiten. Ratten und Fledermäuse sind offenbar keine Schöpfungen der australischen Tierwelt, sondern erst später hierher gelangt.
–––––––––––