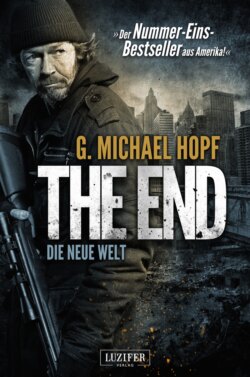Читать книгу THE END - DIE NEUE WELT - G. Michael Hopf - Страница 10
San Diego, Kalifornien
Оглавление»Rosa oder Rot?«, fragte Gordons fünfjährige Tochter, wobei sie ihm zwei unterschiedliche Fläschchen Nagellack vorhielt.
»Ich mag Rot, aber Rosa ist mir lieber«, antwortete er und sah Haley dabei zu, wie sie die Behälter schüttelte.
»Krieg ich etwas zum Naschen, wenn wir fertig sind, Daddy?«, bohrte die Kleine weiter, während sie Gordon sorgfältig die Fingernägel lackierte.
»Ja, sicher. Was schwebt dir vor?«, entgegnete er mit sanfter Stimme.
»Was Süßes. Ich möchte Fruchtgummi und dann Octanauten schauen!«, quietschte Haley und blickte zu ihm auf. Sie strahlte ihn an und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht.
»Also gut, du bekommst einen Streifen Fruchtgummi«, sagte er und erwiderte ihr Lächeln.
Das Kind war klein für sein Alter und sah aus, wie man sich ein Mädchen vorstellte: lange blonde Locken und äußerst zarte Gesichtszüge. Haley benahm sich auch dementsprechend und liebte alles, was mit Prinzessinnen zu tun hatte.
Gordon ließ nichts über seine Familie kommen und hielt seine beiden Kinder für einen Segen. Hunter, sein siebenjähriger Sohn, und Haley waren sein ganzer Stolz und Sonnenschein. Sein Leben drehte sich gänzlich um sie und seine Ehefrau Samantha.
Die beiden hatten einander ungefähr ein Jahr, nachdem er die Marines unehrenhaft verlassen musste, kennengelernt. Ein weiteres Jahr später heirateten sie, und im darauffolgenden kam Hunter zur Welt.
Er schätzte sich glücklich und sicher, lebte jeden Tag im Hier und Jetzt. An seine Zeit im Korps dachte er nicht allzu oft zurück, und falls doch, so kam es ihm vor, als gehöre sie nicht zu seiner Vita, sondern der eines anderen.
Obwohl sein Kriegsdienst meistens außen vor blieb, schlugen sich seine beiden Stationierungen im Osten im Alltag nieder. Die Erfahrung verschob seine Prioritäten und änderte seine Sichtweise. Er hörte auf, ein Idealist zu sein, der davon überzeugt war, jedermann helfen zu müssen, und handelte eher pragmatisch, wobei er vor allem für seine Familie sorgen wollte. Die Zeit der Aufopferung für jene, die er nun als Ahnungslose bezeichnete, war vorbei.
»Kommst du nach deinem Termin im Schönheitssalon raus zu mir?«, bat Samantha ihren Mann im Vorbeigehen an der Tür auf ihrem Weg in die Küche.
Gordon blickte ihr über seine Schulter nach. »Okay, aber bist du sicher, dass du nicht auch ein bisschen Hand- und Fußpflege vertragen kannst?«
Samantha antwortete bereits aus der Küche: »Später vielleicht. Haley braucht ein wenig Ruhe, und uns beiden steht etwas Erwachsenenzeit zu.«
»Erwachsenenzeit?«, rief Gordon zurück. »Meinst du das so, wie ich es auffasse, oder im Sinn von Zeit, um etwas zu diskutieren, was meine volle Aufmerksamkeit erfordert?« Dabei beobachtete er, wie Haley die letzten Pinselstriche seiner Maniküre machte.
»Das erfährst du dann«, kam die Antwort aus der Küche.
»Du hast es wirklich faustdick hinter den Ohren«, gab er zurück.
»Was bedeutet das, faustdick hinter den Ohren?«, fragte Haley.
»Also Mäuschen, das ist, wenn …«
»Haley, das bedeutet, dass jemand ganz toll Witze machen kann«, unterbrach Samantha, die auf einmal im Türrahmen des Kinderzimmers stand.
Gordon verrenkte sich den Hals. »Meine Güte, du schleichst aber herum …« Er zwinkerte ihr zu, wobei er ihren leicht gereizten Blick zur Kenntnis nahm.
Samantha stand da und betrachtete ihren Mann. Sie liebte ihn über alle Maßen. Er war ein guter Vater für ihre beiden Kinder. Viele Kerle, die es über sich ergehen ließen, dass man ihre Fingernägel rosa lackierte, fielen ihr nicht ein. Sie war stolz auf sein Interesse an seinen Kindern und sah mit Freude, wie wichtig sie für ihn waren.
Ihre Bewunderung für Gordon war übergroß. Er entsprach ihrem Idealbild von einem Mann: groß und in seiner rauen Art attraktiv, nicht zuletzt wegen des kantigen Kinns, seiner hellen Augen und breiten Schultern. Neben ihm wirkte Haley so klein, so winzig im Vergleich zu seiner kräftigen, muskulösen Statur. Sie hatte sofort bei ihrer ersten Begegnung gewusst, dass er sie stets behüten würde. Bei ihm fühlte sie sich sicher.
»Fertig, Daddy! Kriege ich jetzt meine Belohnung?«, flötete Haley, als sie den Nagellack zuschraubte.
»Natürlich«, bestätigte er, bevor er sich anschickte, seine Finger trocken zu pusten. Als er jedoch bemerkte, dass Samantha ihn immer noch anstarrte, hielt er inne. Er schaute zu ihr auf und fragte scherzhaft: »Betont das Rosa meine blauen Augen?«
Haley sprang auf und lief aus dem Zimmer über den Flur zur Küche. Gordon schlenderte hinterher, jedoch achtsam aufgrund des feuchten Lacks auf seinen Nägeln.
»Sag schon, was ist los?«, drängte er seine Frau, bevor er sich nach vorne beugte, um ihr einen Kuss auf den Mund zu geben.
»Lass mich Haley für ihr Schläfchen fertig machen, dann treffen wir uns auf der Terrasse – sagen wir, in fünf Minuten?« Damit erwiderte sie seinen Kuss.
Gordon hatte sich auf der Terrasse niedergelassen und wartete auf Samantha. Er lehnte sich zurück, legte die Füße auf den Gartenkaffeetisch und ließ sich das Gesicht von der nachmittäglichen Sonne wärmen. Wenngleich seine Beziehung zu Südkalifornien generell von einer Art Hassliebe geprägt war, hielt er doch große Stücke aufs Wetter. Er bevorzugte Kleinstädte, und als solche konnte man San Diego wahrlich nicht bezeichnen. Alles in allem aber ging es ihnen gut. Er genoss einigen Komfort, wusste einen stattlichen Freundeskreis und eine tolle Familie um sich. Der einzige Verwandte, den er gerne häufiger gesehen hätte, war sein kleiner Bruder Sebastian, der vier Jahre, nachdem Gordon die Armee verlassen hatte, von den Marines rekrutiert worden war. Ursprünglich trat er dabei in die Fußstapfen des Älteren und wurde Panzerabwehrschütze, doch dies fand er zuletzt ein wenig öde. Als abenteuerlustiger Typ begann er gerade eine Laufbahn als Kundschafter-Scharfschütze.
Gordon döste in der Sonne, bis er durch Samanthas Kommen geweckt wurde. Als er die Augen öffnete, blickte sie von oben auf ihn herab.
»Dir geht es gut, was?«, fragte sie mit verschränkten Armen.
»Aber sicher doch, danke fürs Nachhaken«, erwiderte er grinsend.
»Wann wolltest du dich dazu herablassen, mir zu erzählen, dass uns dein Bruder heute zum Abendessen besucht?«, sagte sie, während sie sich ihm gegenüber setzte. »Du weißt, dass ich so etwas gerne vorab wüsste, damit ich das Haus auf Vordermann bringen kann.«
»Ich dachte, ich hätte es erwähnt, tut mir leid«, entschuldigte er sich und richtete sich etwas auf. »Das ist doch kein Problem, nicht wahr? Wir haben doch sonst nichts vor, oder?«
Nun war er es, der sie betrachtete, wie sie so vor ihm saß. Er war ihr sofort verfallen, als sie sich kennengelernt hatten. Alles an ihr liebte er, angefangen bei ihrer zierlichen Figur und dem langen blonden Haar, das leicht gewellt war, über die hellgrünen Augen bis zu ihren vollen Lippen. Sie gab für ihn das Bild der perfekten Frau ab.
»Nein, geht schon klar, aber beim nächsten Mal möchte ich eingeweiht werden. Hätte ich nicht die Sprachbox abgehört, wär's mir entgangen, also versprich einfach, dass du mir Bescheid gibst, wenn wieder so etwas ansteht.«
Gordon erhob sich und ging zu ihr hinüber. »Versprochen, ehrlich«, versicherte er im sanften Tonfall. Dann beugte er sich nach vorne, um sie fest in den Arm zu nehmen. Er küsste sie und flüsterte in ihr Ohr: »Sollen wir nach oben gehen, damit ich mich richtig entschuldigen kann?«
Samantha entzog sich ein wenig trotzig und gab ihm zu verstehen: »Du weißt doch, dass ich noch einige Dinge zu tun habe.«
»Dinge, die nicht weglaufen«, hielt Gordon dagegen, diesmal mit besonders samtiger Stimme, da er seine Frau nur zu gut kannte. Mit einem Vorschlag verlieh er der Bitte Nachdruck: »Ich helfe dir später bei deinen Dingen, wenn du mir jetzt etwas Gutes tust – was meinst du?«
Samantha zog die Augenbrauen hoch und lächelte diebisch. »Abgemacht.«
Dann nahm sie seine Hand und ging mit ihm nach oben.
»Da ist jemand an der Haustür!«, rief Hunter aufgeregt.
»Mach ruhig auf, das dürfte dein Onkel Sebastian sein«, erwiderte Samantha von der Küche aus. Sie richtete gerade Salat an und konnte nicht öffnen.
»Gordon, ich glaube, dein Bruder ist da«, ließ sie ihren Mann wissen, der in seinem Büro arbeitete. Sie mochte Sebastian sehr gerne, aber seine Besuche waren ihr nicht immer recht. Das lag nicht an ihm, allein seine Anwesenheit führte dazu, dass sich Gordon in den darauffolgenden Tagen anders verhielt. Nach Sebastians Abreise wirkte er für gewöhnlich sehr distanziert.
»Onkel Seb!«, jubelte Hunter, als er die Tür aufzog. Haley und er freuten sich jedes Mal, wenn Sebastian sie besuchte, und amüsierten sich während seines Aufenthalts köstlich.
»Onkel Sebastian, Onkel Sebastian!«, schrillte nun auch Haley, während sie die Treppe herunterhüpfte.
Ihr Gast trat ein und hob den Jungen hoch. Kaum dass das Mädchen unten angelangt war, klammerte es sich an sein Bein.
»Na, ihr zwei? Wie geht es meinem Lieblingsneffen und der besten Nichte, die ich habe?«, fragte Sebastian. Um Haley in den anderen Arm zu nehmen, ging er in die Hocke. Er nahm die zwei mit in die Küche, wo Samantha immer noch emsig das Dinner vorbereitete.
Sebastian war ebenfalls groß, rank und schlank, wie man beim Korps sagte. Gordon und er sahen sich sehr ähnlich; dass sie Brüder waren, daran bestand kein Zweifel. Gegensätze ergaben sich hauptsächlich aus ihrem Altersunterschied von sieben Jahren. Gordon ergraute an den Schläfen und bekam allmählich Geheimratsecken, während Sebastian noch dichtes braunes Haar ohne Silbersträhnen hatte. Er war zwar ein Kriegspferd, aber weder für einen Bürstenschnitt noch für kurze Stoppeln zu haben; vielmehr mochte er sein Haar und achtete darauf, dass es gerade so lang wie erlaubt war oder länger, so er damit durchkam. Sebastian blieb nie um ein Lächeln verlegen und nahm das Leben leichter als sein Bruder, der einen ernsteren, eher stoischen Charakter hatte.
Auch der Jüngere wollte eines Tages Kinder haben, genoss aber bis auf Weiteres das Single-Leben als Marine. Zum Draufgängertum neigte er nach wie vor, und da der Wehrdienst bereits ohne Familie anstrengend genug war, hielt er es für verantwortungslos, eine zu gründen. Vorerst also erfüllte sich Sebastian den Wunsch nach einem gesetzten Lebenswandel so gut es ging in der Familie seines Bruders.
»Hi Samantha!«
»Hallo Sebastian, wie geht es dir?«, grüßte Samantha, die ein wenig aufgelöst wirkte, weil sie fertig werden wollte. Sie war Perfektionistin, weshalb für die Gäste alles makellos aussehen sollte. Zumindest gönnte sie sich ein paar Sekunden, um Sebastian rasch zu herzen und ihm in die Wange zu zwicken. »Gordon ist in seinem Büro und führt ein Projekt zu Ende. Geh nur durch … am Ende des Flurs.«
»Das werde ich wohl.« Er warf einen Blick auf die Kids vor seiner Brust und zog die Augenbrauen hoch. »Zuerst aber wollen die zwei Äffchen in meinen Armen wissen, was ihr Onkel für sie mitgebracht hat.«
Die Kinder quiekten vergnügt: »Geschenke!«
Er ließ sie hinunter und kauerte nieder, um mit ihnen auf Augenhöhe zu sprechen. »Geht raus zum Tisch, darauf liegen zwei Tüten, die grüne ist für Hunter, die pinkfarbene für …«
»Mich!«, würgte Haley ihn ab, als sie schon auf dem Weg zur Haustür war. Auch Hunter ließ sich nicht lange bitten und rannte los.
Sebastian stand wieder auf und trat zur Kücheninsel. »Wow, wie das duftet! Bin ich hungrig.«
»Das will ich schwer hoffen, denn wir haben tonnenweise zu essen, und Gordon ist gerade eben noch losgezogen, um dein Lieblingsfleisch zu besorgen.«
»Ihr zwei seid großartig, danke sehr«, sagte Sebastian und sah Samantha an. Er freute sich darüber, dass sein Bruder eine so tolle Frau gefunden hatte und musste lächeln, als er daran dachte, wie sehr Gordon dieses Leben verdiente, besonders nach allem, was er durchgemacht hatte.
Der Fernseher lief für gewöhnlich, wenn Samantha kochte; diese Zeit war wirklich die Einzige, in der sie dazu kam, die Nachrichten zu verfolgen. Die beiden Kinder waren ein Vollzeitjob, der einen Großteil ihres Tages in Anspruch nahm.
Gerade interviewte Bill O'Reilly Brad Conner, den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses der Republikaner, und die Stellvertreterin der Demokratischen Partei Kaliforniens, Shelly Gomez.
»Dem Präsidenten gelingt es eindeutig nicht, für die Sicherheit in unserem Land zu garantieren. Dem Iran die Herstellung von Kernbrennstoffen zu gestatten und der Regierung dort die Hände zu schütteln, wird uns nicht schützen. Das iranische Regime ist nicht vertrauenswürdig. Wir brauchen …«
»… wir brauchen was, Mr. Conner? Einen weiteren Krieg?«, konterte Gomez.
»Das alles darf nicht vom Tisch kommen. Wir müssen Stärke zeigen, statt an die große Glocke zu hängen, dass wir von Gewaltanwendung absehen.«
»Mr. Conner, Sie sind Befürworter von Erstschlägen. Ziehen Sie in Erwägung, iranische Atomanlagen anzugreifen, falls wir stichhaltige Beweise dafür hätten, dass das Land Kernwaffen baut oder waffenfähigen Brennstoff an Terroristen verkauft?«, fragte O'Reilly.
»Bill, der Iran ist ein Schurkenstaat. Um Ihre Frage also rundheraus zu beantworten: Ja, dazu wäre ich bereit.«
»Ms. Gomez, was sagen Sie dazu?«, fuhr der Moderator rasch fort.
»Mr. O'Reilly, wir dürfen keine Option außer Acht lassen, genauso wenig aber diplomatische Bestrebungen, jedenfalls nicht eher, bis wir sicher sind, alles versucht zu haben, um eine friedliche Lösung zu finden.«
»Also würden auch Sie einen Militärschlag gutheißen?«, fragte O'Reilly plump.
»Ich will damit nur sagen, dass wir uns nicht auf einen einzigen Weg festlegen lassen sollten.«
»Meine Frage verlangt nach einer schlichten Antwort, Ms. Gomez: Ja oder nein?«, stichelte der Mann.
»Mr. O'Reilly, Diplomatie ist zu sehr ein Kräftespiel, als dass ihr ein schnödes Ja oder Nein gerecht würde«, betonte die Sprecherin, die sichtlich wütend war.
»Das verstehe ich, Ms. Gomez, also lassen Sie mich die Frage umformulieren: Wenn Sie alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft haben und über Indizien dafür verfügen, dass der Iran entweder eine Waffe entwickelt, drauf und dran ist, einer einschlägig bekannten Terrorzelle waffenfähigen Brennstoff zum Bau einer schmutzigen Bombe zu verkaufen oder noch schlimmer: einen richtigen Atomsprengkopf – geben Sie dann grünes Licht für eine Militäraktion?«
»Ich finde, Sie sollten genau definieren, was Sie mit dem Ausschöpfen aller diplomatischen Mittel meinen«, wich Gomez aus.
»Wirklich? Im vollen Ernst, Ms. Gomez: Sie können diese Frage nicht beantworten?«, provozierte O'Reilly weiter, wozu er einen leicht pikierten Gesichtsausdruck aufsetzte.
Vorsitzender Conner meldete sich wieder zu Wort: »Ich kann Ihnen eine Antwort geben, Bill. Jawohl, ich würde den Iran angreifen, und zwar mit allen Mitteln. Ms. Gomez weiß um die Bedrohungen, die tatsächliche Gefahr für unser Land. Sie nimmt an den Debatten teil, ist also im Bilde, doch was tun sie und ihre Kollegen? Jedes Mal verwenden sie ihre Stimme dazu, unsere Verteidigungskräfte zu schwächen beziehungsweise legen ihr Veto zur Subventionierung von Projekten ein, die unsere Abwehr stärken könnten.«
»Mr. Conner, nennen Sie uns doch beispielhaft eine der Bedrohungen für unser Land, derer sich die meisten Amerikaner nicht bewusst sind«, verlangte O'Reilly, um endlich auf den Punkt zu kommen.
»Zu meinen schlimmsten Befürchtungen zählt ein Angriff vonseiten eines Schurkenstaates oder einer terroristischen Vereinigung mit Mikrowellen- oder Elektroimpulswaffen. Dagegen sind wir nicht gerüstet; unser gesamtes Stromnetz würde zusammenbrechen. Der Iran hat seinerseits durchblicken lassen, diese Schwäche zu kennen, und möchte sie ausnutzen.«
»Nur zu, Mr. Conner, spielen Sie weiter mit den Ängsten der Menschen«, schalt ihn Gomez verächtlich.
»Ängste? Ms. Gomez, Sie haben die Berichte zu dieser spezifischen Gefahr gesehen. Sogar Mitglieder Ihrer eigenen Partei begreifen die Bedrohung und reichten mutig Gesetzesvorschläge ein, die den Ausschuss jedoch nie verlassen haben. Gegenwärtig dränge ich den Abgeordneten Markey dazu, erneut den gleichen Entwurf vorzulegen. Ich bin gewillt, hart auf eine entscheidende Abstimmung darüber hinzuarbeiten, die er auch verdient hat«, spie Conner mit unverhohlenem Zorn zurück.
»Ms. Gomez, das letzte Wort gebührt Ihnen, bitte gehen Sie auf die Ausführungen des Vorsitzenden ein.«
»Mr. O'Reilly, diese Regierung leistet Unglaubliches, um unser Land zu schützen. Nach nahezu zehn Jahren im Krieg ist es an der Zeit, sich der Innenpolitik zuzuwenden und nationale Probleme anzupacken. Wir haben alles unter Kontrolle, was unsere Wehrhaftigkeit betrifft; jetzt gilt es, Bildungs- und Gesundheitspolitik zum Thema zu machen.«
»Also gut, hier muss ich nun einen Schlusspunkt setzen, Ms. Gomez, Mr. Conner, vielen Dank für Ihre Zeit. Unser nächster Gast wird General McCasey sein, der uns über die jüngsten Terroranschläge in Paris und London aufklärt.«
Samantha griff zur Fernbedienung und schaltete ab. »Tut mir leid, ich habe sonst keine Gelegenheit, mir die Nachrichten anzusehen. Was momentan in der Welt abläuft, ist unheimlich, all diese Angriffe im Ausland … ich habe wirklich das Gefühl, es sei nur eine Frage der Zeit, bis es uns hier trifft.«
»Ja, das könnte passieren, aber ich würde mich deshalb nicht verrückt machen. Wir sind immer noch ziemlich sicher hier, finde ich, und was die Schwätzer in der Glotze angeht: höre ich einfach nicht hin. Für mich klingt das nach ganz viel heißer Luft«, meinte Sebastian.
»Darf ich dir ein Bier anbieten?«
»Ich bediene mich selbst. Weiß ja, wo sie stehen; trinkst du eins mit?«, fragte er beim Öffnen des Kühlschranks.
»Gerne, danke.«
»Hol mir auch eins raus!« Das war die Stimme seines Bruders, der über beide Ohren grinste, als er die Küche betrat. Er geriet immer ganz aus dem Häuschen, wenn der Jüngere zu Besuch kam.
»Gordo!«, rief Sebastian und stellte die Biere auf die Arbeitsfläche, um seinem Bruder entgegenzugehen und ihn kraftvoll zu umarmen. »Schön, dich zu sehen, danke für die Einladung.«
»Versteht sich von selbst, junger Mann. Ginge es nach uns, würdest du häufiger hier sein.«
Gordon drehte sich zu Samantha um und fragte: »Wo sind die Kinder?«
»Draußen. Sebastian hat ihnen Spielzeug mitgebracht.«
»Sag bloß … was gibt’s neues bei dir?«, drängte er nach einem Schluck Bier.
»Schätze, das sollte ich dich fragen«, entgegnete Sebastian, indem er auf Gordons Finger zeigte. »Falls du den Dienst wegen der Sittengesetze in der Armee quittiert hast, darfst du jetzt wohl mit offenen Karten spielen.«
»Was?« Gordon wusste zuerst nichts mit der Andeutung anzufangen, doch dann fiel ihm ein, dass seine Fingernägel immer noch rosa lackiert waren.
»War die Kleine«, erklärte er mit einem Achselzucken.
Dann ging er zum Kühlschrank und nahm das Grillfleisch heraus. »Hör mal, Mr. Klugscheißer: Was dagegen, mit etwas von dem hier abzunehmen?«
»Roger.«
»Das war erste Sahne. Ich bin pappsatt«, sagte Sebastian, als er sich im Gartensessel zurücklehnte.
»Schön, dass es dir geschmeckt hat. Ich würde sagen, ich räume auf, während ihr Männer ein Bier zischt und etwas plaudert«, schlug Samantha vor, als sie die Teller stapelte.
»Wenn dir das nichts ausmacht«, erwiderte Gordon und sah zu ihr auf. Er zollte Samantha Respekt und erachtete Beziehungspflege wie Elternaufgaben als wirkliche Partnerarbeit. Niemals hätte er seine Frau für selbstverständlich gehalten.
»Nein, macht es nicht. Macht einfach, was große Jungs so tun: Trinkt Bier, schwingt Reden und löst globale Probleme. Ich kann die Kinder auch mit nach oben nehmen und einen Film anschauen.« Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Hab dich lieb, Großer.«
»Ich dich auch, Schatz.«
Sebastian lächelte über ihren Umgang miteinander. Sobald er die Zeit für reif hielt, sich häuslich niederzulassen, wollte er exakt das Gleiche wie sein Bruder. Natürlich würde dieser Moment noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, da seine Verpflichtung noch ein weiteres Jahr andauerte und das Lotterleben einfach zu viel Spaß machte.
Samantha trug das restliche Geschirr zusammen und kehrte in die Küche zurück. Die Brüder hörten, wie sie mit den Kids sprach. Nach einer Minute Kreischen und Johlen der Kleinen wurde es still im Haus.
»Komm, wir nehmen die übrigen Biere und ziehen auf die Terrasse hinterm Haus um.« Gordon stand auf und Sebastian folgte ihm zum Kühlschrank, ehe sie in den Garten gingen.
»Hier.« Gordon reichte seinem Bruder eine kalte Flasche und ließ sich nieder.
»Danke. Jetzt kannst du erzählen, was du in letzter Zeit so getrieben hast?«
»Ach, das Übliche – und seit Kurzem gehe ich häufiger zum Schießstand.«
»Gut, hast du dir was Neues zugelegt?«
»Ja, auf einer Waffenmesse in Idaho fand ich eine M4 und eine zweite Sig.«
»Du warst schon immer eher ein Sammler als ich. In der Hinsicht siehst du Dad ähnlich«, bemerkte Sebastian und nippte an seinem Bier.
»Jetzt erzähl du mir was über die Kundschafter-Scharfschützen«, bat Gordon, als er die Füße hochlegte.
»Ich will wirklich dort unterkommen. In ein paar Wochen werde ich es versuchen. Habe dafür trainiert, also mal sehen.«
»Solange du weißt, was du tust«, sagte Gordon und senkte den Blick auf die Flasche in seiner Hand.
»Was soll das heißen?«, hakte sein Bruder mit hochgezogener Augenbraue nach.
»Nichts weiter.«
»Hör zu, lass deinen Groll gegen das Korps nicht an mir aus«, stellte Sebastian leicht pikiert klar.
»Ich hege keinen Groll, sondern möchte mich nur vergewissern, dass du die richtige Entscheidung triffst. Davon konnte meiner Meinung nach nämlich keine Rede sein, als du dich gleich für sechs Jahre verpflichtet hast«, erwiderte Gordon. »Vier hätten auch genügt, um dann zu verlängern, falls es nach deinem Geschmack gewesen wäre.«
Sebastian starrte den Bruder ungehalten und enttäuscht an. So sehr er ihn wertschätzte, war ihm aufs Äußerste zuwider, wenn sich Gordon wie sein Erziehungsberechtigter aufführte. Er hatte eigentlich geglaubt, sein Bruder werde ihm vor dem Hintergrund zweier Auslandsaufenthalte – einmal im Irak und später in Afghanistan – endlich Hochachtung entgegenbringen. Dass dem nicht so war, lag an zwei Faktoren, wie er wusste: Erstens waren die Eltern der beiden vor wenigen Jahren gestorben, weshalb es sich Gordon zur Aufgabe gemacht hatte, den Vater für den Jüngeren zu spielen. Das andere Problem bestand in Gordons Wut auf das Marinekorps. Er fühlte sich nach jenem Vorfall in Falludscha vor zehn Jahren verraten.
»Gordo, ich weiß, was ich tue. Die Kundschafter-Scharfschützen sind eine straff organisierte Einheit, professionell und motiviert. Ich wünschte, du würdest aufhören, mein Tun in Zweifel zu ziehen. Sicher, du hast mich gebeten, nicht zur Marine zu gehen, doch ich ließ mich trotzdem rekrutieren, und dann warst du dagegen, dass ich sechs Jahre lang diene, aber auch das war mir egal. Ich musste mir Klarheit darüber verschaffen, welchen Job ich wollte. Erst hast du dich dagegen gesträubt, dass ich Panzerabwehrschütze wurde, und jetzt hinterfragst du diese Stellung. Ich bin erwachsen und kann selbst entscheiden.« Sebastian richtete sich auf und suchte den Blick seines Bruders.
»Ist ja schon gut«, beschwichtigte Gordon, fuchtelte mit dem linken Arm und verdrehte die Augen.
»Ich muss mal für kleine Rekruten.« Sebastian stellte seine Flasche ab und ging ins Haus.
Gordon legte seinen Kopf gegen die Nackenstütze des Sessels und sah hinauf zu den Sternen. Seine Gedanken schweiften zurück zu jenem Tag in der Moschee in Falludscha. In den Jahren darauf war ihm der Vorfall immer wieder durch den Kopf gegangen, doch jedes Mal kam er zu dem Schluss, er würde es genau so wieder tun. Die Häme und der Hass, welchen man ihm entgegenbrachte, frustrierten ihn zutiefst.
Die Untersuchungen der Militärstrafverfolgungsbehörde der Marine zeigten, dass er die korrekte Entscheidung getroffen hatte, doch solche Wendungen waren nicht interessant und landeten stets auf den hinteren Seiten der Zeitungen. Eine Story über Marines hingegen, die unbewaffnete und verwundete Gefangene erschießen, sorgte für Schlagzeilen und politischen Zündstoff. Politik verachtete er am meisten. In ihrer Gesamtheit veränderte die Situation seine Ansichten zu Volk und Vaterland. Als er die Option erhielt, seinen Dienst zu verlängern, nahm er sie nicht wahr. Er konnte sein Leben nicht mehr zur Verteidigung eines Landes aufs Spiel setzen, dessen halbe Bevölkerung ihn entweder hasste oder sich – was nur geringfügig besser war – überhaupt keine Meinung zu ihm bildete.
Gordon hatte sich der Marine gleich nach den Anschlägen vom 11. September 2001 angeschlossen. Dazu brach er sein Studium an der Universität George Mason im dritten Jahr ab und schlug somit ein Vollstipendium aus, weil er glaubte, es obliege seiner Generation, ihrem Land an erster Front zu dienen. Damals erschien es ihm richtig, doch mittlerweile war die Lage eine andere.
Oft fragte er sich, warum er so viele Opfer gebracht hatte. Warum? Damit die Leute einen Grund dafür fanden, ihn zu hassen? Ihre Freiheit für selbstverständlich halten konnten? Um all den faulen Ärschen und Nichtsnutzen zu ermöglichen, dazusitzen und die Hände in den Schoß zu legen? Scheiß auf sie, dachte er. Nie wieder würde er den Kopf für jemand anderen außer seinen Verwandten und Freunden hinhalten. Jetzt begab sich indes sein Bruder in die Schusslinie, auf dass die gleichen wertlosen Menschen Federn in die Luft blasen durften, ihre Freiheit auskosteten und ihre Rechte missbrauchten.
Sebastian konnte Gordons Gefühle nachvollziehen, war aber im Gegensatz zu ihm kein sonderlicher Idealist. Sicher, er liebte sein Vaterland, doch dies vor allem wegen seiner Abenteuerlust: Ihm ging es um die Action. Sebastian war begeistert davon, dass er dafür bezahlt wurde, Dinge in die Luft zu sprengen. Über Politik machte er sich nicht viele Gedanken, weil er sie für Zeitverschwendung hielt. Gordon hätte gern die gleiche Haltung angenommen, aber wie sollte ein Land auf Dauer bestehen, wenn jeder nur sich selbst der Nächste war? Er steckte in einer ideologischen Zwickmühle, während er – was das praktische Handeln anbelangte – niemand anderen zwischen sich und seine Familie kommen ließ, solange sein Ärger nicht abgeklungen war.
Er wurde von seinem Gedankengang abgebracht, als Sebastian von der Toilette zurückkehrte.
»Hier, Bruderherz.« Sebastian drückte ihm ein neues Bier in die Hand.
Gordon richtete sich im Sessel auf und bedankte sich. »Hör mal, es tut mir leid, wenn es so wirkte, als würde ich dir nicht vertrauen. Ich halte sehr viel von dir und sehe in dir nichts weniger als einen erwachsenen Mann. Du weißt, was ich übers Korps und alles andere denke, was damit zusammenhängt. Ich will wirklich nicht wieder dort hineingezogen werden – und schon gar nicht, dass dir etwas zustößt.«
»Schon verstanden, aber sei dir gewiss: Ich befinde mich in guten Händen. Übrigens habe ich ganz vergessen, dir zu sagen, dass es einen neuen befehlshabenden Offizier gibt«, schob Sebastian mit einem Strahlen im Gesicht hinterher, nachdem er etwas Bier getrunken hatte.
Gordon wurde hellhörig. »Wer ist es?«
»Barone!«
»Major Barone?« Er machte große Augen.
»Ja, aber er ist mittlerweile Oberstleutnant.«
Wieder ließ sich Gordon zurück in die Vergangenheit kurz nach dem Einsatz in Falludscha reißen. Major Barone war einer seiner verbissensten Verteidiger gewesen. Er stand ihm bei, während alle anderen hochrangigen Militärs den Politikern und Medien gefällig sein wollten. Die Presse schlachtete die Story nach allen Regeln der Kunst aus und berichtete auf reißerische Art über den gefallenen Schuss. In der Öffentlichkeit galt er praktisch als verurteilt, noch ehe die Nachforschungen zu Ende gingen.
»Das sind tolle Neuigkeiten«, fand Gordon im Zuge dieser tröstlichen Erinnerung an einen treuen Freund. »Er ist ein großartiger Mann, und bei ihm befindest du dich definitiv in guten Händen.«
»Ich dachte mir schon, du würdest dich freuen, seinen Namen wieder zu hören. Bislang hatte ich noch keine Gelegenheit, ihn persönlich zu treffen, aber es heißt, er habe eine besondere Vorliebe für Scharfschützen. Ich bin schon ganz aufgeregt; jetzt muss ich nur noch aufgenommen werden.«
»Ich bin ausgesprochen froh darüber, dass er jetzt das Kommando hat und euch Jungs für den nächsten Auslandseinsatz in Erwägung zieht.«
Gordon empfand Erleichterung darüber, dass sein Bruder in so vertrauenswürdige Gesellschaft geraten sollte. Dieses Wissen machte ihn glücklich. Sein Bruder mochte noch so viel Selbstbewusstsein hervorkehren: Gordon würde sich immerzu um ihn sorgen und ihn im Auge behalten.
Was ihm außerdem Kummer bereitete, waren die gehäuft auftretenden Übergriffe von Terroristen auf Militäreinrichtungen rund um den Globus. Ferner verzeichneten seit den vergangenen paar Monaten auch die Anschläge gegen zivile Ziele in Europa einen Aufwärtstrend. Er hatte sich schon oft mit Samantha darüber unterhalten, wie seltsam es war, dass diese Organisationen solche Angriffe bisher nie in den Vereinigten Staaten gewagt hatten. In Anbetracht der arg durchlässigen Südgrenze des Landes hielt er diesen Glücksfall jedoch für zeitlich begrenzt. Über kurz oder lang, das war ihm klar, würden die Terroristen erneut hier zuschlagen, und die nächste größere Aktion könnte so verheerend sein, dass sie die Nation in die Knie zwänge.
Gordon verdrängte das Bild der grausamen Weltbühne und widmete sich wieder seinem Vorsatz, eine angenehme Zeit mit seinem Bruder zu verbringen. Noch einige Biere mehr, etwas Gelächter und ein bisschen Schwelgen in Erinnerungen, dann verabschiedeten sich die beiden voneinander.
Nachdem er Sebastian bis zur Haustür begleitet hatte, drückte Gordon ihn an sich und sagte: »Falls du je irgendetwas brauchen solltest, zögere nicht, mich anzurufen. Wir sind immer für dich da.«
»Das werde ich, Gordo. Bist der Beste, mein Bruder.« Sebastian fühlte sich stets unwohl, wenn er aufbrechen musste. Er hasste dieses Lebewohl-Gehabe.
Als er schon über den Bürgersteig ging, rief Gordon hinterher: »Bleib auf Zack, Marine!«