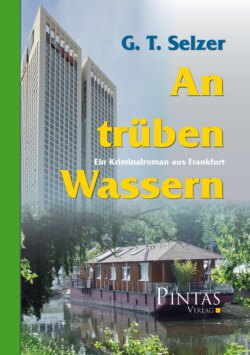Читать книгу An trüben Wassern - G. T. Selzer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sechs Jahre zuvor
ОглавлениеEs war ein trüber, nass-kalter Dienstagnachmittag im Januar. Kathrin Skipanski stand ungeduldig auf der untersten Treppenstufe und rief ins erste Stockwerk hinauf, wo ihre Mutter in ihrem kleinen Arbeitszimmer saß und telefonierte.
„Mama! Nun komm doch endlich!“ Sie schaute auf die große Standuhr, die in der Diele stand. „Schon zehn vor! Ich komme zu spät!“
Marion Skipanski sagte hastig: „Na tschüss dann, bis heute Abend – Kathrin wartet“, und drückte das Gespräch weg. Während sie die Treppe hinuntereilte, meinte sie: „Also weißt du, der Gaul wird ja wohl zehn Minuten auf dich warten können. Warum immer nur das Gehetze.“ Sie schnappte sich Jacke, Mütze und Handschuhe von der Garderobe und folgte ihrer Tochter aus der Haustür.
„Der Gaul“, Kathrin verdrehte die Augen, „heißt Longlife und hat mehr als fünfzehntausend Euro gekostet, sagt Opa.“
Na, und der muss es ja wissen, dachte Marion resigniert. Sie hatte vor dem Kauf allerhand gegen das teure Geschenk ihrer Schwiegereltern einzuwenden gehabt, war aber wie immer, wenn sie mit ihnen im Clinch lag, als Verliererin hervorgegangen. Und natürlich konnte der gute Opa seine Enkelin über den Preis des Pferdes nicht im Unklaren lassen, wohl wissend, dass die anderen Großeltern, Marions Eltern, nicht dazu in der Lage gewesen wären.
Ihre Tochter blieb kurz auf dem Gartenweg stehen, der zu dem weitläufigen, kühn geschnittenen Bungalow in Ginnheim führte, und drehte sich um. „Und ob du jetzt mit Papa meine Zwischennoten diskutierst oder in zwei Stunden, wenn er nach Hause kommt, ist ja nun nicht so entscheidend, oder?“
Kathrin war zwölf, besaß lange, blonde Haare, ein hübsches Gesicht voller Sommersprossen, eine nicht zu bremsende Leidenschaft für Pferde und kultivierte ihre in letzter Zeit gehäuft auftretenden Anflüge von Altklugheit besser, als es ihren Eltern lieb war.
Sie stiegen in Marions Golf, der auf der Straße stand, und schnallten sich an.
„Und außerdem ...“, setzte Kathrin erneut an.
„Lass gut sein, Schatz“, sagte Marion zerstreut. Sie reihte sich in den Verkehr ein und schien mit den Gedanken weit weg zu sein. Was größtenteils Theater war: Sie hatte die Erfahrung gemacht, am besten mit den pubertären Ausfällen ihrer Tochter fertig zu werden, wenn sie sie ins Leere laufen ließ und zu einer Beiläufigkeit am Rande degradierte.
„Ich wollte nur noch sagen“, fuhr Kathrin jetzt in ihrem normalen Ton fort, „Rainer wartet ja auch schon um vier, nicht nur Longlife“, sie grinste zu ihrer Mutter hinüber, „der Gaul.“
Rainer war der Trainer, und in der Sache hatte Kathrin völlig Recht; die Stunden bei ihm waren alles andere als billig. Andererseits war er jeden Cent wert – wie im übrigen das Pferd auch. Dank dieser beiden und natürlich wegen ihres zweifelsohne vorhandenen Talents war Kathrin zu einer der erfolgreichsten Springreiterinnen ihrer Altersklasse aufgestiegen; davon zeugten unzählige Schleifen an der Wand ihres Zimmers, Rosetten vornehmlich in gold-gelb und grau-silber für erste und zweite Plätze bei Turnieren. Sie und Longlife waren ein perfektes Team, und sie liebte ihn so abgöttisch, wie nur eine Zwölfjährige ein Pferd lieben konnte.
Marion nahm die Autobahnauffahrt, um das kurze Stück über die A5 zu fahren, die sie zum Reitstall und Trainingshof nahe des Stadtwaldes bringen sollte. Kurz vor Niederrad blinkte sie und wechselte von der rechten der vier Fahrspuren auf die Abbiegespur der Ausfahrt.
Es war das Letzte, was sie in ihrem Leben bewusst tun sollte.
Weder sie noch ihre Tochter hatten sehen können, wie ein schwarzer, schwerer Audi mit hohem Tempo von der äußersten linken Spur quer über drei Fahrbahnen raste und direkt auf den Golf zupreschte. Er schoss mit ungebremster Geschwindigkeit in dessen hintere linke Tür hinein, schleuderte ihn ein Stück weiter, rammte ihn gegen die hohe Begrenzungsmauer und kam schließlich kurz vor der Mauer selber zum Stehen. Der Fahrer, ein Geschäftsmann Ende Dreißig, blieb einige Augenblicke wie betäubt hinter dem Steuer sitzen.
Dann stieg er langsam aus.
Als Polizei und Rettungswagen sich mehr als eine Viertelstunde später endlich mühevoll eine Rettungsgasse durch das Chaos der Blechlawine hinter dem Unfall gebahnt hatten, fanden sie ihn immer noch zitternd an seinen Kotflügel gelehnt. Außer einem tiefen Schock hatte er keinerlei Verletzungen davongetragen.
Der riesige 24-Zoll-Bildschirm warf sein flackerndes Licht auf einen mit einer starken Schreibtischlampe beleuchteten Arbeitsplatz. Der Rest des stylischen Großraumbüros lag im Halbdunkel; nur durch die Glastüren, die zum Flur hinausgingen, drang gedimmtes Licht. Auf dem Monitor prangte eine CAAD-Darstellung, die dreidimensionale Innenansicht eines modernen Bürokomplexes; sein etwas kleinerer 19-Zoll-Kollege neben ihm zeigte eine Aufriss-Skizze desselben Gebäudes.
Daniel Skipanski ließ die Maus los, bog aufatmend die Arme hinter den Kopf, streckte seine langen Beine aus und ließ seinen Blick noch einmal über die beiden Bildschirme wandern. Er nickte zufrieden vor sich hin. Das Projekt gedieh und würde, wie fast alles in den letzten Jahren, ein Erfolg werden – ein Erfolg, der ihm manchmal Angst machte, weil er so schnell gekommen war. Skipanski hatte die Vierzig bereits überschritten, als er seine Stellung in einem Frankfurter Architekturbüro gekündigt hatte, um sich selbständig zu machen. Jetzt, knapp acht Jahre später hatte er es geschafft; dieses Büro im 39. Stock des Opernturms war nicht nur in geografischer Hinsicht der Höhepunkt seines beruflichen Aufstiegs.
Er wandte den Kopf den großen Fenstern zu, die eine grandiose Sicht auf Teile der nächtlich erleuchteten Frankfurter Skyline freigaben: Wunderwerke der Architektur, konzentriert auf minimalem Raum in einer dafür eigentlich zu kleinen Stadt, die sich stolz und legitim mit dem hektischen Nimbus einer Weltmetropole umgab, während außerhalb der lauten, doch recht überschaubaren City in den vielen Stadtteilen das gemütliche, kleinstädtische Flair vorherrschte.
Direkt gegenüber dem Bürofensters ragten die glitzernden Zwillingstürme der Deutschen Bank mächtig, fast bedrohlich in den Abendhimmel; vom anderen Fenster fiel der Blick, wenn man davor stand, tief nach unten auf das grüne Dach der Alten Oper.
Skipanski sah auf seine Armbanduhr. Gleich sieben. Feierabend. Marion und Kathrin waren sicher schon längst wieder zu Hause, und sie wollten heute Abend alle zusammen essen gehen. Er hatte versprochen, pünktlich zu sein. Er speicherte seine Arbeit ab, sicherte sie nochmals auf einer separaten Festplatte und stand auf
Während er seinen Mantel anzog, begann draußen im Halbdunkel des Empfangs das Telefon zu klingeln. Frau Klose, glückliche Teilnehmerin an der Aktion geregelte Arbeitszeit, war bereits vor über einer Stunde gegangen; von den beiden anderen festangestellten Architekten hatte einer Urlaub, der andere praktizierte irgendwo auf der A66 stop and go auf dem Rückweg von einem Kundengespräch.
Innerlich fluchend, den einen Arm bereits im Mantel, den anderen suchend nach dem zweiten Ärmel hinter sich gestreckt, beugte sich Daniel vor und nahm das Gespräch an seinem Apparat an.
„Architekturbüro Skipanski, guten Abend.“
„Guten Abend. Ich möchte Herrn Daniel Skipanski sprechen.“
„Am Apparat. Wer spricht denn da?“, fragte er gereizt. Ungeduldig fuchtelte er mit dem linken Arm nach hinten, der Mantel hatte sich irgendwie verheddert. Doch etwas in der Stimme des Anrufers ließ ihn den Hörer nicht gleich wieder auf die Gabel zurückwerfen, wie er es mit ungebetenen Telefonaten immer zu tun pflegte.
Zehn Minuten später fand ihn Bernhard Müller – sein Mitarbeiter, der, endlich dem Stau entkommen, eigentlich nur kurz die Unterlagen ins Büro bringen wollte – am Schreibtisch sitzend, mit kalkweißem Gesicht blicklos vor sich hin starrend. Die linke Mantelhälfte lag zerknüllt mit noch immer losem Ärmel neben ihm auf dem Bürosessel.
Der junge Architekt rüttelte ihn, erst sachte, dann fester am Arm. „Herr Skipanski! – Hören Sie mich? Daniel!“
Aus leeren Augen starrte Daniel ihn an. „Ich muss nach Hause; die Pizza ...“
Bernhard Müller kramte in den Resten seiner Erinnerungen an die Sofortmaßnahmen am Unfallort, die schon einige Jahre zurücklagen, und erkannte den schweren Schock, unter dem sein Chef stand. Er telefonierte nach dem Notarzt, verfrachtete Daniel vorsichtig auf den Teppichboden, während er ihm den Mantel endlich vollends anzog und legte ihm seinen eigenen Mantel darüber. Dann ging er in die Küche, um einen besonders süßen Tee zuzubereiten, vom dem er zwar wusste, dass Skipanski ihn verabscheute, über den er andererseits in solchen Situationen aber nur Gutes gehört hatte. Schließlich rief er seine Frau an und sagte ihr, dass es später werden würde.
Der Prozess gegen Rolf Suttner, den Fahrer des Audi, der Daniel Skipanskis Frau und Tochter getötet hatte, war für sechs Monate später angesetzt worden. Die Anklage lautete auf fahrlässige Tötung in zwei Fällen. Daniel Skipanski saß als Nebenkläger vorne neben seinem Anwalt Klaus Breuer; der Staatsanwalt hatte ihn kühl und sachlich begrüßt, ihn dann jedoch nicht weiter beachtet; Suttners Verteidiger von der Bank gegenüber ignorierte ihn völlig. Die vorsitzende Richterin, bekannt für ihre raschen und kühl begründeten Urteile, schaute sich prüfend in dem kleinen Verhandlungssaal um.
Es war ein drückend-schwüler Julitag, die Fenster des alten Gerichtsgebäudes waren weit offen, ohne dass dies in irgendeiner Weise für Abhilfe gesorgt hätte. Der Raum war nur mäßig besetzt. Ben Skipanski war einer der Zuschauer in der letzten Reihe.
Wer fehlte, war der Angeklagte.
Rolf Suttner, teilte sein Verteidiger dem Gericht beflissen und mit großer Geste mit, sei auf einer Geschäftsreise in den USA und habe diesen äußerst wichtigen Termin in Übersee nicht verschieben können. Er, der Anwalt, habe versucht, seinen Mandaten per E-Mail zu überzeugen, dass diese Verhandlung für Suttner wichtiger sei, doch keine Antwort erhalten. Ebenso wenig sei er auf seinem Handy zu erreichen gewesen. Natürlich – der Anwalt hob beschwörend die Hände, die Seidenrobe fiel wie ein Messgewand an ihm herab – selbstverständlich hieße das nicht, dass der Angeklagte die Sache nicht ernst nähme; im Gegenteil, sie tue ihm unendlich leid.
Sein kurzer Seitenblick zum Staatsanwalt auf der anderen Seite des Verhandlungsraums entging der Richterin nicht: Anklage und Verteidigung hatten sich im Vorfeld abgesprochen, der Staatsanwalt würde aus dem Nichterscheinen des Angeklagten keine große Sache machen. Prompt erhob sich der Ankläger und beantragte ein Strafbefehlsverfahren, bei dem man auf die Anwesenheit des Beschuldigten verzichten könne. Der positive Nebeneffekt dieser Strategie für die Verteidigung lag in der Tatsache, dass damit das Strafmaß in jedem Fall auf Bewährung auszusetzen war.
Mit ausdruckslosem Gesicht lauschte die Richterin den Ausführungen der beiden Anwälte, schwieg danach ein paar Augenblicke, während sie ihren Blick zwischen Verteidiger und Staatsanwalt schweifen ließ – entschied gegen den Strafbefehl und beraumte die Hauptverhandlung an.
„Wie jetzt?!“ Irritiert wandte sich Daniel an Klaus Breuer, der wie seine Kollegen begann, seine Sachen zusammenzupacken, nachdem das Gericht den Saal verlassen hatte. „Was heißt das denn nun?“
„Glück gehabt, alter Freund“, antwortete Breuer grimmig. „Und eine Richterin mit gesundem Menschenverstand.“ Er beugte sich näher zu Daniel hin und raunte ihm zu, während seine Augen zwischen Strafverteidiger und Staatsanwalt hin und her gingen. „Das gefällt mir nämlich gar nicht, was die beiden sich da zusammenmauscheln ...“
„Mauscheln? Der Verteidiger und der Staatsanwalt? Das glaubst du doch nicht im Ernst?“
„Schon dagewesen, Daniel“, antwortete Breuer, „alles schon da gewesen. Vielleicht spielen sie zusammen Golf, vielleicht – was weiß ich. Der Angeklagte ist ein sehr hohes Tier in der Wirtschaft, vergiss das nicht. So einer hat weit reichende Beziehungen.“ Er schüttelte den Kopf.
„Das darf doch nicht ...“
„Komm!“ Breuer nahm Daniel am Arm, „Lass uns von hier verschwinden und einen Kaffee trinken, bevor dein Vertrauen in das deutsche Rechtssystem völlig zusammenbricht. Und dann erkläre ich dir den Unterschied zwischen einem Strafbefehlsverfahren und einer Hauptverhandlung.“
Daniels Skipanski und Klaus Breuer, sein Anwalt für die Nebenklage, waren alte Schulfreunde. Äußerlich hätten sie nicht verschiedener sein können: Daniel war hochgeschossen und hager und ging leicht gebeugt, das nur leicht schüttere Haar, in den letzten Monaten vollends grau geworden, trug er nachlässig halblang; er liebte Jeans – mit Vorliebe in Kombination mit einfarbigen Hemden und ärmellosen Westen – und hasste Krawatten. Klaus dagegen war einen guten Kopf kleiner, machte aber in der Breite den Mangel an Höhe wett. Er war hochintelligent, was nicht jeder sofort bemerkte – eine Tatsache, aus der er schon oft vor Gericht Kapital geschlagen hatte –, äußerst lebhaft und unerschütterlicher Optimist; eine Frohnatur und ein blitzschneller Denker. Nie sah man ihn anders als im dunklen Anzug mit Krawatte und weißem Hemd, mochten die Temperaturen sibirisch oder – wie heute – subtropisch sein. Nie sah man ihn ohne ein weißes Taschentuch, mit dem er sich, ebenfalls unabhängig von der Witterung, ständig ein paar Schweißtropfen von der Stirn tupfte, einer – wollte man es galant formulieren – sehr hohen Stirn. Tatsache war, dass ihm außer einem halbrunden lockigen Kranz nichts mehr von seiner einstigen Haarpracht geblieben war.
Seit der neunten Klasse, als Daniel von Klaus Latein und dieser von jenem Mathe abgeschrieben hatte, hatten sie einander immer wieder aus dem einen oder anderen Lebenstief heraus geholfen. Wie damals, als Klaus‘ Frau Renate innerhalb von nur wenigen Stunden für immer aus seinem Leben und ihrer fünfzehnjährigen Ehe verschwunden war. Oder als Daniels Sohn Ben nicht nur in der achten, sondern auch nach der zehnten Klasse eine Ehrenrunde auf dem Gymnasium gedreht hatte und dort zudem noch mit einer ordentlichen Portion ‚Gras‘ erwischt worden war.
Doch waren alle diese kleinen und großen Miseren nur Bagatellen im Vergleich zu dem Abgrund, vor dem Daniel und sein Sohn seit einem guten halben Jahr standen.
„Das heißt, es wäre von vornherein klar gewesen, dass dieses Schwein nicht ins Gefängnis muss, wenn der Staatsanwalt mit diesem Strafbefehl durchgekommen wäre?“, fragte Daniel ungläubig.
Sie saßen jetzt in einem der Cafés in der Nähe des Gerichts, beide ein leeres Cognacglas und eine volle Kaffeetasse vor sich. Klaus Breuers Taschentuch war bei der Hitze unablässig im Einsatz.
Er nickte. „Geldstrafe oder maximal ein Jahr auf Bewährung. Oder beides. Und der Beschuldigte muss nicht erscheinen. Trotzdem gilt er als vorbestraft. Man macht das oft bei kleineren Vergehen oder bei Verkehrssachen und so weiter. Die Gerichte werden dadurch enorm entlastet.“
„Kleineren Vergehen, Klaus, ich bitte dich!“
„Keine Angst, Danny“, unwillkürlich war Klaus wieder in die Anrede aus Jugendtagen verfallen, „ich werde alles dafür tun, dass der seine ordentliche Strafe bekommt. Denn wir sind nicht der Meinung, dass es sich hier um eine reine Fahrlässigkeit handelt. Und –“, er sah seinen Freund an, „bei einer Verhandlung muss Suttner erscheinen, wenn es nicht sehr unangenehm für ihn werden soll.“
Rolf Suttner sah seinen Anwalt ärgerlich an. „Hätten Sie das nicht besser deichseln können? Wozu bezahle ich Sie eigentlich?“
„Ich habe getan, was ich konnte!“
„Dann war das eben nicht genug!“
„Hören Sie, Herr Suttner, die Chancen standen fünfzig zu fünfzig, dass das Verfahren relativ schnell und schmerzlos über die Bühne geht. Aber letztlich entscheidet in diesem Land immer noch der Richter, ob er auf einer Verhandlung besteht oder nicht. Oder eben eine Richterin.“
Rolf Suttner war gerade aus Boston zurückgekehrt und saß nun müde und schlecht gelaunt im Arbeitszimmer seiner Kronberger Villa. „Ich bin davon ausgegangen, dass die Sache aus der Welt ist, wenn ich zurückkomme“, sagte er schneidend. „Ich habe weiß Gott weder Zeit noch Lust, mich auch noch mit solchen Dingen zu beschäftigen. Dazu hat man Leute wie Sie! – Himmelherrgott, es war ein Unfall! “
Er stand auf und begann, unruhig im Zimmer auf und ab zu gehen.
„Und was bedeutet das jetzt konkret?“ Die Hände in den Hosentaschen, blieb er vor dem Anwalt stehen und schaute auf ihn herab.
„Zunächst einmal, dass Sie zur Hauptverhandlung erscheinen müssen.“
„Ich muss was?“, fragte Suttner mit der Ungläubigkeit eines Menschen, der gewohnt war, selber zu bestimmen, wie die Welt zu sein hatte und wie nicht.
„Ich möchte es Ihnen dringend raten!“ Der Anwalt legte genüsslich einen drohenden Unterton in seine Stimme. Ab und zu überkam es ihn: Er hatte es einfach satt. Leute wie Suttner zu Klienten zu haben war schön und gut, denn es zahlte sich finanziell mehr als aus. Doch manchmal sehnte er sich nach seiner alten, kleinen Kanzlei zurück, mit der er einmal angefangen hatte ...
Nur manchmal. Und lange hielten solche Anwandlungen nie an.
„Damned!“ Gereizt stieß Suttner mit dem Fuß gegen den Papierkorb, der sich ihm in den Weg stellte. „Was ist der Mann? Architekt? – Bieten Sie ihm Geld! Vielleicht wartet er nur darauf!“
Betty Suttner hatte ihren Mann die ganze Zeit beobachtet; jetzt zog sie den Mund verächtlich nach unten.
„Rolf, du machst dich lächerlich.“
Er würdigte sie keines Blickes. „Und was noch?“, blaffte er den Anwalt an, während er seine Wanderung durch das Zimmer wieder aufnahm.
„Nun“, antwortete dieser vorsichtig, „es liegt im Bereich des Möglichen, dass Sie nicht mehr mit einer Bewährungsstrafe davonkommen.“
Suttner blieb abrupt stehen. „Das heißt …“ Er starrte den Anwalt fassungslos an. „Sie meinen... Sie wollen damit sagen, ich müsste ins – Gefängnis!?“
Einen Augenblick stand er noch reglos und musterte den Anwalt. Dann lachte er plötzlich laut auf. „Wegen eines dummen Unfalls!? Wenn das ein Scherz sein soll, Herr Dr. Walther, dann war er entschieden unangebracht!“
Ein halbes Jahr später, am Abend vor der Hauptverhandlung gegen Suttner, fast ein Jahr nach dem verheerenden Unfall, verabredeten sich Vater und Sohn Skipanski zu einem kleinen Essen: Es war Bens einundzwanzigster Geburtstag. Nach Feiern war zwar keinem von ihnen zumute, doch hatte Daniel auf diesem Essen bestanden. Ben hatte sich in den letzten Wochen kaum sehen lassen, und wenn, lagen dunkle Schatten um seine mürrisch dreinblickenden Augen. Seine Mundwinkel schienen in Dauerstellung nach unten gezogen, seine Kleidung war ganz gegen seine Gewohnheit nachlässig, Fragen nach dem Fortgang seines Jura-Studiums wich er aus.
Klaus Breuer war ebenfalls eingeladen worden; Daniel hatte den Eindruck, ihn als Katalysator und Schutzschild gegen seinen Sohn zu benötigen. Außerdem war er Bens Patenonkel und hatte sich immer blendend mit ihm verstanden. Wenn überhaupt jemand, dann war er es, der wieder einen Draht zu ihm finden würde.
„Lass ihn, Daniel, gib ihm noch Zeit“, meinte er jetzt, während sie auf Ben warteten, der bereits zwanzig Minuten überfällig war. Einmal mehr musste er als Sparringpartner für die Vatersorgen seines Freundes herhalten. „Er hat es noch nicht verkraftet.“
„Verkraftet!“ Daniel lachte bitter auf. „Himmelherrgott, Klaus, verkraftet! Wie kann man das denn verkraften?! Natürlich hat er das noch nicht verkraftet! Marion und Kathrin sind gerade mal ein Jahr tot; meinst du denn, ich hätte ...“ Er fuhr sich mit den Händen über das Gesicht. „Aber Ben ist erst seit ungefähr zwei Monaten so verändert. Das ist es, was mir Sorgen macht.“
„Wie verändert? Ich habe ihn lange nicht gesehen, er rief nur einmal an und hatte eine Frage vor einer Klausur. Ist auch schon wieder sechs Wochen her.“
„Ich weiß nicht, habe ihn ja selber kaum gesehen. Das ist es ja eben.“
„Liebeskummer?“ Klaus Breuer schüttelte den Kopf. „Nein, ich denke, es hat etwas mit dem Prozess zu tun. Lass uns den erst einmal hinter uns bringen; du wirst sehen, danach wird es ihm besser gehen.“
Daniel seufzte. „Mir auch.“
„Geht er noch zu diesem Psychologen?“
Daniel nickte. „Zumindest bekomme ich regelmäßig die Rechnungen.“
„Daniel“, begann Klaus vorsichtig, „hör mal, der Junge ist inzwischen einundzwanzig. Ich meine, – ich weiß, du hast nur noch ihn und du hängst sehr an ihm, aber … manchmal … wenn ich ehrlich sein soll ...“
„Was denn?“ Unwillig fuhr Daniel auf.
„Nun ja“, Klaus atmete tief ein, „ich habe das Gefühl, dass du klammerst.“ Er hob die Hand. „Schon gut, nicht aufregen. Er muss doch nicht jede Woche bei dir auftauchen, oder?“
Daniel blickte bestürzt. „Aber … aber das hat er doch seit damals immer ...“
Er brach ab. Ben hatte das Lokal betreten. Schlurfend kam er zu ihrem Tisch. Schwerfällig, die Augen gesenkt, fläzte er sich ohne ein Wort der Entschuldigung auf seinen Platz, gerade noch verständlich „n‘Abend“ vor sich hin murmelnd. Die beiden Männer sahen sich an, Daniel machte eine hilflose Geste, die bedeutete: Hab ich‘s nicht gesagt?
Da stand Klaus Breuer auf, stellte sich vor Ben hin, reichte ihm förmlich die Hand, sogar eine kleine Verbeugung brachte er fertig, und sagte: „Lieber Ben, ich wünsche dir von Herzen alles Gute zu deinem Geburtstag. Lebe dein Leben und schau nach vorn!“
Verblüfft blickte der junge Mann hoch, verwirrt und verlegen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als aufzustehen und die dargebotene Hand zu nehmen.
„Danke, Klaus“, murmelte er.
Sein Vater erhob sich ebenfalls. „Alles Gute, mein Junge.“
Seine Umarmung war flüchtig, weil sich ihr Ben sofort wieder entzog.
„Ist ja gut.“ Ganz offensichtlich war ihm die Szene peinlich, doch wenigstens spielte nun ein winziges Lächeln in seinem Gesicht. Und er nahm auch eines der drei Sektgläser, die Daniel bereits vorher in Auftrag gegeben hatte und jetzt herbeiwinkte, und ließ den Toast über sich ergehen.
„So, das hätten wir hinter uns gebracht!“, meinte Klaus grinsend, während sich alle wieder setzten. „War ja nicht so schlimm, oder?“
Er stieß sein Patenkind kameradschaftlich in die Seite. Tatsächlich wurde dessen Lächeln etwas breiter.
„Dann lasst uns jetzt mal bestellen.“ Daniel griff nach einer der Karten, die seit einer halben Stunde auf dem Tisch lagen. „Ich habe Hunger.“
„Es sieht gut aus.“ Klaus Breuer schob zufrieden seufzend ein leeres Glas zu Seite, aus dem er eben noch die Reste einer köstlichen Zabaione gelöffelt hatte. „Es haben sich viele Zeugen gemeldet, denen der Fahrer zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Unfallstelle in Niederrad böse aufgefallen ist. Drängeln, rücksichtsloses Fahrbahnwechseln, rechts überholen, überhöhte Geschwindigkeit – das ganze Programm.“
„Und wie …?“
„Internet.“ Der Anwalt grinste verhalten. „Hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber: Facebook sei Dank!“ Ernster fuhr er fort: „Die Polizei hat dort spezielle Seiten, auf denen sich Zeugen melden können. Und die haben wir alle geladen.“
Ben war wieder in seinen Missmut verfallen. „Lasst mich damit in Ruhe!“ Brüsk stand er auf. „Hab noch zu tun. Und ich will nichts mehr hören von diesem Scheiß-Prozess!“
In die Gerichtsgebäude der Frankfurter Justizbehörden eine Waffe einzuschmuggeln, ist nahezu eine Unmöglichkeit. Die Sicherheitsvorkehrungen und die Kontrollen an den Eingängen für jedermann, seien es Angestellte, Anwälte oder Besucher, sind wasserdicht. Personenschleusen, Körperscanner, Taschenröntgengeräte – kein Schlüsselbund, kein Reißverschluss, kein Jeansknopf hat die Chance, ungesehen in das Gericht zu gelangen.
Ben Skipanski hatte wieder in der letzten Reihe des kleinen Verhandlungsraums Platz genommen. Sein Vater saß mit Klaus Breuer vorne neben der Staatsanwältin; der Raum war mäßig besetzt. In der ersten Bank saßen eine äußerst attraktive Mittdreißigerin in einem ganz offensichtlichen sehr teuren Kostüm; neben ihr ein Mann, der dem Angeklagten auffallend ähnlich sah. Beide blickten hin und wieder nervös zur Anklagebank hinüber, wo Rolf Suttner ruhig und entspannt neben seinem Verteidiger saß. Im Gegensatz zu seiner Frau Betty und seinem Bruder Oliver schien er die Ruhe selbst; das für ihn typische und von seiner Umwelt meist gefürchtete leise Lächeln hing unveränderlich in seinen Mundwinkeln – ja, er nickte den beiden mehr als einmal beruhigend zu, als ginge ihn die ganze Veranstaltung, wenn überhaupt, nur am Rande etwas an.
Kurz nach Beginn der Verhandlung stand Ben Skipanski langsam auf, hob seine rechte Hand, zielte flüchtig und gab kurz hintereinander zwei Schüsse auf den Mann ab, der seine Mutter und seine Schwester auf dem Gewissen hatte.
Danach blieb er aufrecht und bewegungslos stehen, Augen und Waffe unverwandt auf Rolf Suttner gerichtet. Schließlich ließ er die Pistole langsam sinken. Man hörte sie polternd auf den Fußboden fallen.
Dann brach die Hölle los.
Menschen schrien auf; Bens Vater und Klaus Breuer schnellten von ihren Sitzen hoch; der Angeklagte brach zusammen; Justizbeamte bahnten sich einen Weg zu Ben, einer drehte ihm brutal die Hände auf den Rücken und legte ihm Handschellen an; ein anderer kniete auf dem Fußboden auf der Suche nach der Waffe. Jemand rief nach einem Krankenwagen.
Ben Skipanski ließ sich widerstandslos festnehmen.
Rolf Suttner wurde von der ersten Kugel getroffen; der zweite Schuss ging, weil Suttner sofort zu Boden ging, in das Gestühl der Zeugenbank neben ihm. Er blutete stark, doch unter den Zuschauern im Gerichtssaal befand sich eine unerschrockene Krankenschwester, die die Blutung stillte und bereits die richtigen Maßnahmen ergriffen hatte, als der Notarzt kam.
Betty Suttner saß neben ihrem Schwager Oliver auf einem unbequemen Schalensitz im Notaufnahme-Wartebereich der Frankfurter Unikliniken und spürte den unbezähmbaren Wunsch nach einer Zigarette. Sie waren dem Krankenwagen vom Gericht bis nach Sachsenhausen gefolgt; Oliver hatte dann rasch den Wagen im Parkhaus abgestellt, während Betty ausgestiegen und zur Notaufnahme geeilt war.
Nichts Lebensgefährliches, hatte der Arzt gesagt, der im Laufschritt, mit einem Röntgenbild in der Hand, durch den Flur geeilt war. Die Kugel sei am Knochen abgeprallt; zwar sei keine Arterie getroffen, doch habe das Projektil, bevor es abgeleitet wurde, Teile des linken Os femoris zersplittert …
„Des was?“, hatte Betty gefragt.
„Des Oberschenkelknochens. – Frau Suttner, ich muss in den OP. Ihr Mann ist jetzt soweit vorbereitet worden.“ Der Chirurg erinnerte sich rechtzeitig, dass er Privatpatienten vor sich hatte, setzte ein flüchtiges, warmes Lächeln auf, das trotz aller Routine seine Wirkung nie verfehlte, und tätschelte ihr kurz den Arm. „Keine Sorge, Ihr Mann ist bei uns in den besten Händen.“ Damit war er durch eine große Tür, die den Zurückbleibenden mit drohender Schrift den Zutritt verweigerte, verschwunden.
Jetzt erhob sie sich. „Oliver, ich muss mal raus. Das dauert bestimmt noch.“
Oliver Suttner nickte. „Mach aber nicht so lange. Ich möchte dann bald nach Hause, wenn es dir recht ist.“ Er schaute sie fragend an. „Oder brauchst du mich hier noch?“
„Nein, nein, schon okay. Ich hätte das auch alleine geschafft. Ich dachte nur, dass du bei deinem Bruder ...“
„Ja, natürlich wollte ich mitkommen. Aber“, er schaute auf die Uhr, „Erika kommt bald nach Hause, und ich habe sie den ganzen Tag noch nicht erreicht. Sie wird sich Sorgen machen, wenn ich nicht da bin.“
Langsam ging Betty Suttner dem Ausgang zu. Es war inzwischen fast dunkel geworden. Den ganzen Tag über hatte sich die Sonne nicht gezeigt; der unfreundliche Januarnachmittag ging nahtlos in einen ungemütlichen Abend über. Sie stellte sich Schutz suchend unter das große Vordach vor dem Haupteingang, wo rund um die großen Aschenbecher aus Beton Nikotinabhängige in der kalten Luft von einem Fuß auf den anderen traten.
Betty zündete sich eine Zigarette an und zog das Handy aus der Handtasche. Gedankenverloren studierte sie die Nachrichtenliste, dann holte sie tief Luft und wählte.
„Hallo, mein Liebling. – Ja, ich hatte das Handy im Gericht ausgeschaltet. – Was? Nein. – Ja, ich weiß, ich habe es versprochen, aber es … Wie? Nein. Ich .. – Nun lass mich doch mal ausreden!“
Ihre Stimme war lauter geworden. Sie warf einen Blick rundum und entfernte sich einige Schritte von einer dicken Frau mit strähnigen Haaren und einem Armverband, die sie neugierig musterte, während sie gierig an ihrer Zigarette zog. Unter ihrer schmuddeligen Winterjacke lugte ein knallroter Morgenrock und ein verwaschenes Nachthemd hervor, das wohl einmal mit bunten Blumen bedruckt gewesen war.
„Hör zu“, fing Betty leiser wieder an. „Es ist etwas passiert.“
Sie erzählte in knappen Worten von den Geschehnissen im Gericht. Ein paar Sekunden war es still in der Leitung.
„Natürlich gab es heute kein Urteil, sie mussten alles abbrechen, was denkst du denn?“ fragte sie schließlich genervt. Sie seufzte und beobachtete, wie ein Rettungswagen vor dem Eingang zur Notaufnahme hielt. „Entschuldige, Schatz, es war ein harter Tag, ich wollte dich nicht … – Ja, klar. Daran hat sich nichts geändert. – Keine Ahnung, wie lange das hier noch dauert, aber weggehen kann ich ja schlecht. – Den Zwillingen habe ich noch nichts gesagt. Was soll ich sie aufregen, sie haben jetzt im Internat jede Menge Prüfungen, und die Schweiz ist weit. Es ist ja nichts Lebensbedrohendes; Rolf rappelt sich schon wieder auf. – Mach‘s gut, mein Liebling, und entschuldige noch mal. Meine Nerven sind zur Zeit nicht die besten.“ Sie lachte leise. „Ich gehe mal wieder rein. – Ja, ich dich auch. Bis dann.“
Während sie das Handy wieder verstaute, schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, wie es wohl wäre, wenn Rolf sich nicht mehr ‚aufrappeln‘ würde. Doch er war so schnell verschwunden, wie er gekommen war.
Es wurde nie ermittelt, wie die Waffe in das Gerichtsgebäude gelangen konnte. Die Polizei vermutete, dass Ben es über den Umweg eines Mitarbeiters bei der Putzkolonne geschafft hatte, der Aushilfskraft Michael Schilling, der erst vier Wochen vorher bei der Reinigungsfirma angeheuert und sich als Studienkollege und guter Freund Ben Skipanskis entpuppte. Doch es gab nicht den Schatten eines Beweises, der ihn mit den Vorkommnissen in Zusammenhang brachte.
Auch, wie die Waffe – wenn denn dieser Weg eingeschlagen worden war – in den vollgestopften Schiebewagen mit den Putzmitteln, Lappen, Eimern und Besen gelangt war, konnte nie geklärt werden.
Ben kooperierte in vorbildlicher Weise mit Polizei und Staatsanwalt, machte bereitwillig seine Aussage, beantwortete die Fragen, unterschrieb ruhig sein Geständnis und brachte seinen Anwalt und Patenonkel zeitweise an den Rand der Verzweiflung. Nur zu der Frage, woher und wie die Pistole ins Gericht kommen war, schwieg er hartnäckig.
Für den Staatsanwalt stand der Tatbestand des versuchten Mordes fest: Der Vorsatz und das „unmittelbare Ansetzen“ der Tat seien klar bewiesen und bezeugt, das Merkmal der Heimtücke insofern gegeben, als Ben bewusst die „Arg- und Wehrlosigkeit“ seines Opfers ausgenutzt habe. Er betonte, dass Rache unter die Kategorie der niedrigen Beweggründe falle, und forderte die Höchststrafe.
Klaus Breuer, der Ben verteidigte, focht unter den gegebenen Umständen einen annehmbaren Sieg heraus. Das Gericht folgte in vielen Punkten seiner Argumentation und würdigte eingehend die Täterpersönlichkeit Ben Skipanskis und seine Kooperationsbereitschaft, die Hintergründe der Tat sowie die Tatsache, dass der Versuch nach § 23 StGB einen Grund zur Strafmilderung darstelle.
Trotzdem konnte all das nicht verhindern, dass sich die Gefängnistore der JVA Preungesheim für fünf lange Jahre hinter ihm schlossen.