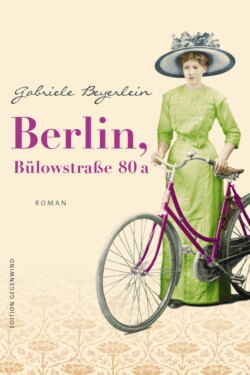Читать книгу Berlin, Bülowstraße 80 a - Gabriele Beyerlein - Страница 4
1.1
ОглавлениеDieser Abend war der kostbarste der ganzen Woche. Sophie schob den Vorhang beiseite und beobachtete durch das Fenster die hochaufgerichtete Gestalt ihrer Mutter, die sich auf dem Gehsteig vom Haus entfernte und bei jeder Pfütze mit vollendet aristokratischer Handhaltung den weiten Rock raffte. Frieda, das alte Dienstmädchen, folgte der Mutter, sichtbar um den richtigen Abstand bemüht: weit genug entfernt, um den Rangunterschied zu zeigen, nahe genug daran, um Zusammengehörigkeit zu demonstrieren. Als die Mutter um die Straßenecke gebogen war, seufzte Sophie tief auf.
Sieben Tage lang hatte Sophie sich auf diesen Mittwochabend gefreut, wenn die Mutter zum Salon ging, den Frau General von Klaasen wöchentlich ausrichtete. Sophie hatte sich vorgenommen, den Roman zu lesen, den sie sich heimlich von ihrer Freundin Cecilie geliehen hatte. Doch nun stand sie träumend am Fenster und sah zu, wie der Dienstmann die Gaslaternen auf der Straße anzündete und die Dämmerung sich langsam vertiefte. Einige barfüßige Kinder aus den Hinterhöfen rannten lachend und schreiend über die Straße, Männer in blauen Arbeitshemden schlurften müde den Gehweg entlang, ein zweistöckiger Pferdeomnibus und eine Kutsche fuhren vorbei, aus dem Krämerladen im Keller des Nachbarhauses stiegen zwei Dienstmädchen mit ihren Einkaufskörben die Stufen herauf. Dennoch erschien Sophie die Straße wie ausgestorben. Aber andere Straßen gab es in der Stadt, in denen jetzt das Leben pulsieren würde ...
Verführerisch tauchte ein Gedanke in ihr auf, so verwegen, dass ihr Atem sich beschleunigte: Einfach das Cape nehmen und in das Herz der Stadt gehen, die Friedrichstraße entlang flanieren oder besser noch Unter den Linden. Sich im Strom der Gesellschaft bewegen, die unterwegs war zu Banketten, Theatern, Konzertsälen, der Oper, Varietés und sonstigen Lokalitäten, von denen Sophie nur eine unklare Vorstellung hatte. Und dann sich auf eine Bank setzen, um die Offiziere zu beobachten, die auf dem Reitweg ritten.
Sie könnte zu Hause zurück sein, ehe die Mutter heimkehrte.
Erschreckt verwarf sie den Gedanken wieder. Was dachte sie hier? Sie durfte nicht allein auf die Straße, nicht nur, weil die Mutter es verbot, nein, es schickte sich nicht für eine junge Dame, und dann gar noch am Abend! Wenn jemand sie sähe, der sie kannte! Baronesse von Zietowitz ohne Begleitung im Dunkeln in der Stadt. Unmöglich. Sie lehnte ihre Stirn an die Fensterscheibe.
Irgendwo da draußen war das wirkliche Leben.
Irgendwo da draußen waren die großen Gefühle, das Unbekannte, Geheimnisvolle, Wahre. Irgendwo da draußen war die Liebe.
Dieses Gefühl in ihr ... Wem hätte sie davon erzählen können? Der Mutter am allerwenigsten. Nicht einmal ihrer Freundin Cecilie.
Es war, als wachse da etwas in ihrer Brust, eine träumende Kraft, für die es keinen Platz gab. Wie eine Blume, die sich entfalten wollte, aber nicht konnte, weil ihre Blütenblätter an enge Wände stießen.
Wenn der Vater noch lebte ...
Dann wäre sie nicht hier in der engen Wohnung eingesperrt, müsste sich nicht mit der Mutter viele Stunden täglich mit mühevollen Stickereien die Finger wund und die Augen müde arbeiten. Dann wäre sie in der letzten Saison als Debütantin in einem sündhaft teuren Ballkleid mit Courschleppe in die Hofgesellschaft eingeführt und den Majestäten vorgestellt worden, könnte mit Leutnants und Rittmeistern tanzen statt mit den anderen Mädchen des Tanzzirkels im Haus ihrer Freundin. In der großen alten Wohnung in der Beletage würden sie noch leben, jede Woche ins Theater oder in die Oper gehen, zu Gesellschaften eingeladen werden, zu Landpartien und Bällen. Und wenn dann einer käme, einer, der ihr gefiele und dem sie gefiele ...
Sie wandte sich vom Fenster ab. Was halfen diese Luftschlösser! Sie sollte lieber die Zeit nutzen, in der die Mutter nicht da war, und lesen.
Lesen war das Einzige, wobei ihr die Welt offenstand. Rasch ging sie nach nebenan in das düstere Hinterzimmer, das als langgezogenes Durchgangszimmer den Salon mit der Küche verband. In diesem mit Möbeln vollgestopften Raum fertigte sie mit der Mutter die ewigen Handarbeiten, hier aßen sie, hier schliefen sie. Sophie trat an ihr Bett, das hinter dem der Mutter an der Längswand stand, hob die Matratze am Fußende an und zog das Buch hervor, das sie darunter versteckt hatte, den ersten Band von Krieg und Frieden von Lew N. Graf Tolstoi.
Cecilie hatte ihr den Roman ausgeliehen und sie gebeten, sich mit der Lektüre zu beeilen, sie wolle ihn demnächst selbst lesen. Cecilie, die Tochter des Fabrikanten Theodor Stolze, durfte sich Bücher kaufen und lesen, was sie wollte. Sophie durfte nicht lesen, was sie wollte. Ihre Mutter überwachte jede Lektüre und befand darüber, was sich für sie zieme. Dass Tolstoi nach Ansicht der Mutter dazugehöre, bezweifelte Sophie und hatte vorsichtshalber nicht um Erlaubnis gefragt, sondern das Buch unter ihrer Stickerei verborgen heimgebracht. In gestohlenen Augenblicken, wenn die Mutter kurz aus dem Haus gewesen war, hatte sie es zu lesen begonnen, jetzt endlich konnte sie sich richtig hinein vertiefen, einen ganzen freien Abend lang. Wenn die Mutter fragte, womit sie ihre Zeit ausgefüllt habe, würde sie sagen, sie habe in den Deutschen Klassikern in der Bearbeitung für die Jugend geblättert: hier eine Ballade, dort ein Gedicht.
Kurz zögerte Sophie. Sollte sie sich an den Tisch vor dem Fenster mit der trostlosen Aussicht in den grauen Hinterhof setzen, an dem sie mit der Mutter jeden Tag Stunden um Stunden beim Sticken verbrachte, um mit dem wenigen Geld, das sie im Geschäft für diese Handarbeiten bekamen, die Pension der Mutter aufzubessern und so den notwendigen Sparbetrag für das Offizierspatent ihres Bruders Karl abzweigen zu können? Oder sollte sie sich den Aufenthalt im Vorderzimmer gönnen, auch wenn die Mutter das nie erlauben würde, weil die Polstermöbel geschont werden mussten, weshalb der Salon — außer zum Klavierspielen — nur sonn- und feiertags und bei Besuch benutzt wurde? Sophie warf den Kopf zurück und entschied sich für Letzteres. Die Mutter würde es nicht merken, wenn sie danach kurz lüftete, damit der Geruch der Petroleumlampe verflog. Und wenn Frieda es sah, sobald sie zurückkam, so machte das nichts, Frieda würde sie nie verraten.
Sophie zündete eine Tischlampe an, legte sich ein Kamelhaarplaid über den Arm, nahm das Buch und kehrte in den Salon zurück. Sie stellte die Lampe auf das Tischchen, ließ sich auf dem zierlichen Sofa nieder und wickelte sich in die Decke. Es war herbstlich kühl in dem Zimmer, das nur in den kältesten Wintermonaten beheizt wurde. Dennoch genoss sie das Alleinsein in dem kostbaren Raum mit seinen alten Rokokomöbeln, seinen Figuren aus Meissner Porzellan, seiner vergoldeten Standuhr. Hier war es, als sei alles nicht geschehen, weder der Tod ihres Vaters vor mehr als elf Jahren noch der darauf folgende Sturz in die Mittellosigkeit. Hier merkte man nicht, wie Mutter und sie knausern und knapsen mussten. Hier schien es, als wäre die Welt um sie herum die gleiche wie in ihrer frühen Kindheit und als könne jeden Augenblick etwas geschehen, was sie der Enge entreißen und ihr einen Platz im Leben geben würde, im wirklichen Leben.
Ihr Blick ging zu dem Ölgemälde über der Kommode. Der schöne Offizier in der Uniform des 2. Garderegimentes, der Mann mit dem Stolz um den Mund und dem Schalk in den Augen, der Mann, dessen tiefe Stimme sie noch immer im Ohr zu haben meinte. Unter dem Gemälde das kleine Bronzeschild: Baron Woldemar Freiherr von Zietowitz, geboren 29. Juni 1832, gestorben 6. März 1875. Major des 2. Garderegimentes Seiner Majestät.
Der Vater. Er hatte die Schlacht von Königgrätz und die Schlacht von Sedan überlebt. Warum war er im Frieden so plötzlich gestorben? Sie konnte sich nicht entsinnen, sie war noch keine sechs Jahre alt gewesen, und die Mutter sprach nicht darüber. Nur dass es plötzlich gewesen war, das meinte sie noch zu wissen.
Wenn der Vater noch da wäre, dann wären ihre Tage reich und bunt und voller Lebendigkeit. Dann hätte sie nicht das Gefühl, dass ihre Zeit sinnlos verrann. Dann wären sie nicht so arm, dass sie kaum jemals Gäste haben konnten — und jedenfalls nicht nur die alten Damen, mit denen ihre Mutter verkehrte. Offiziere würden bei ihnen ein und aus gehen, Gelehrte, Musiker, Dichter. Gespräche könnte sie führen, die das Herz berührten, wirkliche Gespräche an Stelle der ewigen französischen Konversation mit der Mutter. So aber blieben ihr nur ihre Träume. Und die Romane.
Alles Grübeln hatte keinen Sinn. Entschieden schlug sie das Buch auf und begann zu lesen. Und bald vergaß sie ihre Gedanken, vergaß auch den Raum, in dem sie sich nicht hätte aufhalten dürfen, und versank in einer anderen Welt. Hätte die längst zurückgekehrte Frieda ihr nicht Bescheid gesagt, als sie sich am späten Abend erneut aufmachte, um die Majorin von Zietowitz bei der Generalin von Klaasen wieder abzuholen und nach Hause zu begleiten, dann hätte Sophie noch lesend auf dem Sofa gesessen, als die Mutter zurückkam. So aber lag sie im Bett und stellte sich schlafend, den Roman unter ihrer Matratze, den Band mit den deutschen Klassikern auf ihrem Nachttisch. Und während sich die Mutter hinter dem Paravent von Frieda das Korsett aufschnüren ließ, schlief Sophie tatsächlich ein.
Irgendwann wachte sie auf, blinzelte kurz zum Fenster, es war noch ganz dunkel. Hatte ein Geräusch sie geweckt? Nein, es war still. Sie versuchte wieder einzuschlafen. Nebenan schlug die Standuhr, sie zählte die Schläge: drei Uhr. Sie sollte wirklich schlafen, aber auf einmal war sie hellwach. Sie seufzte leise, drehte sich hin und her. Schließlich öffnete sie die Augen. Ein schmaler Lichtschein, fein wie mit dem Messer gezogen, drang unter der Tür zum Salon hervor.
War die Mutter da drüben? Wohl kaum — was hätte sie auch dort tun sollen, mitten in der Nacht! Sophie lauschte. Kein Laut. Vielleicht hatte die Mutter am späten Abend noch im Salon gesessen und beim Zubettgehen vergessen, die Lampe zu löschen? Aber gewöhnlich achtete die Mutter sorgsam darauf, dass nicht ein Tropfen Petroleum mehr als nötig verbraucht wurde.
Ach, was ging es sie an! Sophie schloss die Augen wieder. Doch der Gedanke an den schmalen Lichtstreif ließ sie nicht los. Endlich erhob sie sich leise. Es war schließlich ihre Pflicht, diese unnötige Verschwendung zu verhindern.
Vorsichtig tastete sie sich zur Tür, öffnete sie leise. Schlagartig blieb sie stehen: Die Mutter saß mit dem Rücken zu ihr am aufgeklappten Sekretär über irgendwelchen Papieren.
„Ach, du bist hier!“, sagte Sophie.
Die Mutter zuckte zusammen und schob hastig die Papiere übereinander, die auf der Schreibklappe ausgebreitet lagen. Alte vergilbte Zeitungsausschnitte, auf einem von ihnen sah Sophie neben einem Kreuz den Namen ihres Vaters. Sie trat näher.
„Man klopft an, wenn man ein Zimmer betritt!“, erklärte die Mutter mit harscher Stimme und ließ die Zeitungsausschnitte in einer Mappe verschwinden. Doch einen flüchtigen Blick auf eine der Überschriften hatte Sophie noch erhascht. Hatte da nicht gestanden: Duell im Morgengrauen? Die Mutter klappte die Schreibplatte hoch und drehte den Schlüssel herum.
Sophie stand wie gelähmt. Der Name des Vaters, das Kreuz — seine Todesanzeige ... Duell im Morgengrauen. Ihr Herzschlag schoss in die Höhe, lange bevor ihr Verstand eine Verbindung zwischen beidem herstellte.
„Mutter“, fragte Sophie, kaum wollten sich die Worte formen, „Mutter, was heißt das, was stand da von einem Duell?“
„Geh ins Bett!“, war die Antwort der Mutter.
Doch der Gedanke, der sich blitzartig in Sophie festgesetzt hatte, ließ sich nicht mehr zurückdrängen. Sie musste es wissen, aber es war unmöglich, es auszusprechen. Sie nahm all ihren Mut zusammen und fragte doch nicht mehr als: „War da nicht auch Vaters Todesanzeige?“
„Ich habe gesagt, du sollst ins Bett gehen!“, wiederholte die Mutter in dem Ton, der jedes weitere Beharren von vornherein zum Scheitern verdammte, versenkte den Schlüsselbund in ihrem Morgenmantel, nahm die Lampe vom Tisch und schritt an Sophie vorbei durch die Tür. „Komm endlich!“
Dieses Schweigen, mit dem die Mutter Fragen überging, die sie nicht beantworten wollte, Sophie kannte es zur Genüge. Wie in einer Festung verschanzte die Mutter sich dahinter. Mit ihr konnte man nicht reden.
Ohne ein weiteres Wort ging Sophie wieder zu ihrem Bett, ließ sich darauf nieder, mit steifen Bewegungen, als sei sie eine Puppe.
Ein Duell. Schlaflos lag sie da und starrte ins Dunkel. War ihr Vater bei einem Duell getötet worden?
Oder — Sophie drückte die Faust an ihre Lippen — bildete sie sich das alles ein? War es nur ein Zufall, dass die Todesanzeige des Vaters zwischen Zeitungsberichten über ein Duell gelegen hatte? War es vielleicht gar nicht seine Todesanzeige gewesen, hatte sie sich getäuscht, sie hatte ja nur einen ganz kurzen Blick auf die Papiere geworfen? Hatte die Mutter vielleicht nur nicht geantwortet, weil sie verärgert über die nächtliche Störung gewesen war, über das unhöfliche Hereinplatzen ins Zimmer? Aber wie überhastet sie die Zeitungsausschnitte in die Mappe geschoben hatte. Als wollte sie sie verbergen.
Und warum umgab so ein seltsames Schweigen den Tod des Vaters? Was Sophie bisher hingenommen hatte, ohne es weiter zu hinterfragen, erschien ihr auf einmal höchst verdächtig. An Vaters Todestag wurde der Familiengruft ein Besuch abgestattet, sein Bildnis mit einem Trauerflor geschmückt und bei der Morgenandacht seiner gedacht. Doch wäre es nicht nur natürlich, ja geradezu selbstverständlich gewesen, dass die Mutter zu diesen Gelegenheiten erzählt hätte, wie und woran der Vater gestorben war? Aber das hatte sie nicht getan. Niemals war die Rede davon gewesen, wie der Vater ums Leben gekommen war, damals, an jenem 6. März vor inzwischen elfeinhalb Jahren ...
Und auf einmal war sie da, die lange verschüttete Erinnerung, und Sophie war wieder jenes kleine Mädchen, das vor namenloser Angst keinen Schlaf fand, das zitternd in seinem Kinderbett lag:
Die Schritte des Vaters im Herrenzimmer nebenan, hin und her, hin und her. Die bedrohliche Stille. Dann wieder die Schritte.
Warum schlief die Mutter? Sie musste doch wissen, dass man in einer Nacht wie dieser nicht schlafen durfte! Wenn der Lichtstreifen die linke Ecke erreichte, würde ein schreckliches Unglück geschehen, etwas Unbekanntes, Unvorstellbares. Konnte man den Mond nicht aufhalten?
Der Vater hatte sie so angesehen, als sie ihm gute Nacht gewünscht hatte ... Und sie plötzlich an sich gerissen und gedrückt, so fest, dass sie gar keine Luft mehr bekommen hatte ... Und sie genauso plötzlich von sich geschoben und mit einer Stimme gesagt, mit einer Stimme, die er noch nie gehabt hatte: Geh schlafen, meine kleine Sophie! Und wenn du dein Nachtgebet sprichst, dann sprich es auch für mich!
Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm. Lieber Gott, mach Papa fromm, dass er in den Himmel komm, dass er in den Himmel komm, dass er in den Himmel komm ...
Nein! Sie wollte schreien. Sie wollte aufspringen, nach nebenan rennen, sich an Papa klammern, ihn festhalten. Sie wollte Mama aus dem Schlaf rütteln. Aber sie durfte nachts nicht schreien, und sie durfte nicht aufstehen, und außerdem waren ihre Beine so schwer, sie konnte sie nicht bewegen, mit unsichtbaren Stricken waren sie ans Bett gefesselt.
Da ging nebenan die Tür, ganz sacht. Sie lauschte mit angehaltenem Atem. Papa war im Flur. Er stand vor ihrem Zimmer, lange. Wenn er doch hereinkommen würde! Sie wollte nach ihm rufen, es ging nicht, kein Laut kam über ihre Lippen. Wenn er hereinkam, dann wurde alles gut. Aber er kam nicht herein. Leise entfernten sich seine Schritte, leise fiel die Wohnungstür ins Schloss. Der Streifen Mondlicht berührte die Ecke. Und aus der Ecke kroch ein furchtbares Ungeheuer, senkte sich auf ihre Brust und erdrückte sie.
Sie war schuld daran, dass Papa gegangen war. Sie hätte rufen müssen.
Sophie lag reglos, atemlos. Alles war wieder da: das endlose Grauen jener fernen Nacht, die unbeschreibliche Angst und Qual des Kindes, das sie gewesen war. Und dann erinnerte sie sich an noch etwas, an das, was diese schreckliche Nacht beendet hatte. Sie musste damals doch wieder eingeschlafen sein, denn sie sah sich, das Kind, plötzlich beim Scheppern der Türglocke aufschrecken, sah sich im Bett sitzen, spürte, wie ihr das Herz bis zum Hals klopfte, wie ihr der Mund ausgedörrt war:
Das Scheppern der Türglocke — eine fremde Stimme — dann Mamas Stimme — und da, was für ein Schrei! Es war Mama, die da schrie, und doch nicht Mama, es klang ganz fremd. So schrill, so, so ... Mama schrie und schrie und schrie und hörte überhaupt nicht mehr auf.
Unwillkürlich fasste Sophie sich an die Ohren. Sie meinte ihn immer noch zu hören, nach so vielen Jahren, diesen rasenden, nicht enden wollenden Schrei.
Auf einmal passte alles zusammen. Eines fügte sich zum anderen: die dunkle Angst, die vage schreckliche Vorahnung, die sie als Kind empfunden hatte, die Bitte des Vaters, in ihr Nachtgebet eingeschlossen zu werden, sein unruhiges Hin und Herwandern im Zimmer, der Schrei der Mutter, die Zeitungsausschnitte — Duell im Morgengrauen.
Es mussten die Nacht und der Morgen des 6. März 1875 sein, woran sie sich da erinnerte. Ihre Mutter war keine Frau, die aus nichtigem Anlass zu schreien pflegte. Sophie konnte sich nicht erinnern, ihre Mutter jemals sonst schreien gehört zu haben.
Wie war dieser Morgen weitergegangen? Was war danach geschehen? Was hatte man ihr gesagt? Doch sosehr sie sich auch das Hirn zermarterte — die Erinnerung an den Todestag des Vaters brach ab mit dem Schrei der Mutter.
Alles trug sie zusammen, was ihr Gedächtnis über die Monate danach hergeben wollte. Der Vater ist im Himmel, hatte es geheißen, das wusste sie noch, und: Er liegt in der Familiengruft. Aber das hatte für sie nicht zusammengepasst, denn beides zugleich hatte sie sich nicht vorstellen können: dies enge, kalte, düstere Gelass auf dem Friedhof, das von einem schmiedeeisernen Gitter und von einem steinernen Engel mit mächtigen Schwingen bewacht wurde — und den Himmel. Das Nächste, woran sie sich erinnerte, war der Auszug aus der großen Wohnung in die kleine hier, in der es kein eigenes Zimmer mehr für sie gegeben hatte und keinen Platz für ihr Puppenhaus und ihren Kaufmannsladen, und an das Verschwinden von Mousse au Chocolat, Bayerischer Creme und anderen Köstlichkeiten von ihrem Speiseplan.
Wann hatte sie verstanden, dass ihr Vater niemals wiederkommen würde? Wann hatte sie begonnen, ihn zu vergessen?
Es war nicht viel, was ihr von ihm geblieben war, Bruchstücke nur von Szenen: wie er ihr Zungenbrecher beibrachte, Fischers Fritze fischt frische Fische, und so warm lachte, wenn sie sich dabei verhaspelte, wie sie an seiner Hand durch den Tiergarten hüpfte oder vor ihm auf dem Pferd saß im Widerstreit zwischen Angst vor der Höhe, Vertrauen in seine sicheren Arme und Glück über diese Nähe zu ihm. Und vor allem seine Stimme, diese liebe Stimme, die sie so entsetzlich vermisst hatte und für die sie auch seine böse in Kauf genommen hätte und selbst das Pfeifen des Rohrstocks, der schrecklich auf den Fingern gebrannt hatte.
Fröstelnd zog sie die Decke bis ans Kinn. Sie schloss die Augen, vergrub sich ins Kissen. Wenn sie nur diese Gedanken lassen und endlich wieder einschlafen könnte! Sie versuchte sich abzulenken. Gewöhnlich, wenn sie nicht schlafen konnte, dachte sie sich Geschichten aus, die sie über viele Nächte fortspann, ganze Romane über Mädchen, denen das Schicksal übel mitspielte und die dann doch ihr Glück machten. Aber sosehr sie ihre Gedanken auch in eine solche Geschichte zu zwingen versuchte, es gelang ihr nicht. Immer und immer wieder fanden sie sich dort ein, wohin sie nicht sollten.
War ihr Vater wirklich bei einem Duell ums Leben gekommen? Und selbst wenn es so war, warum sprach die Mutter dann nicht darüber? Duelle wurden ausgetragen, um der Ehre Genüge zu tun oder die Ehre wiederherzustellen. Also war doch auch ein Tod bei einem Duell etwas Ehrenvolles und nichts, was man verschweigen musste?
In den Fächern des Sekretärs lag weggeschlossen, was ihr Auskunft geben würde. Aber den Schlüssel dazu trug die Mutter an ihrem Schlüsselbund, und den hatte sie stets bei sich, legte ihn nur zum Schlafen ab, und dann steckte sie ihn unter ihr Kopfkissen, als fürchte sie, von dem treuen alten Dienstmädchen bestohlen zu werden. Dabei war Frieda schon bald zwanzig Jahre bei der Mutter und so gut wie Familieninventar.
Vielleicht aber fürchtete die Mutter viel mehr die Neugier der eigenen Tochter.
Neugier? Sophie schüttelte den Kopf. Nein, das war es nicht. Es war etwas ganz anderes. Sie spürte plötzlich, dass sie nicht mehr leben konnte, ohne die Wahrheit über den Tod ihres Vaters zu erfahren.
Aus der Küche nebenan drang leises Rumoren. Frieda stand auf, um den Herd anzufeuern und ihr Tagwerk zu beginnen. Da war auf einmal ein Gedanke in Sophie: Frieda musste es wissen, Frieda war ja damals schon bei der Mutter in Stellung gewesen.
Sophie lauschte. Die Geräusche aus der Küche, die tiefen Atemzüge der Mutter. Die Mutter schlief. Unendlich langsam und leise erhob sich Sophie und schlich behutsam zur Küchentür, drückte ganz vorsichtig die Klinke herunter und schob sich in die Küche.
Frieda kniete im Nachthemd vor dem Ofenloch des Herdes, ein graues Wolltuch über den Schultern. Nun fuhr sie zusammen und blickte auf. „Mein Gott, gnädiges Fräulein, haben Sie mich erschreckt! Warum liegen Sie denn nicht im Bett, es ist doch noch so früh am Morgen!“
„Ich kann nicht schlafen, Frieda“, erwiderte Sophie und setzte sich auf einen Küchenstuhl. „Mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf.“
„Ach ja, die Gedanken. Da kann man nichts machen“, meinte Frieda. „Die kommen, wenn man sie am wenigsten brauchen kann. Warten Sie nur, bis ich das Feuer an habe und einen heißen Kaffee gekocht, dann wird es gleich besser. Und hier, wickeln Sie sich nur hinein, damit Sie sich nicht verkühlen!“ Damit zog sie die Decke aus ihrem Bett, das tagsüber zusammengeklappt als Küchentisch diente, und hielt sie Sophie hin. Sophie legte sich folgsam die Decke über die Beine.
„Du könntest mir helfen, Frieda“, meinte sie.
„Wollen Sie denn wirklich schon aufstehen, und ich soll Ihnen das Korsett zubinden?“, erkundigte sich diese.
„Nein, nein, nicht so ...“ Sophie stockte. Dann begann sie neu: „Du bist doch schon so lange bei uns, schon, als mein Vater noch lebte.“
„Das will ich meinen“, erklärte die Dienstmagd befriedigt und schob Holz in den Ofen, half mit dem Schürhaken nach. „Ein großes Haus wurde damals gemacht, zwei Mädchen und der Bursche vom Herrn Major waren wir. Ich für mein Teil war die Köchin, reichlich zu tun gab es, es waren ja oft Gäste da, aber trotzdem hab ich Sie großgezogen. Das Zimmermädchen sollte sich ja eigentlich um Sie und Ihren Bruder kümmern, aber das war ja noch so ein junges Ding, und Sie waren ja am liebsten bei mir in der Küche. Ja, und als dann das Unglück kam, da konnte ich Sie doch nicht allein lassen, sie waren mir ja wie mein eigenes Kind. Ihr Bruder ist dann ja bald nach Potsdam in die Kadettenanstalt gekommen, aber meine kleine Sophie — ach, was waren Sie für ein liebes Ding! Und immer so traurig. Es war aber auch ein Unglück, wie der Herr Major gestorben ist und auf einmal kein Geld mehr da war.“ Seufzend schüttelte Frieda den Kopf.
„Danach wollte ich dich fragen“, meinte Sophie rasch. „Nach dem Tod meines Vaters. Du musst doch wissen, ob er ...“ Sie stockte. Ob er bei einem Duell getötet worden ist, hatte sie sagen wollen, aber sie brachte die Worte nicht über die Lippen. „Woran er gestorben ist“, beendete sie ihre Frage.
Frieda stand auf und wischte sich die rußigen Hände an einem Putzlappen ab. „Mein Gott, gnädiges Fräulein“, sagte sie und warf einen unruhigen Blick zur Tür, „machen Sie sich nicht unglücklich, und mich nicht noch mit! Die gnädige Frau will nicht, dass darüber gesprochen wird, verboten hat sie es mir, ach, was sag ich, schwören hab ich's ihr müssen! Und sie wird schon wissen, warum es so sein muss und besser ist für Sie, die Frau Major ist eine so vornehme und gebildete Dame, und ich, was bin schon ich! Und jetzt, nichts für ungut, gnädiges Fräulein, aber ich muss mich jetzt anziehen.“
Schweigend stand Sophie auf, verließ leise die Küche, schlich sich zu ihrem Bett zurück und legte sich wieder hin, verkroch sich unter der Decke. Ihr war so kalt, dass sie zitterte.
Wenn den Vater der Schlag getroffen hätte oder wenn er bei einem Reitunfall gestorben wäre, dann hätte die Mutter doch Frieda nicht schwören lassen, nicht darüber zu sprechen. Dieses Geheimnis, das die Mutter aus Vaters Tod machte — sprach nicht das allein schon eine deutliche Sprache?
Sophie presste die Zähne aufeinander. Wenn sie nur Genaueres wüsste! Dieser Schrei ihrer Mutter ...
Das war ja wohl ein Anlass, der selbst eine aus gräflicher Familie geborene Baronin zum Schreien bringen konnte: die Nachricht, dass der Gatte bei einem Duell getötet worden war, einem Duell, von dem die Mutter nicht einmal gewusst hatte. Denn sie konnte nicht davon gewusst haben, nie hätte sie sonst den Vater aus dem Haus gehen lassen, ohne Abschied von ihm zu nehmen. Man konnte über die Majorin von Zietowitz denken, was man wollte, eines war sicher: Sie war sich immer im Klaren darüber, was sich ziemte und was einer jeden Situation angemessen war. Und die Mutter hatte nicht Abschied genommen, wortlos hatte sich der Vater aus der Wohnung geschlichen, dafür war sie, das Kind, Zeuge.
Ein Duell. Leicht hatte der Vater es sich nicht gemacht, die ruhelose Nacht im Herrenzimmer sprach für sich. Zu denken, dass der Vater da seinen möglichen Tod vor Augen gehabt hatte — oder die mögliche Tötung des anderen ... War der Vater von diesem unbekannten anderen tödlich beleidigt worden, gekränkt auf eine Weise, die nur durch Blut bereinigt werden konnte — und hatte ihn deshalb fordern müssen? Was um alles in der Welt konnte es gewesen sein, was zu dieser Tragödie geführt hatte?
„Papa“, flüsterte Sophie tonlos, sie spürte Tränen aufsteigen, „Papa, warum?“
„Bitte, die Damen!“, rief die Tanzlehrerin. Sophie erhob sich mit den anderen jungen Mädchen. Gemeinsam stellten sie sich in einer Reihe in der Mitte des Saales auf. Es war so wie schon oft im privaten Tanzzirkel, der vierzehntäglich im Hause Stolze stattfand. Und doch ganz anders. Denn heute waren sie nicht unter sich, nur die Mädchen und die Tanzlehrerin und die Mütter, die von ihren Plätzen an der Fensterseite des Saales aus alles beobachteten. Heute saßen dort drüben an der anderen Längsseite des Saales die Herren.
Der erste gemischte Tanzzirkel. Sophie hatte es kaum glauben können, als Cecilie ihr das Vorhaben der Eltern Stolze mitgeteilt hatte, Herren zum Tanzzirkel einzuladen. Noch weniger hatte sie zu hoffen gewagt, dass die Mutter ihre Teilnahme erlauben würde. Doch darin hatte sie sich getäuscht. Die Mutter hatte sogar eines ihrer alten Kleider hervorgeholt und damit begonnen, ein Ballkleid für Sophie daraus zu schneidern — denn ein Ball würde am Abschluss des gemischten Zirkels stehen. Und auch für heute war Sophies bestes Kleid aus weißem Musselin eigens mit Applikationen von selbst gefertigten kleinen Röschen aus roter Atlasseide versehen worden, beinahe wie neu sah es aus.
Bänder aus Atlasseide waren teuer, sie hatten ein Loch in die schmale Haushaltskasse gerissen. Schon daran sah man, welchen Wert die Mutter diesem gemischten Tanzzirkel beimaß, auch wenn sie mit schmalen Lippen gesagt hatte: Ich hätte einen Tanzzirkel in einem Haus von besserer gesellschaftlicher Stellung vorgezogen. Neureicher Fabrikant — was will man da erwarten
Und wenn schon! Cecilie war ihre Freundin, die beste Freundin aus der gemeinsamen Schulzeit in der Höheren Töchterschule. Und wo sonst als im Haus Stolze hätte sie die Gelegenheit, einen Tanzzirkel zu besuchen, ohne dafür zu bezahlen? An Bezahlung war nicht zu denken. Sie hatte ja auch schon aus Geldmangel auf das übliche Jahr Mädchenpensionat nach Abschluss der Höheren Töchterschule verzichten müssen, und damit auf den „gesellschaftlichen Schliff“, der dort vermittelt wurde. Dunkel ahnte sie freilich, dass ihr dabei vor allem Geselligkeit und Vergnügen entgangen waren, denn Schliff erhielt sie von ihrer Mutter mehr, als es sämtliche Lehrerinnen eines Mädchenpensionats bewerkstelligen konnten.
„Erste Position!“
Sie rückten sich zurecht, setzten die Füße in Positur. Aus den Augenwinkeln bemerkte Sophie, wie die anderen Mädchen immer wieder zu den Herren hinüber- und rasch wieder wegsahen, wie sie einander zulachten, hörte sie kichern. Sophie kicherte nicht. Ihr Kopf blieb in der vorgeschriebenen Haltung erhoben, ihr Blick ging in eine unbekannte Ferne, ihr Mund lächelte unverbindlich freundlich. Das Herz aber klopfte bis zum Hals.
Sophie war sich bewusst, von Tanzlehrerin und Tanzlehrer kritisch beobachtet zu werden, viel mehr aber noch von ihrer Mutter, der nicht die geringste Kleinigkeit entgehen und die jeden kleinsten Fauxpas gnadenlos kommentieren würde. Die Tanzschritte unter den Augen der Mutter zu üben, die Haltung nach deren Anweisungen immer wieder zu korrigieren, war in den vergangenen Wochen willkommene Abwechslung zum stundenlangen Sticken gewesen, die einzige Abwechslung, welche die Mutter neben gelegentlichem Singen und Klavierspielen geduldet, nein, sogar gefordert hatte. Das Schicksal einer jungen Dame entscheidet sich im Ballsaal, pflegte die Mutter neuerdings zu sagen. Stolz solle Sophie wirken, unnahbar, zugleich aber ungekünstelt und liebreizend und was nicht noch alles. Wie das zusammengehen sollte, sagte die Mutter nicht.
Doch viel mehr noch als der Beobachtung durch Mutter und Tanzlehrer war Sophie sich der Blicke der Herren bewusst. Sie brannten geradezu auf ihrer Haut. Hier sich zu zeigen, als würde man ihnen vorgeführt ...
„Zweite Position!“
Nun hatte sie ihre Mutter im Rücken, war für einige Atemzüge deren direkter Kontrolle entronnen. Den Blick über die Herren schweifen lassen, nur einmal, ganz kühl, als sähe man nichts.
Der Hochgewachsene dort am Anfang der Reihe neben der Tür …
Für den Bruchteil einer Sekunde nahm sie ihn wahr, nicht länger als die anderen, und doch konnte sie danach sein Bild in sich abrufen — und nur seines. Sie tat es in jeder Einzelheit. Seine braunen Haare, fast schwarz. Seine dunklen Augen, sehr groß. Hatte nicht ein Hauch von Melancholie in ihnen gelegen? Sein schmales Gesicht. Fein schien es ihr, edel, und die markante Nase darin machte es nur noch interessanter. Klug war es jedenfalls, nein, mehr noch: geistvoll. Und wie vollendet sein schwarzer Anzug saß, so etwas war Maßarbeit, das sah man ...
„Dritte Position! Und nun die Armbewegungen! Auf die Handstellung achten, die Finger! Mehr Eleganz, meine Damen, Eleganz! Perfekt, Fräulein von Zietowitz, einfach perfekt! Machen Sie es doch bitte noch einmal vor! Meine Damen, nehmen Sie sich ein Beispiel an der Baronesse!“
Gleichmütig lächeln, nicht zeigen, wie man sich freut!
Sophie vollführte die Figur, wie sie es unzählige Male geübt hatte: anmutig und doch stolz.
Nun weiß er, wer ich bin. Und wenn er mich bisher nicht gesehen hat, jetzt ist er aufmerksam auf mich geworden.
Dann mussten sie wieder Platz nehmen, und die Herren waren an der Reihe. Der Tanzlehrer machte vor, wie sie sich ihrer auserwählten Dame zu nähern hatten, wie zu verbeugen — nicht zu tief und nicht zu oberflächlich, mit Leichtigkeit, Würde und Eleganz —, wie sich vorzustellen und wie um den Tanz zu bitten. Dann forderte er den ersten Herrn auf, den Anfang zu machen. Es war er.
Quer durch den Saal kam er herüber, genau auf sie zu. Nicht ihm entgegensehen. Nicht merken lassen, dass ich auf ihn warte.
„Gestatten, Samuel Rosenstock! Dürfte ich Sie um den Tanz bitten, gnädiges Fräulein?“
Er verneigte sich nicht vor ihr. Er verneigte sich vor Cecilie neben ihr.
Ihr Mund war trocken. Nicht die Enttäuschung sehen lassen. Wenn meine Mutter es merkt ...
Habe ich ihm nicht gefallen?
Ach, was für ein Unsinn! Cecilie ist die Tochter des Hauses. Natürlich musste er Cecilie auffordern! Es wäre ein Affront gewesen, wenn sie nicht als Erste gewählt worden wäre, und dazu ist er viel zu höflich. Es hat nichts zu bedeuten, nichts. Dann werde ich eben von dem Nächsten gewählt. Wenn wir das zweite Paar sind, tanze ich bei der Gavotte in der Reihe direkt hinter ihm und komme beim Moulinet mit ihm in eine gemeinsame Gruppe ...
Der zweite Herr wählte Ludmilla, die durch häufiges Kichern und Tuscheln aufzufallen pflegte. Gut, der dritte Platz mochte noch angehen, auch wenn die Mutter damit nicht zufrieden sein würde ...
Der dritte Platz ging nicht an sie.
War ihr Kleid trotz der Atlasröschen doch zu schäbig? Oder hatte sie die Haare zu straff aufgesteckt, hätte ein paar Locken mehr herauszupfen sollen? Was würde sie von der Mutter zu hören bekommen, so wenig ehrenhaft abgeschnitten zu haben!
Einer nach dem anderen traten die jungen Herren jeweils auf eine junge Dame zu, verlegen oder stümperhaft die einen, überforsch die anderen, wurden korrigiert, mussten die Vorstellung wiederholen. Eine junge Dame nach der anderen wurde engagiert.
Schließlich saßen nur noch Friederike und sie auf ihren Stühlen. Friederike Meier, die Pastorentochter, deren Position als Mauerblümchen vom ersten Augenblick an klar gewesen war, und sie, Baronesse Sophie von Zietowitz.
Was war verkehrt an ihr? Sie war nicht hässlich, nein, obwohl Cecilie natürlich maßlos übertrieb, wenn sie von ihrer Schönheit redete, aber hässlich war sie doch nicht, oder? Die Nase war vielleicht ein wenig zu schmal und zu spitz, ihre Lippen etwas zu voll. Aber immerhin hatte sie eine makellos reine und weiße Haut.
Was um alles in der Welt war es?
Friederike auszustechen konnte man beim besten Willen nicht mehr als Erfolg werten. Friederike hatte eine fahle Haut und ein aufgedunsenes Gesicht, und, was schwerer wog, alles an Friederike roch nach Verliererin. Die eingesunkene Art, wie sie auf ihrem Stuhl saß und ihr Taschentüchlein knetete, als wolle sie vor Unglück im Boden versinken!
Sophie richtete sich noch ein wenig stolzer auf. Die Muskeln im Gesicht taten schon weh von all dem Lächeln. Dennoch lächelte sie weiter, lächelte dem Herrn entgegen, der da mit ungelenken Schritten auf sie zukam, lächelte, ohne ihn anzusehen, denn das wäre unschicklich gewesen, und unschicklich würde sie nicht werden. Ein Zietowitz hatte noch nie unehrenhaft ein Schlachtfeld verlassen — auch nicht, wenn die Schlacht verloren war. Der Herr stellte sich Friederike vor.
Haltung bewahren. Würde. Lächeln. Mit Leichtigkeit und selbstverständlicher Höflichkeit dem letzten Herrn antworten, ihm, dem nun nichts anderes mehr übrig blieb, als sie zu engagieren.
„Gestatten, Walter Wohlschlägel! Dürfte ich Sie um den Tanz bitten, gnädiges Fräulein?“
Sich erheben, sich aufstellen, tanzen. Gavotte, Menuett. Windungen und Wendungen. Zierlich abgemessene Komplimente. Schreiten in der Reihe, die rechte Hand rafft das Kleid, lächeln, lächeln. Moulinet — in einer anderen Vierergruppe als Samuel Rosenstock. Nicht ein falscher Schritt, kein einziges Stolpern oder Verhaspeln, vorbildliche Körperhaltung. Lächeln. Glücklich erscheinen und ungekünstelt und stolz.
Was um Himmels willen war falsch an ihr? Was war es, was sie noch weniger liebreizend machte als Friederike, da doch ihre Tanzkünste außer Zweifel standen, sie sogar öffentlich als Vorbild hingestellt worden war? Sie wollte weinen. Sie lächelte. Und immer weiter.
Irgendwann war auch dieser Spätnachmittag vorbei, die erste Stunde des gemischten Tanzzirkels, auf die sie sich so sehr gefreut hatte.
Frieda wartete schon vor dem Haus, als Sophie mit der Mutter ins Freie trat. Schweigend gingen sie nebeneinanderher, gefolgt von Frieda. Schweigend, denn noch waren andere Teilnehmer des Zirkels in der Nähe, noch konnten sie belauscht werden. Doch sobald sie außer Hörweite waren, würde die vernichtende Kritik der Mutter beginnen. Das Urteil, das nichts anderes als ein Todesurteil bedeuten konnte: Das Schicksal einer jungen Dame entscheidet sich im Ballsaal ...
Doch das war jetzt schon alles gleich. Nichts, was die Mutter sagen mochte, konnte schlimmer sein als das, was in ihrem eigenen Inneren nagte.
„Ich bin sehr stolz auf dich“, sagte die Mutter.
Sophie blieb unter der Gaslaterne stehen, starrte ihre Mutter an. „Aber“, sie stockte, „aber, wie kannst du das sagen ...?“
Die Mutter legte ihr die Hand auf den Arm. „Es war hart für dich, ich weiß“, sagte sie sanft, so sanft hatte Sophie die Stimme der Majorin kaum je gehört. „Aber wie du das durchgestanden hast, mit einem Lächeln, das nicht einmal gekünstelt wirkte — alle Achtung! Noblesse oblige, mein Kind. Heute hast du dem Namen Zietowitz alle Ehre gemacht.“
Da brach Sophie in Tränen aus. „Aber warum“, stammelte sie, „warum als Letzte, nicht einmal Friederike ...“
Die Mutter lächelte. „Warum? Meine liebe Sophie, das liegt klar auf der Hand, und glaub mir, ich sage das nicht aus falschem Mutterstolz oder weil ich dich trösten will: Keiner der Herren hat sich an dich herangetraut. Sie haben alle gespürt, dass du etwas Besseres bist, dass du zu gut bist für sie. Auf einem Ball der Gesellschaft hättest du brilliert. Aber im Hause Stolze — nun ja.“
Die Mutter nahm Sophies Hand, legte sie sich auf den Unterarm, ging so Arm in Arm, sprach dabei weiter: „Wäre auch nur ein einziger Kadett unter den Herren gewesen! Oder ein Fähnrich aus einem guten Regiment! Dann wäre es für dich ganz anders verlaufen, das kann ich dir versichern. Samuel Rosenstock, beileibe! Übrigens kam mir vor, als wäre er dir nicht gleichgültig.“
Sophie stockte. Nur einen winzigen Augenblick verharrte ihr Fuß beim Gehen mitten in der Bewegung, doch der Mutter entging es nicht.
Mit einem halb befriedigten, halb ironischen Lächeln nahm diese zur Kenntnis, ins Schwarze getroffen zu haben, und fuhr in süffisantem Ton fort: „Man kann sich auch durch Wegschauen verraten, meine Liebe, nicht nur durch Hinschauen. Nun, ich glaube nicht, dass das außer mir jemand gemerkt hat; die anderen Mütter — über die hohe Schule der gesellschaftlichen Erfahrung und Etikette verfügen sie nicht gerade. Kurz, von diesen Damen ist keine allzu scharfe Beobachtungsgabe zu befürchten. Aber, Sophie, ich bitte dich: ein Jude! Sohn eines Kleiderfabrikanten! War dir das denn nicht sofort klar? So etwas sieht man doch! Völlig indiskutabel. Sein Vater ist wahrscheinlich ein Geschäftsfreund von Herrn Stolze. Nichts gegen Personen mosaischen Glaubens, aber sie sind nun einmal zum Offiziersstand nicht zugelassen. Als gesellschaftlicher Umgang für dich absolut unpassend. Es spricht immerhin für ihn, dass er sich dessen bewusst war — und die anderen Herren nach ihm auch.“
Etwas wuchs in Sophie, ein Druck tief im Innern, etwas, was ihre Brust ausfüllte und immer weiter anschwoll, was ihr das Gefühl gab, gleich laut schreien zu müssen. Sie presste die Zähne fest aufeinander, hielt die Luft an, solange sie konnte.
Die Mutter sprach unaufhörlich weiter: „Das Ehepaar Stolze hat sich ja alle Mühe gegeben, präsentable Herren für den Zirkel zu finden — Primaner des nächstgelegenen Gymnasiums die meisten, wie mir Frau Stolze im Vertrauen mitteilte —, aber unsere Kreise sind das wahrhaftig nicht. Dazu ist der Reichtum des guten Herrn Stolze zu neu, der Geruch des Emporkömmlings verfliegt nicht so schnell. Das Kleinbürgerliche haftet ihm an, auch wenn er noch so viel Geld hat, er hat keine Kontakte zu den guten Familien. Du bist ja auch nur deswegen ein von Cecilies Eltern so gerngesehener Gast, weil unser Name sich wie ein Aushängeschild für den gesellschaftlichen Stellenwert des Hauses Stolze macht. Aber gleichviel — uns fehlen nun einmal die Mittel, um wählerisch zu sein. Man muss Opfer bringen. Zum Üben geht dieser Tanzzirkel für dich an. Bald beginnt die Ballsaison, und diesen Winter wirst du dabei sein. Ich werde dafür sorgen, dass du eingeladen wirst — in die richtigen Häuser —, und dafür brauchst du Erfahrung auf dem Parkett. So wie du dich heute gehalten hast, gibst du Anlass zu den größten Hoffnungen.“