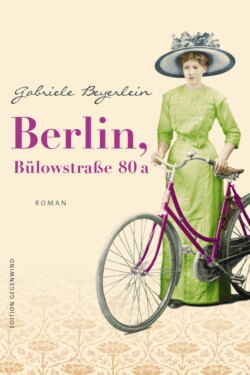Читать книгу Berlin, Bülowstraße 80 a - Gabriele Beyerlein - Страница 6
1.3
Оглавление„Meine sehr verehrte Baronesse, so geht das aber nicht!“ Von der Untersuchung der Mutter kommend, trat Doktor Schneider in den Salon und betrachtete Sophie, die mit ihrer Stickerei am Fenster saß, mit lächelndem Kopfschütteln.
Verwundert sah sie auf und hob fragend die Augenbrauen. Wovon sprach er?
„Ich bin zwar nicht Ihr Hausarzt, sondern nur der Ihrer verehrten Frau Mutter, aber dabei soll es auch bleiben, nicht wahr? Sie wollen sich doch bitte sehr nicht in einen Zustand bringen, dass auch Sie meinen ärztlichen Rat nötig hätten?“
„Setzen Sie sich doch einen Moment, Herr Doktor“, erwiderte Sophie und wies auf einen Sessel. „Ich muss gestehen, dass ich Ihnen nicht ganz folgen kann. Wie steht es um meine Mutter?“
„Die Frau Major ist auf dem Wege der Besserung, aber das ist ein langer und mühsamer Weg. Rekonvaleszenten in diesem Stadium werden leicht ungeduldig. Statt dankbar für die überstandene Gefahr und die unermüdliche Hilfe der Pflegenden zu sein, hadern sie leicht mit ihrem Schicksal und stellen immer neue Ansprüche, so ist nun einmal die menschliche Natur, davon weiß jeder erfahrene Arzt ein Lied zu singen. Kurz, ich müsste mich schon sehr wundern, wenn Sie mir jetzt sagen würden, die Pflege der verehrten Frau Mama sei ein Leichtes.“
Sophie lachte und sah ihn an. Wie gut das tat, solche Worte — und dann dieses leise Lächeln um seine Augen, gepaart mit etwas anderem, was mochte es sein, vielleicht gar Bewunderung für ihre Leistung? „Nun, dann will ich mal nicht verschulden, dass Sie heute an Ihrer Erfahrung zweifeln müssen“, erwiderte sie lachend. „Ich gebe zu, Sie haben recht.“
Er stimmte in ihr Lachen ein. Wie sie das auf einmal miteinander verband, dieses Lachen. Für einen Augenblick war alle Schwere vergessen. Doch dann verschwand das Lachen aus seinem Gesicht, und er beugte sich vor. „Im Ernst: Sie haben Großartiges geleistet, Fräulein von Zietowitz. Und Sie sind von der Pflege noch immer im höchsten Maße beansprucht. Verzeihen Sie, wenn ich den Blick des Arztes nicht ganz abstellen kann, auch wenn er gar nicht gefragt ist, aber Sie sehen erschöpft aus. Sie sollten die Stunden, in denen Ihre Patientin schläft, zur Erholung nutzen und nicht zur Arbeit.“ Damit machte er eine Kopfbewegung auf die Stickerei hin.
Sophie spürte Röte ins Gesicht steigen. War er dahintergekommen, dass sie hier stickte, um Geld zu verdienen? Ein Arzt gewann leicht einen Blick hinter die Fassade, war sie nicht wachsam genug gewesen? „Aber das ist doch keine Arbeit“, erwiderte sie rasch.
„Nicht? Nun, darüber ließe sich streiten, nicht wahr?“ Er schenkte ihr ein so warmes Lächeln, dass ihr Erschrecken verebbte. „Mag es für Sie ein standesgemäßer Zeitvertreib oder eine liebe Gewohnheit sein, oder wie immer Sie es nennen mögen, vom medizinischen Standpunkt aus ist es eine für die Augen, die Feinmotorik, die Wirbelsäule und die Aufmerksamkeit äußerst strapaziöse Tätigkeit und jedenfalls nicht der nötige Ausgleich für Ihren Einsatz bei der Pflege.“
Sie atmete tief auf. Er hatte ihr trübseliges Geheimnis nicht durchschaut, nichts gemerkt. Und — er hatte wirklich ein ernsthaftes Interesse an ihrem Ergehen! Gar an ihr selbst?
„Sie sollten lieber ein wenig ruhen, mit einer Freundin ein Stück spazieren gehen oder ein gutes Buch lesen“, fuhr er fort.
„Ich habe vor einiger Zeit angefangen, Krieg und Frieden zu lesen“, erklärte sie. „Das hat mir sehr gefallen.“
„Krieg und Frieden“, wiederholte er lebhaft. „Ein wundervoller Roman! Im Übrigen genau das Richtige in Ihrer Situation, wenn ich nur daran denke, wie aufopferungsvoll Natascha den verwundeten Fürsten Andrej pflegt.“
„So weit bin ich nicht vorgedrungen“, erwiderte Sophie. Draußen hörte sie den Türklopfer. Es würde doch nicht gerade jetzt Besuch kommen? „Das Buch war nur geliehen, ich musste es zurückgeben.“
„Wie schade!“, meinte er. „Dieser Roman gibt einen so hervorragenden literarischen Einblick in die ganze Weite, Buntheit und Tragik des Lebens. Am liebsten hätte ich ihn in einem Stück gelesen, aber bei meinem Beruf ...“
Da klopfte Frieda und meldete Herrn Oberst von Zietowitz an.
Der Onkel? Sonst hätte sie sich über seinen mehr als überraschenden Besuch gefreut, aber ausgerechnet jetzt!
Sie stand auf. Sofort erhob sich auch Doktor Schneider, und schon trat der Onkel herein. „Darf ich bekannt machen, Herr Dr. Schneider, der Hausarzt meiner Mutter, dem wir zu verdanken haben, dass sie nun wieder auf dem Wege der Besserung ist — Herr Oberst von Zietowitz, mein Onkel“, nahm Sophie die Vorstellung vor.
Die Herren verneigten sich voreinander und tauschten die üblichen Höflichkeiten, der Onkel erkundigte sich bei dem Arzt nach dem Befinden der Mutter, dann danach, ob er gedient habe, zeigte sich von der Antwort „Oberleutnant der Reserve, Artillerie, Kreuz für Tapferkeit vor dem Feind, vor Noisseville verwundet“ hocherfreut — der ganze Zauber des Augenblickes war unwiederbringlich dahin. Und dann verabschiedete Herr Doktor Schneider sich auch schon.
„Ich begleite Sie noch zur Tür!“, erklärte Sophie rasch.
„Aber nein, ich bitte Sie, ich finde hinaus“, wehrte er ab, doch sie beharrte darauf. An der Wohnungstür, im Dämmerlicht des kleinen Flures, standen sie einander gegenüber.
„Nun, dann bis morgen, Fräulein von Zietowitz, ich denke, von nun an wird es genügen, wenn ich einmal täglich vorbeischaue.“ Er neigte sich über ihre Hand.
„Ach!“, entfuhr es ihr. Sie wurde rot.
Er richtete sich wieder auf. Dieser Blick — bildete sie sich das nur ein?
„So etwa gegen drei Uhr ließe es sich gut einrichten“, fuhr er fort. „Wäre Ihnen das genehm?“
„Aber ja“, erwiderte sie möglichst beiläufig, um ihren Ausruf vergessen zu machen. „Dann kann ich Frieda sagen, sie soll eine Tasse Kaffee bereithalten.“
„Das wüsste ich sehr zu schätzen.“ Er lächelte ihr zu und ging.
Sie stand da und schaute auf die Tür, die sich hinter ihm geschlossen hatte.
Dann endlich erinnerte sie sich an den Onkel und eilte in den Salon.
„Na“, meinte dieser, „noch letzte Instruktionen erhalten, was? Diese Ärzte sind doch immer gleich, mein Hausarzt Rübestock ist nicht anders, alles muss haarklein nach ihrem Willen gehen, daraus ziehen sie ihre Existenzberechtigung. Obwohl — Oberleutnant, Kreuz, Noisseville: nicht schlecht. Die verehrte Schwägerin beweist in allem und jedem Standesbewusstsein, auch in der Auswahl ihres Arztes. Nun setz dich mal wieder, Sophie, ich muss mit dir reden! Karl war bei mir, bevor er wieder zu seinem Regiment abgereist ist, du hattest ihm ja telegrafiert, dass es mit deiner Mutter Spitz auf Knopf steht, hättest mir auch Bescheid geben können, Mädchen!“
Sie murmelte eine Entschuldigung.
„Schon gut, lass nur, Sophie! Und nun, da wir mal ganz unter uns sind, ohne die wachsamen Ohren und Augen der Frau Major, will ich dir mal eines sagen: Mit deiner Mutter und mir, nun, Schwamm drüber, sind alte Geschichten. Aber in der Not heißt es zusammenhalten, was? Du weißt, ich habe deinem Bruder die Kadettenanstalt bezahlt, mehr konnte ich beim besten Willen nicht aufbringen, aber das ist ja nun vorbei, und jetzt will ich mal ein bisschen was für dich tun. Lass die elende Stickerei, solange du deine Mutter pflegen musst, mir brauchst du nichts vorzumachen, ich kenne eure Situation! Und ich weiß schon, das Honorar für den Arzt und die Medizin, das geht ins Geld, und wahrscheinlich kannst du schon vor Sorge nicht schlafen, weil du nicht weißt, wo du es hernehmen sollst, und deiner Mutter ist jetzt damit nicht zu kommen. Hier, das wird wohl fürs Erste genügen“, und damit griff er in seine Geldtasche und zog drei Hundertmarknoten hervor.
Kritisch schaute Sophie sich im Salon um. Die Tänzerin aus Meissner Porzellan auf der Kommode stand so, dass man ihren abgebrochenen Fuß sah. Sophie drehte sie anders herum. Das Ölgemälde, das einen fernen Vorfahren — Enzo von Zietowitz — bei der Schlacht von Fehrbellin eindrucksvoll den Heldentod auf seinem zusammenbrechenden Pferd sterben ließ, hing schief, sie rückte es zurecht.
Auf manche Dinge achtete Frieda einfach nicht, wenn sie sauber machte, dafür fehlte ihr nun mal der Blick. Aber ansonsten strahlte der Salon wieder in einem fast vergessenen Glanz, dass selbst die Mutter nichts auszusetzen gehabt hätte. Der Kronleuchter glitzerte und funkelte, befreit von Rußspuren und Staub. Sie hatte Frieda zu einem Großputz des Zimmers angewiesen, denn es hatte sich bemerkbar gemacht, dass in den Tagen der schlimmsten Erkrankung der Mutter der Haushalt weitgehend zum Erliegen gekommen war. Dafür hatte sie am Vormittag die Pflege und Versorgung der Mutter ganz alleine übernommen.
Ein Blick auf die Standuhr — Viertel vor drei. Sophie trat vor den Spiegel und betrachtete kritisch ihre Frisur. Wie nachlässig sie in den vergangenen Tagen gewesen war, das Haar nur kurz zusammengedreht und aufgesteckt, oft genug ohne dabei überhaupt in den Spiegel zu schauen! Und mehr als einmal hatte Doktor Schneider sie ohne ihr Korsett im Morgenmantel gesehen, wenn er in den frühesten Morgenstunden seinen ersten Krankenbesuch abgestattet hatte. Nicht einen Gedanken hatte sie darauf verwandt, wie sie aussah und wirkte, es trieb ihr die Röte ins Gesicht.
Heute endlich waren die Haare frisch gewaschen, gelockt und zu einer so kunstvollen und sorgfältigen Frisur getürmt, wie sie das ohne Hilfe nur fertigbringen konnte. Und ihr Kleid hatte sie aufgebessert, indem sie ein Atlasröschen an den Ausschnitt genäht hatte, das sie von ihrem Tanzkleid abgetrennt hatte. An Tanzen war zurzeit ja sowieso nicht zu denken.
Sophie lauschte nach nebenan. Die Mutter schlief.
Sollte sie den Kaffeetisch decken? Ach nein, das würde doch irgendwie zu absichtsvoll wirken. Das Königlich Preußische Geschirr stand auf einem kleinen Silbertablett bereit, das war gerade recht. Die Kaffeekanne hatte sie zum Warmhalten auf den Ofen gestellt. Und die drei Gebäckstückchen, die sie Frieda hatte besorgen lassen, lagen auf dem Teller, als wären sie nichts Besonderes, sondern ganz selbstverständlicher Brauch hier im Haus. Einen Augenblick hatte sie ja auch an Torte gedacht, aber Torte ging entschieden zu weit.
Sie trat ans Fenster und schaute die Straße hinauf und hinunter. Da hörte sie den Türklopfer. Sie eilte zur Tür. Er war es.
„Herr Doktor Schneider“, sagte sie, atemlos erschien ihr ihre Stimme, doch wohl nicht von den wenigen Schritten? „Sie müssen entschuldigen, dass ich selbst Ihnen öffne, Frieda ist vom Einholen noch nicht zurück ...“
„Und ich bin etwas früher als angekündigt“, ergänzte er und legte Paletot, Zylinder und Stock ab. „Wie geht es Ihrer Frau Mutter heute?“
„Sie schläft fast den ganzen Tag“, erwiderte Sophie, vage enttäuscht. Was hatte sie eigentlich erwartet?
„Ausgezeichnet“, erklärte er. „Der Körper holt sich, was er braucht. Versuchen Sie, den Schlaf möglichst wenig zu stören.“ Damit war er an der Tür ins Hinterzimmer und ging hinein. Sie folgte ihm.
Die Mutter schlief. Er beugte sich über das Bett, nahm ihre Hand, fühlte ihren Puls. Sie wachte nicht auf.
„Wollen Sie nicht erst eine Tasse Kaffee trinken?“, fragte Sophie. „Vielleicht ist meine Mutter später wach.“
Täuschte sie sich, oder zögerte er? Und in diesem Zögern, das vielleicht gar nicht da war, das sie sich ja vielleicht nur einbildete, in diesem Zögern jedenfalls ergriff sie plötzlich heiß die Scham: Was hatte sie hier arrangiert! Wie musste es wirken! Das war auf einmal nicht mehr der Arzt, der selbstverständlich mit ihr in den Nebenraum ging, um ihr Anweisungen zur Pflege zu geben, ohne die Kranke durch das Gespräch zu stören, das war eine ganz und gar andere, eine ganz und gar unmögliche Situation: sie absichtsvoll allein mit einem Herrn, der nicht zur Familie gehörte! Allein mit ihm im Salon.
Unmöglich. Unvorstellbar. Ein Angriff auf Sitte und Moral. Was um alles in der Welt würde er nun von ihr denken? Und was sollte sie jetzt nur tun?
„Gerne, Baronesse“, erwiderte er. „Eine Tasse Kaffee täte mir gut.“
Es gab kein Zurück. Ihr Herz raste. Vor ihm her ging sie in den Salon und bereute jeden Schritt. Nun war es zu spät. Er folgte ihr. Die Tür aber ließ er weit offen, die Tür zu dem Raum, in dem die Mutter war und jeden Augenblick aufwachen und sie beide im Salon sehen konnte. Und auf einmal war alles gut.
Gegen diese Situation würde nicht einmal die Mutter etwas einzuwenden haben.
Ihm konnte sie vertrauen. Und selbst der Fehler, den sie gemacht hatte, dieser unglaubliche Fauxpas, den ihre Mutter, wüsste sie davon, ihr nie und nimmer verzeihen würde, selbst das alles war aufgehoben bei ihm.
„Bitte, nehmen Sie doch Platz“, sagte sie und wies ihm den Sessel zu, von dem aus er den unmittelbaren Blick auf die Mutter hatte. Sie suchte des Zitterns in ihrer Stimme Herr zu werden. „Hier sehen Sie gleich, wenn Ihre Patientin erwacht.“
Er dankte und beugte sich zu seiner Arzttasche hinab, holte einen Stapel Bücher heraus. „Wir haben doch gestern von Krieg und Frieden gesprochen. Ich habe Ihnen meine Bände mitgebracht, Baronesse. Wenn Sie die leihweise behalten möchten? Wie ich den Rekonvaleszenzprozess der verehrten Baronin einschätze, wird der Roman gerade so lange zur Lektüre vorhalten, bis Ihre Frau Mutter das Bett wieder verlassen kann.“
Freude breitete sich in ihr aus, sie spürte selbst, wie ein Strahlen ihr Gesicht verwandelte. „Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Sie ahnen nicht, was für eine Freude Sie mir damit bereiten!“
„Muss das sein?“, wehrte die Mutter ab. „Ich möchte schlafen. Lasst mir doch meinen Frieden!“
„Ja, Mutter, das muss. Du weißt doch, Doktor Schneider hat es angeordnet“, erwiderte Sophie. Wie seltsam es war, dass auf einmal sie es war, die der Mutter vorschrieb, was zu tun war, auch wenn sie darin nur ärztliche Anweisungen befolgte. Dennoch, es gab ihr eine Macht, die sie mit leiser Befriedigung erfüllte. Fast schien es, als sei nun sie die Mutter und die Mutter das Kind. Und auch wenn das nur vorübergehend war, eine Folge der Hilfsbedürftigkeit der Mutter — nie mehr würde es so werden, wie es vor der Krankheit der Mutter gewesen war, nie mehr würde diese eine so vollkommene Unterordnung von ihr fordern können, dachte Sophie.
Mit Frieda gemeinsam half Sophie der Mutter aus dem Bett und zu dem vor dem Fenster zurechtgerückten Lehnstuhl. Mehr trugen sie die Mutter, als dass diese ging. Wie leicht die Mutter geworden war, an ein welkes Blatt fühlte Sophie sich erinnert, aus dem aller Saft und alle Kraft entwichen waren. Aber Doktor Schneider hatte gemeint, sowohl der Gewichtsverlust als auch die enorme Schwäche der Mutter seien kein Grund zur Besorgnis, all das bewege sich im Rahmen, es handle sich nun einmal um eine sehr schwere Erkrankung, die eine lange Rekonvaleszenz erfordere. Herz und Kreislauf seien in Mitleidenschaft geraten, umso wichtiger sei die genaue Befolgung seiner Anweisungen. Zu denen gehörte neuerdings auch das Sitzen im Lehnstuhl am offenen Fenster.
„Doktor Schneider hat gesagt, zwei Stunden vormittags und zwei Stunden nachmittags sollst du warm eingepackt im Lehnstuhl am offenen Fenster sitzen“, erklärte Sophie. „Das ist wichtig für deine Lungen und für deinen Kreislauf, sagt Doktor Schneider.“
Sophie hielt sich gern an das, was er anordnete. Es gab ihr Sicherheit, nahm die Last der Verantwortung für die kranke Mutter. Zugleich war es wie eine heimliche Verbindung zu ihm, heimlich, obwohl sie dabei ständig seinen Namen im Munde führte. Aber keiner wusste, wie warm ihr wurde, wenn sie diesen Namen aussprach.
Zwei Decken hatte Frieda im Lehnstuhl ausgebreitet, auf die sie die Mutter setzten und die sie sorgfältig um sie schlugen, eine von rechts und eine von links. Dann wurde die Pelzstola um die Schultern gelegt — die Mutter hatte einmal erzählt, dass diese ein Geschenk des Vaters gewesen sei, das er aus dem Frankreichkrieg mit nach Hause gebracht habe —, ein Seidentuch wurde um den Hals geschlungen, und die Füße wurden auf einem Schemel gelagert. Sophie öffnete das Fenster, blieb einen Moment darin stehen und blickte hinunter. Die rußgeschwärzte Rückwand des alten Gebäudes, tief unten das Dach der im Hof an das Haus angebauten, äußerst euphemistisch „Appartements“ genannten Abortanlage, der Wäschetrockenplatz und die Mülltonnen, dann die langgestreckten Schuppen, in denen die Herstellung von Bankowskys feinen Stahlwaren stattfand, dahinter die Rückfront der nächsten Häuserzeile. Trostlos pflegte sie sonst diesen Ausblick in den grauen Hinterhof zu finden. Doch heute sah sie die Vorboten des Frühlings. Die letzten Schneereste waren geschmolzen, blau spannte sich der Himmel über Berlin, Spatzen tschilpten in der Regenrinne, die Söhne des Polizeihauptmanns aus der Wohnung unter ihr spielten Knicker im Hof, irgendwo lachten Kinder, aus dem benachbarten Hinterhof drang das Leiern einer Drehorgel herauf und die Moritat vom Frauenzimmer Sabinchen, und die Sonne schien genau in ihr Fenster.
„Mir ist viel zu warm hier in der Sonne mit dieser Pelzstola“, klagte die Mutter.
„Schon recht, gnädige Frau“, sagte Frieda gutmütig, „wir legen sie ab, wer hätte auch gedacht, dass die Sonne schon so eine Kraft hat! Aber bald ist sie rumgewandert, die Sonne, dann müssen wir die Stola wieder nehmen, denn verkühlen sollen Sie sich jetzt nicht auch noch, Gott bewahre! Ich rücke Ihnen hier das Tischchen her und stelle die Glocke darauf, läuten Sie nur gleich, wenn etwas ist.“
„Frieda, du vergreifst dich im Ton!“, meinte die Mutter gereizt. „Wofür hältst du dich? Nur weil ich krank bin, hast du dich nicht aufzuführen, als wärest du mein Kindermädchen!“
Sophie drehte sich um. Sie spürte diesen Schlag gegen das vertraute Dienstmädchen, als wäre er gegen sie selbst geführt. Und auf einmal war er wieder da, der Zorn auf die Mutter. Das war so ungerecht — nach allem, was Frieda für die Mutter getan hatte!
Frieda murmelte etwas Unverständliches und verließ mit hochrotem Kopf den Raum durch die Küchentür. „Sie meint es doch nur gut. Sie macht sich Sorgen um dich“, sagte Sophie.
Die Mutter zog die Augenbrauen in die Höhe. „Das ist kein Grund, den Platz zu vergessen, auf den man gestellt ist“, erwiderte sie kühl. „Es gibt eine Ordnung, und die muss eingehalten werden, alles andere führt nur zur Anarchie. Die einen sind oben und die anderen sind unten, und du, meine Liebe, musst lernen, dich wie eine zu benehmen, die oben ist, und dazu gehört nun mal, die unten auf ihren Platz zu weisen — gut gemeint hin oder her. Und jetzt lass mich allein, das hat mich doch sehr ermüdet.“
Sophie wandte sich schweigend zum Gehen, aber an der Tür zum Salon drehte sie sich noch einmal um und sah zu der schmalen Gestalt im Lehnstuhl hin. Die Mutter hatte bereits die Augen geschlossen, den Kopf in die Kissen gelegt und wirkte, als ob sie schliefe.
Wie vertraut ihr diese Frau in den Tagen der schlimmsten Krankheit geworden war und wie fremd sie ihr nun wieder erschien. Kaum mehr vorstellbar, dass einmal die Hand der Mutter auf ihrem Scheitel geruht hatte und einmal ihre eigene Hand auf der der Mutter.
Leise verließ Sophie das Hinterzimmer und trat in den Salon, ließ sich auf dem Sofa nieder.
Wenn sie nur mit jemandem über die Qual reden könnte, die in ihr war. Dieser furchtbare innere Widerstreit, all das Verworrene. Die Erinnerung an den Vater, zwölf Jahre lang hoch und heilig gehalten — er: erhaben über jeden Zweifel, Held vieler Schlachten, Träger des Eisernen Kreuzes 1. Klasse für hervorragende Truppenführung, ein Ritter schlechthin — und nun das andere: das dunkle Verbrechen.
Wenn der Vater nur dazu Stellung genommen hätte! Wenn er erklärt hätte, warum er sich den Ehering abgezogen hatte. Sein heimliches Sichdavonstehlen zum Duell ohne Aussprache mit der Mutter, ohne die Möglichkeit des Abschieds — war es Rücksichtnahme zu nennen oder nicht vielmehr Feigheit?
Bei diesem gedachten Wort zuckte Sophie zusammen. Major von Zietowitz und Feigheit — wie ein Sakrileg erschien ihr dies. Aber hatte er selbst in seinem Brief nicht eine Andeutung in diese Richtung gemacht?
Sophie stöhnte. All die schon tausendmal gedachten Gedanken, all die tausendfach hin und her gewälzten Sätze aus den Zeitungsausschnitten, all diese Zweifel am Vater und die ebenso häufigen Versuche, ihn vor sich selbst und allen Anschuldigungen in Schutz zu nehmen, all das brach wieder über sie herein wie schon unzählige Male seit der Öffnung des Sekretärs. Es immer und immer wieder wälzen müssen, ohne Anfang und Ende, ohne Aussicht auf Klärung, ohne Aussicht auf Erlösung.
Den Kopf hätte sie am liebsten gegen die Wand geschlagen, aber das nützte ja auch nichts, um diese Gedanken zu vertreiben. Und keiner, mit dem sie darüber sprechen konnte. Oder doch?
Ein Bild schob sich vor ihr inneres Auge: der nicht sehr große Mittvierziger mit dem kaum merkbaren Ansatz zur Fülle, sein Gesicht mit dem gepflegten Kinnbart und dem schon etwas zurückweichenden Haaransatz, dem ersten Grau an den Schläfen, diese Augen, die bald ernst und aufmerksam blicken und bald hinter Lachfältchen fast verschwinden konnten, die gepflegten Hände, die ihr voller Behutsamkeit, ja Gefühl erschienen und die doch so sicher zufassen konnten, wenn es um ärztliche Verrichtungen ging ...
Ja, ihm könnte man vielleicht davon erzählen. Ein Arzt, das war sozusagen einer, der außerhalb der Ordnung stand, einer, dem man sich anvertrauen konnte, oder? Fast wie ein Vater, aber eben auf einer ganz anderen Ebene. Nein, nicht wie ein Vater. Ein Vater hatte zwei Seiten, eine liebevolle und eine strenge. Ein Arzt war da anders. Eher wie ein Priester. Cecilie, die von ihrer rheinländischen Mutter her katholisch war, hatte einmal von der Beichte gesprochen und von ihrem Beichtvater. Seltsam war Sophie das vorgekommen, fast ein wenig peinlich, und doch zugleich auch faszinierend. Nun auf einmal sehnte sie sich danach, einen Menschen zu haben, dem man alles sagen durfte, ohne dabei eine Regel zu brechen. Einen zu haben, der einem zuhörte und der alles zurechtrückte. Einen, der einem half. Und der einem vielleicht sogar erklären würde, was das war: Verführung einer Minderjährigen, Sittlichkeitsverbrechen.
Aber einen Beichtvater hatte sie nun einmal nicht. Nur einen Arzt, auch wenn er nicht der eigene war, sondern der der Mutter.
Und wenn Doktor Schneider ihr dann antwortete ...
Sie schloss die Augen und stellte sich seine Stimme vor, tief und warm. Diesen Tonfall, bei dem sich manchmal unversehens in einem hingeworfenen Nebensatz ein dialektartiger Anklang in das strenge Hochdeutsche mischte, was ihr so liebenswürdig vorkam in seiner fremden Lebendigkeit: als sei er damit als einer ausgewiesen, der unmittelbaren, unverfälschten Zugang zum Leben hatte, mochte die Mutter auch über jede Mundart noch so sehr die Nase rümpfen.
Woher mochte er kommen, der Doktor Schneider, aus dem Osten irgendwo? Sie konnte ihn ja schlecht danach fragen: Woher stammen Sie eigentlich, Herr Doktor? Das würde sich nicht schicken und würde nach Neugierde aussehen, Neugierde, die ihr schließlich ganz fremd war.
Bisher hatten sich ihre kurzen Gespräche fast nur um die Pflege der Mutter und um allgemeine Themen gedreht, kleine Salongespräche über Literatur und Musik, bei denen er sich als sehr versiert erwies. Aber vielleicht ...
Nein, nein, ihm vom Vater erzählen und von den Papieren, die sie ohne Wissen der Mutter gelesen hatte, das konnte sie nicht. Und schon gar nicht diese Fragen stellen, diese Fragen nach dem Unaussprechlichen. Sie müsste daran ersticken, wollte sie versuchen, es über die Lippen zu bringen.
Sophie schob mit Gewalt die Gedanken beiseite und griff nach dem dritten Band von Krieg und Frieden. Kurz hielt sie ihn geschlossen in den Händen und dachte daran, dass es sein Buch war, das sie da hielt. Dann öffnete sie es. Sie würde mit ihm über das reden, was sie seit seinem letzten Besuch gelesen hatte. Ein Anknüpfungspunkt für ein Gespräch, damit er nicht sofort nach der Untersuchung der Mutter wieder ging. Und sie musste die Tage nutzen, in denen sie die Möglichkeit hatte, dies Buch zu lesen, der Aufsicht der Mutter entronnen.
Mitten in der Nacht wachte Sophie auf. Sie lauschte nach nebenan ins Hinterzimmer. Durch die angelehnte Tür meinte sie die Atemzüge der Mutter zu hören, leicht und regelmäßig. Kein stöhnendes Luftholen. Kein Husten. Und keine Bitte nach Tee oder einem nassen Lappen oder einer leichteren Decke oder einer wärmeren oder nach sonst einer Handreichung. Sophie wurde nachts von ihrer Mutter nicht mehr benötigt. Nach den Wochen der anstrengenden Pflege könnte sie nun endlich durchschlafen bis in den Morgen. Aber es ging nicht. So sehr war sie inzwischen an Nachtwachen und nächtliche Störungen gewöhnt, dass der Schlaf sie floh.
Es tat ihr nicht leid. Diese Nächte waren zu schade zum Verschlafen. Wie eine zweite Welt, die sich heimlich unter die erste schob, so erschienen ihr die Nächte, die sie allein im Salon verbrachte, auf einmal — eine Welt, die nur ihr bekannt war. Ein verborgenes Land voller Reichtum, das nur ihr gehörte.
Für dieses Land nahm sie auch die Müdigkeit in Kauf, die sie tagsüber wie ein Schleier vom Leben trennte und mitunter beim Lesen oder Sticken im Sessel einschlafen ließ.
Sophie drehte sich auf den Rücken, zwängte sich zurecht. Unbequem war es auf dem viel zu schmalen und überdies auch noch zu kurzen Sofa. Aber was machte das schon! Sie würde sowieso gleich aufstehen. Und schreiben.
Sie hatte doch schon als Kind gewusst, dass sie das wollte: schreiben. Dass all die vielen Geschichten, die sie sich ausdachte, wenn sie abends nicht einschlafen konnte oder nachts aufwachte und schlaflos dalag, darauf warteten, auf Papier gebracht zu werden. Damit sie blieben.
Warum hatte sie als Kind nie zur Feder gegriffen? Vielleicht hätte die Mutter damals nichts dagegen einzuwenden gehabt, hätte es als nützliche Übung in Rechtschreibung, Aufsatz und Schönschrift gesehen und erlaubt, solange darunter das Klavierüben, die Hausaufgaben und die Handarbeiten nicht litten. Jetzt aber würde die Mutter es nicht mehr erlauben. Neben dem überlebensnotwendigen Sticken duldete sie nur solche Tätigkeiten, deren Übung unabdingbar war, um gesellschaftlich zu bestehen: Singen, Klavierspielen, Tanzen, französische Konversation und ausgewählte Lektüre.
Sophie runzelte die Stirn. Müssten sie nicht das Geld für das Offizierspatent ihres Bruders und seine auch nur einigermaßen standesgemäße Lebensführung zusammensparen, so könnten ihre Mutter und sie von der Witwenpension existieren, ohne sich mit heimlicher Lohnarbeit zu quälen. Aber so war das nun einmal. Ein Offiziersanwärter musste nachweisen, dass er nicht mittellos war. Und Karl musste Offizier werden, etwas anderes kam für den einzigen Sohn des Majors von Zietowitz nicht in Frage — der Familienehre wegen. Familienehre! Hatte der Vater die nicht verspielt, als er mit einem minderjährigen Mädchen —
Nein! Entschlossen warf Sophie die Bettdecke zurück und stand auf. Darüber würde sie jetzt nicht nachdenken, nicht schon wieder. Lieber an Lotte denken, die Förstertochter!
Sophie tastete auf dem Tisch nach den Zündhölzern, machte die Lampe an, schlich zur Tür und zog sie unendlich vorsichtig zu. Im Morgenmantel setzte sie sich an den zierlichen kleinen Schreibtisch, breitete ein Plaid über ihre Beine und holte den Stapel beschriebener Blätter und den Briefblock aus der Schublade. Kurz verweilte ihr Blick auf der Titelseite: Lotte. Roman von Sophie von Zietowitz.
Wenn sie ihn wirklich veröffentlichen sollte, würde sie ein Pseudonym wählen müssen und dafür sorgen, dass die Mutter niemals davon erfuhr. Dennoch, jetzt war es ihr wichtig, dass ihr voller Name auf dieser Seite stand. Sie tauchte die Feder ins Tintenfass.
Ein langer Moment der Leere. Die Tinte trocknete in der Feder. Noch einmal die letzten Sätze lesen: Lotte war von ihrem Vater zur Jagd mitgenommen worden. Auf einmal flossen die Worte, füllten sich die Blätter mit Zeichen. Der Vater und Lotte, Lotte und der Vater. Dann der Schrank. Patronen hatte Lotte holen sollen und sich in der Schublade geirrt. Da sah sie plötzlich die alten Briefe mit dem fürstlichen Wappen, adressiert an den Vater. War das nicht die Handschrift der Mutter? Sie drehte das Kuvert um, da stand der Vorname der Mutter, aber — das konnte doch nicht sein!
Und auf einmal war das ganze dunkle Geheimnis um die Herkunft der Mutter geboren. Aber ja, ganz deutlich sah Sophie das nun, warum hatte sie bisher nie daran gedacht? Die Mutter, die niemals etwas über ihre Herkunft gesagt hatte, die behauptet hatte, keinen einzigen Verwandten zu haben, alle Fragen über ihre Kindheit hartnäckig unbeantwortet ließ. Diese Mauer des Schweigens, die um die Person der Mutter errichtet war. Und nun auf einmal wurde klar: Lottes Mutter war aus fürstlichem Haus.
Sophie schrieb wie im Rausch, das Schreiben und die Geschichte und die Wirklichkeit, alles wurde eins: Lotte rang mit sich und wusste, dass sie diese Briefe nicht lesen durfte und der Vater draußen auf die Patronen wartete und sie ihm den Schlüssel zu seinem Schrank zurückgeben musste. Da steckte Lotte die Briefe rasch in ihre Schürzentasche ...
Die Feder flog über den Papierbogen: Während der Vater einen Hirsch einholte, den er geschossen hatte, saß Lotte im Gras unter einem Baum, holte die Briefe aus ihrer Schürzentasche und las: „Niemals werden meine Eltern einer bürgerlichen Heirat zustimmen. Sie urteilen nicht nach dem Wert eines Menschen, sondern nach seiner Herkunft und seinem Namen. Aber mir zählt die Liebe mehr. Es bleibt uns nur die Flucht.“
„Ach, Fräulein Sophie, ich denke, Sie schlafen sich endlich einmal so richtig aus nach all den Strapazen, und nun sitzen Sie hier und schreiben Briefe!“ Frieda war hereingekommen und sah Sophie kopfschüttelnd an. „Das wird dem Herrn Doktor aber gar nicht gefallen, wo er doch immer sagt, Sie sollen sich ausruhen.“
„Ach, Frieda, hast du mich erschreckt!“ Rasch schob Sophie die Blätter zu einem Stapel zusammen. „Ich habe dich gar nicht gehört.“ Sie warf einen Blick auf die Standuhr. „Schon halb acht! Und gegen acht wollte ja Herr Doktor Schneider kommen, weil er heute Nachmittag keine Zeit hat! Ich muss mich rasch anziehen, räume du inzwischen hier die Bettsachen weg und heize ein, ich rufe dich dann, wenn du mir das Korsett zuschnüren musst!“
„Schon gut, Fräulein Sophie. Die gnädige Frau schläft noch, die will ich lieber nicht wecken, sie soll sich ja gesundschlafen, sagt der Herr Doktor immer. Ich habe Ihnen drüben warmes Wasser hingestellt.“
„Danke, Frieda. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne dich täte!“ Sophie eilte nach nebenan und verschwand hinter dem Paravent, hinter dem auf einem Tischchen Waschschüssel und Krug bereitstanden. Sie war eben mit Ankleiden und Frisieren fertig, als der Türklopfer ertönte.
„Schon so spät? Warum habt ihr mich nicht geweckt?“, sagte die Mutter und setzte sich im Bett auf. „Frieda“, rief sie der Dienstmagd nach, die zur Wohnungstür ging, „geleite den Herrn Doktor in den Salon und sage ihm, ich empfange ihn gleich! Und dann eil dich und hilf mir! Sophie, reiche mir den Morgenmantel!“
Sophie schaute überrascht zu ihrer Mutter. Bisher hatte diese den Doktor immer an ihr Bett kommen lassen. Und nun — ich empfange ihn gleich ... Offensichtlich ging es ihr wesentlich besser. Sophie wollte die Mutter stützen, doch diese wehrte ab. „Lass! Ich bin durchaus in der Lage, auf eigenen Füßen zu stehen. Geh schon in den Salon, es ist unhöflich, den Herrn Doktor so lange warten zu lassen. Ich komme sofort. Und bitte ihn, er möge mir schon ein Rezept für die Herztropfen ausstellen, die neigen sich zu Ende!“
„Wenn du meinst.“ Sophie zögerte. „Ich lasse die Tür angelehnt.“
Herr Doktor Schneider begrüßte sie wie immer mit Handkuss, zeigte sich erfreut über die Nachricht, die Mutter wolle das Bett verlassen und in den Salon kommen, und setzte sich bereitwillig an den Schreibtisch, um das gewünschte Rezept auszustellen. Dann sah er den Stapel zusammengeschobener Blätter, sah die Titelseite und wandte sich zu Sophie um: „Sie schreiben einen Roman, Baronesse?“
Sie stand da, rot übergossen, unfähig, eine Antwort zu geben. Und auf einmal hatte sie das Gefühl, alles, ihr ganzes Leben, hinge davon ab, was er als Nächstes sagen würde.
„Was für eine wundervolle Idee“, meinte Doktor Schneider. „Die Poesie ist doch das wahre Leben. Darf ich einmal einen Blick hineinwerfen?“
Sie brachte nicht mehr zustande als ein schwaches Nicken. Ihm genügte es als Antwort. Er blätterte in den Seiten, blieb bei der letzten, las. „Wie schön“, sagte er still. Dann drehte er sich um und sah sie an. „Sind das nur die Worte der Schriftstellerin, Baronesse, oder ist das auch Ihre eigene tiefe Überzeugung?“
„Was?“, fragte sie mühsam. Ihr Hals war trocken, kaum gehorchte die Stimme.
„Zählt auch Ihnen die Liebe mehr als Herkunft und Namen?“, fragte er leise.
„Ich glaube schon“, flüsterte sie. Da trat die Mutter herein.
Sophie flüchtete, lief durch das Hinterzimmer bis zur Küche. Dort legte sie die Arme um das vertraute Dienstmädchen. „Bitte, Frieda, halt mich doch! So, wie du's früher gemacht hast, als ich noch ein Kind war“, bat sie.
Frieda zog sie an sich. „Ach Gott, was ist denn, mein Kindchen?“, fragte Frieda und wiegte sich mit ihr.
„Ich, ich weiß nicht, Frieda. Woran merkt man denn, ob man verlobt ist? Ich meine nicht offiziell, sondern heimlich, unausgesprochen?“
„Ach Gott, mein Kindchen“, murmelte Frieda und drückte sie. „Ach Gott!“
Warum kam er nicht endlich! Vier Tage war es nun schon her, dass er in ihrem Romanmanuskript gelesen und ihr diese Frage gestellt hatte — und seither hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Schlimmer noch: Auch an jenem Morgen hatte sie ihn nicht mehr gesehen. Als sie aus der Küche in den Salon zurückgekehrt war, endlich so weit gefasst, dass sie sich getraut hatte, ihm wieder gegenüberzutreten, war er schon weg gewesen. Ist denn Doktor Schneider schon gegangen?, hatte sie ganz außer sich gefragt und die Mutter hatte kühl geantwortet: Aber sicher, wenn du so unhöflich bist, ohne ein Wort den Raum zu verlassen, kannst du nicht damit rechnen, dass er auf dich wartet. Immerhin ist er ein vielbeschäftigter Arzt. Er bat mich, dir seine Empfehlung auszurichten.
Seine Empfehlung. Und seither nichts. Hatte sie sich getäuscht? Sich alles nur eingebildet? Was war denn schon gewesen: Er hatte sie gefragt, ob sie die gleiche Meinung habe wie eine von ihr erfundene Figur. Das war alles. Aber das fragte man doch eine junge Dame nicht einfach so: Zählt auch Ihnen die Liebe mehr als Herkunft und Namen? Jedenfalls nicht, wenn man nur ein Bürgerlicher war, wenn auch ein Oberleutnant der Reserve und ein Doktor, und die junge Dame eine Baronesse. Da musste man doch wissen, dass sich die junge Dame dann etwas denken würde, sich Hoffnungen machen!
Hoffnungen? Nicht einmal das wusste sie genau: ob sie wirklich darauf hoffte. Eigentlich hatte sie sich das immer ganz anders vorgestellt. Dass da eine Stimme in ihr sein würde, unüberhörbar laut: Das ist er, er und kein anderer. Und ihn, den, um den es dann gehen würde, hatte sie sich auch anders gedacht. Jünger auf jeden Fall und größer und von imponierenderem Äußeren. Und ohne dass sie darüber nachgedacht hätte, war es für sie ganz selbstverständlich gewesen, dass er von Adel sein würde und ein Offizier und nicht nur Reserve. Ein Rittmeister vielleicht, nicht Artillerie, sondern Kavallerie, das war einfach etwas Besseres. Und nun ein Arzt.
Diese Stimme, so warm und fest und sicher. Dieses Lächeln. Das, was von ihm ausging — wie sollte sie es nennen? Güte vielleicht? Oder ganz einfach: Wissen? Er war einer, der hinter die Fassaden blickte und das wirkliche Leben kannte, in all seinen Facetten. Einer, der nicht gleich alles verurteilen würde, weil es nicht standesgemäß war oder nicht einer jungen Dame gemäß. Er hatte ihr Krieg und Frieden geliehen ohne einen Gedanken daran, das sei vielleicht nicht die richtige Lektüre für sie, und er hatte es wundervoll gefunden, dass sie einen Roman schrieb.
Ach was, er war einfach nur höflich gewesen! Hätte er vielleicht sagen sollen: Wie kommen Sie dazu, sich mit solchen Nichtigkeiten die Zeit zu vertreiben? Wie schön, hatte er gesagt, auf so eine ganz besondere, stille Art. Und wie er sie dabei angesehen hatte ...
Wie schön! Na und? Es hatte nichts zu bedeuten. Denn wenn es etwas zu bedeuten hätte, würde sie jetzt nicht seit drei Tagen auf ihn warten müssen. Es sah ganz danach aus, dass sie noch weitere drei Tage zu warten hätte. Die Mutter hatte erzählt, er würde erst in einer Woche wieder vorbeischauen, der Rekonvaleszenzprozess sei so weit fortgeschritten, dass häufigere Besuche nicht mehr vonnöten seien, habe er erklärt.
Vonnöten! Wie es ihr, Sophie, damit ging und was für eine Not das für sie war, das spielte offensichtlich überhaupt keine Rolle! Es wäre doch ein Leichtes für ihn gewesen, einen Vorwand zu finden, die Mutter gleich am nächsten Tag wieder zu besuchen. Ein neues Medikament, ein vergessener Hinweis, eine nachträgliche Verordnung ...
„Du bist so schweigsam, Sophie“, sagte die Mutter.
Sophie erwiderte nichts.
„Als Hofdame wärest du nicht eben eine glänzende Gesellschafterin“, meinte die Mutter. „Dazu fehlt dir noch ganz erheblich die Kunst der leichten Konversation.“
Sophie blickte von der Gobelinstickerei auf zu der schmalen Gestalt im Lehnsessel am offenen Fenster. Auf einmal war sie wieder da, diese Welle von Zorn. „In den vergangenen Wochen habe ich mich ja auch als Krankenpflegerin geübt und nicht als Hofdame!“, gab sie zurück. Sie hörte selbst die Schärfe in ihrer Stimme und tat nichts, um sie zu mildern. All die durchwachten Nächte, all die Mühe bei der Pflege, und dann das! Nicht, dass sie mit Dank gerechnet hätte, die Majorin von Zietowitz bedankte sich nicht bei jemandem dafür, dass er seine Pflicht tat. Aber dies nahtlose Anknüpfen an die alte Gängelei, als sei nichts gewesen, als hätte sich nichts geändert zwischen ihnen — das ging ihr zu weit. Spitz fügte sie hinzu: „Im Übrigen wüsste ich nicht, was ich dir Neues zu berichten hätte. Ich bin ja all die Wochen nicht vor die Tür gekommen, geschweige denn in Gesellschaft.“
„Nun sei nicht sofort wieder gekränkt, nur weil ich dir sage, in welche Richtung du noch an dir feilen musst!“, antwortete die Mutter. „Du solltest mir dankbar sein, dass ich dir den gesellschaftlichen Schliff beibringe: Er ist das einzige Pfund, mit dem du wuchern kannst. Geld hast du nicht, deine Schönheit ist auch nicht überragend, ein scharfer Intellekt verschreckt die meisten Männer eher, als dass er sie anzieht — womit also willst du andere ausstechen und das Rennen machen, wenn nicht mit gesellschaftlicher Noblesse?“
„Bin ich ein Pferd, das du ins Rennen schickst?“, warf Sophie scheinbar leichthin ein. Spöttisch sollte es klingen, denn wie sehr die Worte sie verletzt hatten, sollte ihre Mutter nicht merken.
„Im Übrigen hast du recht, die vergangenen Wochen waren für die Vervollkommnung deiner Erziehung verlorene Zeit“, fuhr die Mutter fort, als hätte sie Sophies Einwurf nicht gehört. „Wir haben einiges nachzuholen, insbesondere deine Einführung in die Gesellschaft. Die Ballsaison ist ja nun leider vorbei. Aber jetzt im Frühjahr wird das Thema Landpartien aktuell. Eine Landpartie bietet reiche Möglichkeiten, sich ins rechte Licht zu setzen und durch Frische, Esprit und Liebreiz auf sich aufmerksam zu machen. Stumm wie ein Stockfisch darfst du da jedenfalls nicht sein. Sobald ich den Salon bei Frau General von Klaasen wieder besuchen kann, werde ich etwas arrangieren. Im Salongespräch lässt sich leicht die Rede auf eine Landpartie bringen, und es gibt immer ein paar Damen und Herren, die sofort dafür zu begeistern sind, auch jüngere Offiziere. Eine Einladung, die sich genauso gut auf dich ausdehnen lässt, ergibt sich dann ganz zwanglos. Du solltest schon einmal deine Garderobe daraufhin durchsehen. Vielleicht können wir noch einmal eines meiner alten Kostüme für dich umnähen. An neue Garderobe ist leider nicht zu denken, aber wir putzen dich schon vorteilhaft heraus!“
Vorteilhaft — wie das klang! Keine Gelegenheit ließ die Mutter aus, um mehr oder weniger dezent darauf anzuspielen, dass sich Sophies Schönheit nicht mit der messen konnte, für die ihre Mutter einst berühmt gewesen war.
Ich sollte ihr dankbar sein, dachte Sophie. Sie gibt sich alle Mühe für mich, arrangiert Möglichkeiten, damit ich in die richtige Gesellschaft komme, leiht mir ihren Schmuck, vermacht mir sogar eines ihrer Kleider nach dem anderen, obwohl sie selbst kaum mehr weiß, was sie anziehen soll.
Warum habe ich nur das Gefühl, schreien zu müssen?
„Allerdings muss ich erst gesund werden“, erklärte die Mutter nach einer Pause, „denn ohne mich ist es für dich natürlich völlig ausgeschlossen, eine Einladung zu einer Landpartie anzunehmen. Eine andere Anstandsdame als mich haben wir nun mal nicht. Und Landpartien sind gewöhnlich mit Spaziergängen verbunden, und ich ermüde doch noch sehr leicht. Vom Treppensteigen vorhin spüre ich jetzt noch das Herzklopfen und die Schwäche.“
„Willst du nicht Frieda nach Doktor Schneider schicken?“, fragte Sophie schnell. Sie spürte, wie ihr die Röte in den Kopf stieg. „Vielleicht ist es ja etwas mit dem Herzen!“
„Ich bitte dich!“, wehrte die Mutter ab. „Natürlich ist es etwas mit dem Herzen, das wissen wir doch. Aber wenn der gute Doktor kommt, ändert das auch nichts, außer an der Rechnung, die wir zu begleichen haben werden, auch wenn er bisher noch keine gestellt hat.“
Draußen pochte der Türklopfer. Sophies Atem stockte. Doktor Schneider!, dachte sie und musste sich zusammenreißen, nicht aufzuspringen. „Wer das wohl sein mag?“, meinte sie mit scheinbarem Gleichmut und stand langsam auf. „Ich gehe schon.“
Draußen im Flur warf sie einen Blick in den Spiegel, zupfte ein paar Locken zurecht, biss sich auf die Lippen, kniff sich in die Backen. Dann atmete sie ein paar Mal tief ein und aus. Sie würde ganz überrascht tun, dass er da war. Ich dachte, Sie wollten erst nach einer Woche wiederkommen, würde sie sagen, oder ist die tatsächlich schon vorbei, ich habe gar nicht darauf geachtet.
Sie öffnete die Tür. Es war nicht Doktor Schneider. Es war ihr Onkel, der Oberst. Mit Mühe versuchte sie die Enttäuschung zu verbergen. „Ach, du bist es, Onkel Albrecht! Willkommen!“ Sie streckte die Hand aus, um seinen Mantel in Empfang zu nehmen.
Der Onkel betrachtete sie mit einem seltsamen Lächeln. „Na, Mädchen“, meinte er. „Enttäuscht, was? Hast wohl einen anderen erwartet?“ Sie schluckte. Stand es ihr auf die Stirn geschrieben?
Er lachte. „Was macht die werte Frau Mama?“, fragte er. „Ich hoffe, sie ist nicht indisponiert. Ich habe eine wichtige Angelegenheit mit ihr zu bereden — unter vier Augen. Dann führe mich mal in die gute Stube und hole die verehrte Majorin! Doktor Schneider versicherte mir, die Genesung sei gut vorangeschritten, da wird sie ihren alten Schwager ja wohl empfangen können. Tüchtiger Arzt, das.“
„Ja“, bestätigte sie, noch immer um Fassung ringend. Sie führte den Onkel in den Salon und ging der Mutter Bescheid sagen.
„Dein Onkel, Oberst Zietowitz?“, wiederholte diese mit einem verwunderten Hochziehen der Augenbrauen. „Unter vier Augen? Seltsame Töne. Nun, wie auch immer, sag ihm, er möge sich noch einen Moment gedulden, und biete ihm von dem alten Port an. Und dann hilf mir beim Umkleiden. In diesem Hauskleid mag ich ihm denn doch nicht begegnen.“
Sophie führte alle Aufträge aus, holte die Flasche Port aus dem Schrank, die einzig für solche Gelegenheiten aufbewahrt wurde, schenkte dem Onkel ein, wechselte ein paar höfliche Floskeln mit ihm, kehrte zur Mutter zurück, schloss deren Kleid am Rücken, Häkchen für Häkchen.
Doktor Schneider versicherte mir ...
Wann hatte der Onkel denn mit Doktor Schneider gesprochen? Doktor Schneider war doch nicht der Hausarzt des Onkels, sie erinnerte sich genau, wie der Onkel Herrn Doktor Schneider mit seinem Hausarzt verglichen hatte, einem Doktor Rübezahl oder so ähnlich. Oder hatte der Onkel etwa den Arzt gewechselt? Tüchtiger Arzt, das. Wichtige Angelegenheit
Die Mutter ging in den Salon. Sophie hielt ihr die Tür auf, zog sie hinter der Mutter wieder zu. Doch auch durch die geschlossene Tür vernahm Sophie die schnarrende Stimme des Onkels, seine Begrüßung der Mutter.
Sophie zögerte. Sollte sie wirklich? Nein. Es gehörte sich nicht, an Türen zu lauschen. Ganz und gar unschicklich war es. Mehr noch — es beleidigte ihr eigenes Ehrgefühl, so etwas zu tun. Entschlossen kehrte sie der Tür den Rücken, durchquerte den langen Raum und ließ sich am Fenster mit ihrer Stickerei nieder. Von weitem hörte sie die Stimme des Onkels wie ein fernes Dröhnen, hin und wieder lösten sich ein paar Wortfetzen aus dem Hintergrund, drangen an ihr Ohr. Mehrfach ihr eigener Name und dann der andere: Doktor Schneider.
Sie sprang auf. Achtlos fiel die Stickerei zu Boden. Sie lief zur Tür zum Salon, trat leise ganz dicht heran und lauschte.
„Vater Kreisphysikus, tadelloser Leumund. Er in Berlin studiert, schlagende Verbindung, erstklassiges Corps. Nach der Approbation zunächst magere Jahre in Gnesen. Aber er hat sich damit nicht eingerichtet, wollte höher hinaus, daher der Wechsel nach Berlin. Hier bald nach der Niederlassung Fuß gefasst, hat sich peu à peu hochgearbeitet, Anfangsschwierigkeiten längst überwunden. Solvente Patienten, auch aus höheren Kreisen, aufstrebende Praxis, respektables Renommee. Das weißt du ja selbst, hast ihn schließlich auch gewählt. Dazu kommt etwas ererbtes Geld, vor allem von der Mutterseite her. Habe seine Bücher geprüft, er hat sie mir mit größter Bereitwilligkeit offengelegt, hatte sie gleich dabei, als er bei mir vorsprach. Gefällt mir, verrät Sinn für die Realitäten. Und was ich gelesen habe, gefällt mir noch mehr: solide, sehr solide. So eine Basis würde ich manchem Hauptmann aus unseren Kreisen wünschen. Haustetten hat außerdem Erkundigungen über den Doktor eingezogen — das ist ein Privatbeamter bei meiner Bank, der mir schon öfter entsprechende Dienste geleistet hat. Der Gute ist geschickt in solchen Dingen, Nachbarschaft, Bank, medizinische Gesellschaft etc. Haustetten hat mir heute Bericht erstattet, alles sehr zufriedenstellend.“
Sophies Herz klopfte so laut, dass sie meinte, es müsste durch die Tür zu hören sein und sie verraten. Kein Zweifel, von wem da die Rede war, auch wenn sein Name nicht fiel. Die Antwort der Mutter aber war zu leise, um zu verstehen zu sein, sosehr Sophie sich auch anstrengte.
Doch dann wieder der Onkel: „Zweifellos gebildet. Das Beste: Oberleutnant der Reserve, in Frankreich dabei gewesen, nicht etwa als Stabsarzt, nein, bei der kämpfenden Truppe, das Kreuz für Tapferkeit vor dem Feind, also schneidig. Artillerie, immerhin — Kavallerie kann man beim besten Willen nicht erwarten, nicht bei einem Bürgerlichen, Artillerie ist jedenfalls besser als Pioniere.“
Sophie schloss die Augen, lehnte sich an die Tür. Sie zitterte so, dass ihre Knie nachgaben. All dies, was sie da hörte, ließ nur den einen Schluss zu. Es war wirklich wahr. Dieser eine Satz von Doktor Schneider: Gilt Ihnen die Liebe mehr als Herkunft oder Namen?, war nicht nur dahingesagt gewesen. Doktor Schneider meinte es ernst. Er hatte beim Onkel um ihre Hand angehalten.
Wieder die leise, nicht verstehbare Erwiderung der Mutter. Dann wurde deren Stimme lauter und eine Spur schrill: „Diese ganze Sorgfalt mit ihrer Erziehung! Für wen habe ich mir denn all diese Mühe gegeben, den Schein zu wahren, die Familienehre hochzuhalten, die Zugehörigkeit zu unseren Kreisen nicht zu verlieren? Doch nur für Karl und Sophie — damit Sophie einmal standesgemäß heiraten kann! Und nun einen Bürgerlichen! Völlig unter Niveau. Das hat es im ganzen Stammbaum derer von Rieskow niemals gegeben. Gut, ihr Zietowitz', ihr habt eine Pastorentochter in euren Reihen zu verzeichnen, da mag es dir nicht so unmöglich erscheinen wie mir. Ich als geborene Rieskow sage jedenfalls: Ausgeschlossen!“
Und der Onkel: „Versteh' ich ja, Agathe, versteh' ich. Auch ohne die Herkunft meiner Mutter, auf die du anzuspielen beliebst. Bewundernswert, wie du dich und die Kinder nach dem Tod meines Bruders gehalten hast — in der Situation, die er auf dem Gewissen hat. Zweifellos. Und deine hochfliegenden Pläne mit Sophie — verständlich. Natürlich, gräfliches Haus, das wäre was anderes, und das Zeug hätte das Mädchen dazu dank deiner Bemühungen, außer Frage. Oder ein Rittmeister der Ulanen mit Gut in Ostpreußen oder ein märkischer Junker, wem sagst du das. Würde mir auch besser schmecken. Aber ich bitte dich, betrachte die Realitäten! Nicht die geringste Mitgift, nicht einmal Tafelsilber und Tischwäsche, geschweige denn Geld oder Land! Niederschmetternde Aussichten, alter Adel und gesellschaftlicher Schliff hin oder her, das weißt du doch selbst! Wie ich dich kenne, bist du nicht die Frau, die sich etwas vormacht. Der 1870/71-er Krieg hat die Reihen der Offiziere gelichtet, so mancher Fähnrich und frischgebackene Leutnant kamen nicht zurück. Sie haben die freie Wahl, die Herren Hauptmänner und Rittmeister, und die Damen das Nachsehen, bleiben wir doch mal ganz nüchtern! Und vielen Offizieren steht das Wasser bis zum Hals, die heiraten eher eine Bankierstochter als eine mittellose Zietowitz, mag sie auch noch so wohlerzogen sein und adrett aussehen. Aber, mit Verlaub, weibliche Reize werden mit zunehmendem Alter nicht größer.“
Ein Einwurf der Mutter, von dem Sophie nur die Empörung in der Stimme vernahm, doch nicht den Wortlaut. Dann wieder der Onkel: „Ich weiß, ich weiß, du hast recht, sie ist mit ihren gerade mal achtzehn Jahren zum Heiraten noch sehr jung, Zeit genug wäre zum Abwarten. Aber wer sagt dir denn, dass in fünf, sechs Jahren der Passende kommt, und was soll Sophie dann einmal tun? Etwa ihrem Bruder den Haushalt führen oder bei deinen hochnoblen Verwandten das fünfte Rad am Wagen sein und täglich zu spüren bekommen, dass sie nur das Gnadenbrot isst? Das Schicksal einer alten Jungfer — mein Gott, Agathe, willst du denn, dass das Mädchen bis an sein Lebensende im Hinterzimmer sitzt und für einen Hungerlohn Monogramme in die Brautwäsche reicher Jüdinnen stickt?“
Ein Klumpen bildete sich in Sophies Magen. Wie der Onkel da über sie redete ... Sie wollte nichts mehr davon hören, und doch blieb sie stehen, lauschte weiter. Die Worte der Mutter waren nicht zu verstehen, doch dann war da wieder die Stimme des Onkels: „Ja doch, ist ja mein Reden! Doktor Schneider ist bereit, vollständig auf Mitgift zu verzichten, auch auf Wäsche, Tafelsilber und so weiter. Mehr noch — als ich ihm andeutete, dass das Offizierspatent von Karl auf schwachen Füßen stehe, ließ er durchblicken, dass er auch da zu einem Zugeständnis bereit wäre. Allerdings, wie er das formulierte — alle Achtung. Ließ klaren Geschäftssinn erkennen, und das ist gut so. Auf Romantik ist noch nie eine sichere Existenz gegründet worden, und in seinem Alter wäre Sentimentalität nur bedenklich. Wir haben eine klare Abmachung auf Gegenseitigkeit ins Auge gefasst, kein gefühlsduseliger Firlefanz. Er sucht von Berufs wegen Anschluss an unsere Kreise. Ich habe es ihm zugesagt. Wenn er zum Zuge kommt, werde ich ihm Zugang zu den ersten Familien verschaffen, und du kannst auch das deine dazu beitragen.“
Sophie runzelte die Stirn. Kein gefühlsduseliger Firlefanz? Von Berufs wegen? Als würde ein Eimer eiskaltes Wasser über ihr ausgeschüttet, so trafen sie diese Worte. Aber es waren die Worte des Onkels. Es waren nicht die Worte von Doktor Schneider. Ihr gegenüber hatte Doktor Schneider nicht von Geld und Geschäften geredet, er hatte von Liebe geredet. Und den Blick, mit dem er sie angesehen hatte, so voller Wärme und Bewunderung, den hatte sie sich auch nicht nur eingebildet, der war wahr. Seine Frau zu sein! Verheiratet!
Sie erschauerte. Fremd war das, verwirrend. Anziehend und erschreckend in einem. Was sollte sie nur dazu sagen, was sollte sie tun, so plötzlich, sie konnte doch nicht, wusste doch nicht —
Sie spürte Tränen aufsteigen, war es Glück, war es Schreck? Vielleicht würde es gleich an der Tür klopfen, und er würde draußen stehen mit einem Strauß roter Rosen und würde sie bitten, seine Frau zu werden, da musste sie doch wissen, was sie antworten sollte! Ich fühle mich sehr geehrt! — das reichte ja wohl nicht, ein Ja würde er hören wollen oder ein Nein, und eines erschien ihr plötzlich so unmöglich wie das andere. Die Antwort eines Augenblickes würde über ihr ganzes Leben entscheiden. O Gott, was sollte sie tun?
Da hörte sie wieder den Onkel: „Nein, sag' ich doch, Agathe! Es war kein Antrag, wohlgemerkt. Das Mädchen muss nichts davon erfahren!“
Kein Antrag? Ihr Herz raste. Was dann? Was sollte diese ganze Unterhaltung, wenn Doktor Schneider überhaupt nicht um ihre Hand angehalten hatte?
Sie brach in Tränen aus. Und erst im Weinen begriff sie die Enttäuschung und aus der Enttäuschung die Liebe. Ja, sie liebte ihn, aber er liebte sie nicht, er hatte nicht um ihre Hand angehalten. Sie hatte alles falsch verstanden, ganz und gar falsch.
„Er ist bei mir vorstellig geworden, um abzuklären, ob seine Werbung von deiner und meiner Seite aus prinzipiell genehm wäre, trotz des Standes- und des Altersunterschiedes, wie er frank und frei ansprach. Er wolle Sophie nicht unnötig in Verwirrung stürzen, wenn eine mögliche Heirat von vornherein abgelehnt würde, hat er erklärt. Finde ich eine noble Haltung. Nichts dagegen einzuwenden. Und was den Altersunterschied betrifft, so ist er immerhin vertretbar, früher gab es solche Ehen wie Sand am Meer. Und es hat auch sein Gutes — dann hat er sich wenigstens die Hörner schon abgestoßen, du weißt, was ich meine. Also: Meinen Segen hat er, und ich rate dir gut, Agathe, schlag dir einen Baron oder gar Grafen aus dem Sinn, vergiss deinen Stolz und gib deinem Herzen einen Stoß.“
„Du meinst also, meine Tochter soll den Spatzen in der Hand nehmen“, hörte Sophie schrill und spitz die Stimme ihrer Mutter.
„Der Spatz in der Hand ist allemal besser als die Taube auf dem Dach — wenn das Dach so hoch liegt wie in diesem Fall“, erwiderte der Onkel. „Strategisch muss man denken, das sollte doch dir als Offizierstochter klar sein. Etwas Besseres als dieser Doktor Schneider kommt nun mal aller Voraussicht nach nicht hinterher. Also gilt es, die Gelegenheit beim Schopfe zu ergreifen. Soll er in Ruhe dem Mädchen den Hof machen und soll Sophie dann selber entscheiden, das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Ordentlich versorgt wäre sie durch ihn jedenfalls. Und wer weiß, vielleicht wird sie glücklicher mit ihm als mit einem jungen Gardeoffizier von altem Adel, denn wohin so einer seine Frau bringen kann, das sehen wir ja an dir, Agathe!“
Ein glückliches Schluchzen brach aus Sophies Brust, schnell schlug sie die Hand vor den Mund, wandte sich ab, verließ ihren Horchposten und sank in den Lehnstuhl am Fenster. Sie hatte es gewusst. Sie hatte es gewusst. Er war gut. Er war einer, dem man vertrauen konnte. Er ließ ihr Zeit und achtete sogar darauf, sie nicht zu verwirren. Bei ihm war alles aufgehoben, auch ihre Zweifel. Aber die waren sowieso schon vorbei. Jetzt wusste sie wirklich, dass sie ihn liebte.
Endlich dieses düstere Hinterzimmer verlassen können, einen eigenen Hausstand haben, der Aufsicht und Gängelei der Mutter entrinnen!
Sich nicht fühlen müssen wie ein Pferd, das zum Kauf angeboten wird, das vorgeführt wird und dem ins Maul geschaut wird, ob es auch nicht zu alt ist oder krank.
Endlich einen Platz haben. Wissen, wo man hingehört und wo man geschätzt wird. Und sein Alter? Nein, das schreckte sie nicht. Es war eher umgekehrt. Es gab ihr ein Gefühl von Sicherheit. Ihm konnte sie vertrauen. Die Vorstellung, sich an seine Schulter zu lehnen ...
Sie würde sich nichts anmerken lassen. Wenn die Mutter und der Onkel ihr nichts davon sagten, würde sie tun, als wisse sie von nichts.
Sie lachte leise in sich hinein und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Sollte er ihr ruhig den Hof machen und glauben, sie wäre ganz ahnungslos. Sollte er ruhig!
Und was das Thema Landpartie anging, wusste sie nun, wer mit von der Partie sein würde. Auch wenn es der Mutter nicht gefiel, weil die Mutter für sie höher hinauswollte. Aber der Onkel war der Bruder ihres Vaters, er stand an seiner statt, und auch wenn er sich bisher ihr ganzes Leben nicht um sie geschert hatte, jetzt hatte sein Wort Gewicht. Mit dem Onkel auf ihrer Seite würde sie auch die Einwilligung der Mutter erhalten.
Frau Doktor Friedrich Schneider ...
Wie fremd das klang. So schmucklos, geradezu bloß. Gewöhnlich. Mehr als nur ein Name — die Zugehörigkeit zu einem Stand, der unter ihrem eigenen war. Eine Bürgerliche zu sein, das war ein Abstieg, der nicht zu leugnen war, mochte man es drehen und wenden, wie man wollte. Manche Tür würde ihr mit diesem Namen verschlossen bleiben, die ihr jetzt offen stand.
Aber sie stand ihr ja nicht wirklich offen! Von wegen Hofgesellschaft — sie war niemals als Debütantin eingeführt worden, und niemals würde sie auf einem Hofball tanzen, weder als Frau Doktor Friedrich Schneider noch als Baronesse Sophie von Zietowitz. Oder doch, eines Tages, als Baronin oder gar Gräfin? Von allen bewundert, von allen beneidet ...
Ach, das waren Illusionen. Der Onkel hatte recht.
Doktor Friedrich Schneider. Ein ehrlicher Name. Einer, der nicht erst mit Blut reingewaschen werden musste. Einer, an dem nichts klebte, keine Erinnerung an ein dunkles Verbrechen, das ein junges Mädchen in den Tod getrieben hatte.
Sein Name. Ihr Name.