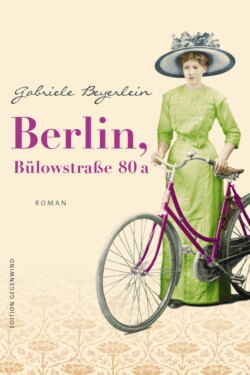Читать книгу Berlin, Bülowstraße 80 a - Gabriele Beyerlein - Страница 5
1.2
ОглавлениеSie wusste, dass sie schön war. Jeder Spiegel im Ballsaal der Villa Generals von Klaasen, worin sie sich beim Vorübertanzen betrachtete, bestätigte es ihr und mehr noch die Augen der anderen. Die Blicke der jungen Damen — schwang nicht Neid in ihnen? Und die Blicke der Herren ...
Hatte sie sich wirklich einmal für hässlich gehalten, nur weil keiner der Herren aus dem Tanzzirkel gewagt hatte, sie aufzufordern? Was für ein Kindskopf war sie da doch gewesen! Die Mutter hatte recht gehabt: Der Tanzzirkel im Hause Stolze, das waren eben nicht die richtigen Kreise für sie. Walter Wohlschlägel mit seiner tapsigen Ungeschicklichkeit und dem ewigen Rotwerden, sobald er denn endlich einmal einen Satz hervorgewürgt hatte!
Und Samuel Rosenstock? Schnell schob sie den Gedanken beiseite, sie wollte nicht an ihn denken, heute einmal nicht. Ein paar Mal hatte sie mit ihm getanzt, wenn die Tanzlehrerin einen Wechsel der Tanzpartner befohlen hatte, beim Menuett waren sie einander begegnet, hatten die vorgeschriebenen Komplimente voreinander vollführt, kaum mehr als zehn Sätze hatte sie insgesamt mit ihm gewechselt. Er war Cecilies Herr im Tanzzirkel. Ein Grund mehr, ihn zu vergessen.
Einen Augenblick fuhr ihr ein Stich in die Brust. Der Herr in Zivil dort, der mit der rundlichen Brünetten tanzte — war er das etwa?
Nein, natürlich nicht. General von Klaasen lud nicht den Sohn eines jüdischen Kleiderfabrikanten auf seinen Ball. Warum nur erblickte sie in jedem schmalen dunkelhaarigen jungen Herrn mit markanten Gesichtszügen Herrn Rosenstock?
Nicht denken. Tanzen. Und im Drehen ein flüchtiger, unauffälliger Blick in den Spiegel. Das Ballkleid aus lichtblauer Seide ließ ihre Augen noch blauer leuchten, die Haut ihrer bloßen Schultern noch heller schimmern, ihre Haare noch blonder glänzen. Und nichts verriet, dass diese Seide schon vor über zwanzig Jahren der Baronin von Zietowitz zum Ballkleid gedient hatte. Eine Schneiderin hatte das Kleid vollständig umgearbeitet, es hinten zum modischen Cul de Paris gerafft und die fehlenden Stoffbahnen durch ein Untergewand aus cremefarbenem Taft ersetzt, der einst der Stoff eines Morgenmantels der Mutter gewesen war. Die Mutter aber hatte unter Beweis gestellt, welch eine Meisterin im Sticken sie war: Überall, wo aufgetrennte Nähte im Stoff hätten verraten können, dass es sich um ein umgearbeitetes Kleid handelte, zierten nun kunstvolle Rankenmuster aus Silberfaden das Gewand. Kein Kleid für einen Hofball. Und dennoch ein Traum von einem Kleid, in dem sie sich ohne Scham auf dem Ball in der Villa Klaasen blickenlassen konnte.
Der Fähnrich, mit dem sie tanzte, ließ keinen Zweifel daran, dass er sie hinreißend fand. Es war ein gutes Gefühl, dennoch berührte es sie nicht. Er war ihr beim Diner als Tischherr zugewiesen worden, und je mehr er sich gemüht hatte, ihr mit lateinischen Zitaten, von denen sie kein Wort verstand, Eindruck zu machen, desto gleichgültiger war er ihr geworden. Aber irgendwo hier im Raum war vielleicht einer, der ihr nicht gleichgültig sein würde, wenn er nur auf sie aufmerksam würde und sie zum Tanz aufforderte. Wenn sie sich nur begegneten. Einer, mit dem das geschah, wovon die Romane erzählten. Der Augenblick, der alles veränderte, der über das ganze Leben entschied. So wie bei Natascha und Fürst Andrej, der die junge Natascha auf dem Ball aufforderte und sie beobachtete, als sie mit anderen tanzte, und plötzlich so von ihr verzaubert war, dass er an Heirat dachte.
Die Vorstellung, dass hier unter all diesen Herren vielleicht auch einer war, der jeder ihrer Bewegungen mit den Augen folgte, jedes Lächeln registrierte und sich in seinem Herzen für sie entschied, eben jetzt ...
Und sie ahnte nicht einmal, wer es war!
Das Blut stieg ihr in den Kopf. Ein Taumel erfasste sie, als hätte sie zu viel Wein getrunken, und es war doch nur ein einziges Glas gewesen.
Die Musik endete. Der Fähnrich verneigte sich mit militärischer Knappheit. „Verbindlichen Dank, gnädiges Fräulein. Sie tanzen wunderbar!“ Er hielt ihr seinen Arm hin, um sie zum Platz zurückzugeleiten, doch da trat Frau General von Klaasen neben den Konzertflügel und verkündete, dass nun als Höhepunkt des Festes der Kotillon getanzt und ihre Enkelin, Fräulein von Dabarow, als Gütige den Herren ihre Dame zuweisen würde. Die Damen mögen sich doch bitte im großen Kreis aufstellen.
Ein Stuhl wurde in die Mitte getragen, Fräulein von Dabarow setzte sich darauf, die Tanzkapelle hob wieder mit der Musik an, die Damen begannen sich im Kreis zu drehen, einer der Herren nach dem anderen näherte sich Fräulein von Klaasen, neigte sich höflich zu ihr herab und ließ sich durch einen Fingerzeig die Dame zuweisen, mit der er den Kotillon zu tanzen habe.
Das ist das Schicksal!, dachte Sophie. Vielleicht werde ich jetzt mit ihm zusammengeführt, mit dem einen ...
Ein Schaudern war auf ihrer Haut. Wenn ihr Herr sie dann nach dem Tanz nicht sofort an ihren Platz geleitete, sondern nach einem Vorwand suchte, sich weiter mit ihr zu unterhalten, dann war er der Richtige.
Schon war die Hälfte der Damen vergeben, wurde der Kreis der mit ihr Tanzenden immer kleiner. Da wies Fräulein von Klaasen auf sie.
Es war ein Offizier, groß, breitschultrig, blond. Eigentlich müsste er ihr gefallen. Aber etwas ließ sie sofort auf Distanz gehen. Vielleicht lag es daran, dass er das Schneidige so offensichtlich vor sich her trug, dass sie es einfältig fand. Er verneigte sich eine Spur zu zackig. „Habe die Ehre, gnädiges Fräulein! Leutnant von Oßdorf. 2. Garde-Ulanen-Regiment.“
Garde-Ulanen, an Renommee kaum zu übertreffen. Der Mutter würde das gefallen. Dennoch, musste er gleich damit Eindruck zu schinden versuchen? Eine kühle Klarheit war plötzlich in ihr, die sie so noch nicht kannte. Die Worte kamen ganz von selber, all die einstudierten Anstandsregeln und Verhaltensweisen waren auf einmal wie ihre Natur. Sie tanzte perfekt, lächelte strahlend, doch immer ein wenig an Leutnant von Oßdorf vorbei. Der Kotillon und dann der Wiener Walzer. Ihr schien, sie berührte kaum den Boden. Ein Schwindel in ihrem Kopf, drehen und drehen und drehen, Leichtigkeit erfüllte sie. Es war nicht nötig, dass er der eine war, auf den sie wartete, dieser Ulan hier mit seinem Kavalleriestolz, er tanzte gut, das war das Einzige, worauf es jetzt ankam, sie war jung und das Leben lag vor ihr.
Der Ballsaal flog an ihr vorbei, nichts existierte mehr, kein fester Bezugspunkt, keine Welt, nur dies: der Tanz im wirbelnden Kreisel. Als die Musik verstummte, taumelte sie vor Schwindel. Sofort fasste er nach ihrem Arm, hielt sie, presste sie dabei an sich.
„Wollen wir ein wenig durch die Gänge wandeln?“, fragte er dicht an ihrem Ohr. „Die Kühle im Wintergarten würde Ihnen nach der Hitze des Tanzes sicher guttun!“
Sie rückte leicht von ihm ab, lächelte und bat mit vollendeter Höflichkeit darum, an ihren Platz geleitet zu werden.
So etwas wie mit Natascha und Fürst Andrej gab es nur in Romanen, und an Fürst Andrej kam Leutnant von Oßdorf jedenfalls nicht heran.
Ihre Mutter war nicht am Platz, aber Frau General von Klaasen beugte sich zu Sophie herüber und forderte sie auf, näher zu rücken. „Wie gut Sie sich machen, Sophie!“, sagte sie freundlich. „Kaum zu glauben, ich sehe Sie noch als kleines Mädchen im kurzen Kleidchen vor mir, und nun sind Sie eine junge Dame und machen auf dem Ball eine ausgesprochen gute Figur.“
„Ich danke Ihnen, Frau General. Sie sind so gütig.“
„Ach was! Ich darf so etwas sagen, und mir dürfen Sie es glauben, in meinem Alter ist man über das Schmeicheln hinaus. Dieser Ulanen-Leutnant wollte zudringlich werden, nicht wahr? Hervorragend, wie Sie sich da gehalten und ihn in aller Freundlichkeit in die Schranken gewiesen haben! Ihr Herr Vater hätte heute seine reinste Freude an Ihnen gehabt!“
Ihr Herr Vater. Dies Wort fuhr Sophie ins Herz. Und auf einmal wusste sie: Das war die Gelegenheit, die sie nicht ungenutzt vorübergehen lassen konnte. Frau von Klaasen war eine alte Freundin der Mutter. Frau von Klaasen würde die Antwort auf die ewig brennende Frage nach dem Tod des Vaters wissen.
Aber wie es anfangen? Nicht verraten, dass ich selbst sie nicht weiß, sonst wird Frau von Klaasen mir nichts sagen. Die Vermutung als Tatsache hinstellen und aus der Reaktion schließen, ob sie die Wahrheit ist.
„Ach ja“, erwiderte Sophie. „Was gäbe ich darum, wenn er heute hier dabei wäre, und nicht nur heute! Es ist nicht leicht, so früh den Vater zu verlieren, und dann auch noch“, sie stockte kurz, versuchte ihrer Stimme einen festen Klang zu geben, jetzt kam es darauf an. Sie blickte Frau von Klaasen an, um genau zu sehen, wie ihre Worte aufgenommen wurden: „Und dann auch noch durch ein Duell.“
Frau von Klaasen nickte, tätschelte leicht ihren Handrücken und verfiel in vertraulichen Ton. „Ich weiß, mein Kind. Aber siehst du, so ist es nun einmal. Mancher junge Mensch hier hat seinen Vater in einem der letzten Kriege verloren, ihn vielleicht nicht einmal kennengelernt. Und die Ehre eines Offiziers geht nun mal über sein Leben.“
Also war es die Wahrheit. Das Herz schlug Sophie dumpf und schwer. Jetzt musste sie alles erfahren, auch das andere: was zu dem Duell geführt hatte und wer der Gegner gewesen war. „Und mein Vater, weshalb ...“, begann sie mühsam. „Sophie“, hörte sie da die Stimme ihrer Mutter, die soeben an ihren Platz zurückkehrte und die letzten Worte des Gesprächs gehört haben musste, „sei so gut und besorge mir meinen Schal, mir ist etwas kühl!“ Dabei warf die Mutter Frau von Klaasen einen Blick zu, der mehr als deutlich machte: Der Vater, das ist ein Thema, über das vor meiner Tochter nicht gesprochen wird.
Sophie stand auf. Die Gelegenheit war vorüber und würde nicht mehr wiederkehren. Während sie den Schal holte, würde Frau von Klaasen über das gewünschte Stillschweigen informiert werden.
Was um alles in der Welt war damals vorgefallen, dass die Mutter ein solch unaussprechliches Geheimnis daraus machte?
Ein Duell war tragisch, ja. Eine tödliche Krankheit, das wäre etwas anderes gewesen, da hätte man mehr den unerforschlichen Willen Gottes dahinter sehen können und nicht irgendwelche Menschenhändel. Aber ein Duell war doch nichts Unaussprechliches! Einen anderen zum Duell zu fordern, das war eben in manchen Fällen ein Gebot der Ehre, auch wenn es eigentlich verboten war. Aber wenn ein Offizier ein Duell ablehnte, dann verlor er dadurch sein Offizierspatent und musste den Abschied nehmen und war gesellschaftlich untendurch. Wenn das Duell also nur der Ehre des Vaters entsprochen hatte, warum dann dieses Schweigen?
„Und dann waren wir im Tiergarten Schlittschuh laufen. Mama und Papa waren natürlich dabei, aber sie konnten mit unserer Geschwindigkeit nicht Schritt halten, vor allem Papa, er ist etwas kurzatmig, und wir taten so, als würden wir nicht merken, dass sie immer weiter zurückblieben. Aber du hörst mir ja gar nicht richtig zu!“, rief Cecilie ärgerlich. „Ich berichte dir hier, wie ich das erste Mal mit ihm alleine war, und du zählst die Fäden deiner albernen Stickerei! Interessiert es dich denn gar nicht?“
„Entschuldige“, erwiderte Sophie, „natürlich interessiert es mich, das weißt du doch. Schlittschuh laufen, ja, das täte ich auch gern. Und dann allein mit Herrn Rosenstock ...“ Ihre Stimme zitterte nicht.
Samuel Rosenstock, das war vorbei. Unübersehbar machte er Cecilie den Hof, und unübersehbar freute diese sich darüber. Und sie selbst, sie gönnte ihrer Freundin das Glück. Jedenfalls erwartete sie das von sich. Der Sohn eines jüdischen Kleiderfabrikanten mochte zur Tochter eines neureichen Spinnereibesitzers passen, zu ihr tat er es nicht.
Rasch sprach sie weiter: „Ich brenne darauf, alles zu hören. Aber ich bin hier nun mal an einer schwierigen Stelle mit der Hohlsaumstickerei, da muss ich eben die Fäden zählen, und wenn ich die Stickerei nicht fertig habe, wenn Frieda mich abholt, lässt Mama mich nicht mehr zu dir.“
Cecilie schüttelte den Kopf. „Du mit deinem preußischen Pflichtgefühl! Deine Mutter ist wirklich zu streng — da bin ich ja froh, dass meine aus dem Rheinland stammt und nicht aus so hohen Kreisen ist wie deine! Mama gönnt mir mein Vergnügen, und vor allem verlangt sie keine sinnlose Arbeit von mir. Immerfort sticken, wozu soll das gut sein? Monogramme in die Aussteuer, ja, das wäre etwas anderes, aber so? Eure Schränke müssen doch schon randvoll mit überflüssigen Handarbeiten sein!“
Sophie schwieg. Nicht einmal Cecilie durfte wissen, was es mit diesen Handarbeiten auf sich hatte. Am Samstag musste die Decke im Geschäft abgeliefert werden, es war eine Auftragsarbeit für die Tafel eines Ministerialdirektors, wenn sie die nicht rechtzeitig fertig bekam, würde der Ladeninhaber sie ihr nicht mehr abkaufen. Aber das konnte sie Cecilie nicht sagen, so gern sie es auch täte. Sie hatte der Mutter versprechen müssen, mit keinem Menschen, nicht einmal mit ihrer Freundin, darüber zu reden, dass sie sich mit dem Verkauf von Handarbeiten Geld verdienten.
Sie würden gesellschaftlich geächtet, wenn das herauskäme, meinte die Mutter, und würden von ihren Kreisen nicht mehr zu Gesellschaften geladen und schon gar nicht zu einem Ball.
Und selbst wenn die gesellschaftliche Ächtung ausbleiben sollte, die Strafe der Mutter würde nicht ausbleiben, wenn sie sich an das auferlegte Schweigen nicht hielt, das war Sophie klar. Dann durfte sie womöglich an keinem Ball mehr teilnehmen.
Und zu Bällen gehen, das wollte sie um jeden Preis. Dafür nahm sie sogar den Ärger ihrer Freundin in Kauf. Und eines Tages würde sie auf so einem Ball einen kennenlernen, einen, gegen den Samuel Rosenstock verblasste, einen, der nicht so eingebildet und übertrieben zackig war wie Leutnant von Oßdorf, einen, der sie aus der Enge hinausführte, einen, mit dem das Leben begann, das wirkliche Leben: ihr Leben, für das sie geboren war. Doch erst einmal musste sie Cecilie besänftigen. „Also, wie war das beim Schlittschuhlaufen?“, fragte Sophie.
„Vielleicht erzähle ich es dir ein andermal“, erwiderte Cecilie, noch immer verstimmt. Sie griff nach dem Buch, das auf dem Tisch lag — Krieg und Frieden, jener Roman, dessen ersten Band Sophie sich einst ausgeliehen hatte und in dem sie nicht allzu weit gekommen war, denn ihre Mutter hatte das Buch bei ihr entdeckt und es ihr weggenommen. Mehr noch, um dieses Romanes willen hatte die Mutter Sophie damals für Wochen den Umgang mit Cecilie untersagt, und seither ließ sie sich, wenn Sophie von der Freundin kam, immer den Inhalt der Tasche zeigen, ob sie nicht wieder unerlaubt ein Buch mitgebracht habe. Entwürdigend war das: als sei sie ein sechsjähriges Kind, das es zu gängeln gelte, oder eine gemeine Diebin. Außerdem steigerte es Sophies Interesse an dem Roman immer mehr. In letzter Zeit, seit Cecilie selbst mit seiner Lektüre begonnen hatte, las diese ihr manchmal daraus vor.
„Magst du zuhören?“, fragte Cecilie. „Ich bin allerdings schon ein paar Kapitel weiter und habe keine Lust, das noch einmal ...“
„Musst du ja nicht“, sagte Sophie rasch. „Fahr einfach da fort, wo du gerade bist!“
„Pass nur auf, dass du dich nicht verzählst, wenn es zu spannend wird!“, spöttelte Cecilie. „Es ist nämlich wirklich spannend. Also, es ging gerade darum, dass Pierre mit Dolochow Streit bekommen hat — du erinnerst dich an Dolochow? —, weil Pierre nämlich einen anonymen Brief erhalten hat, dass Dolochow der Liebhaber seiner Frau sein soll ...“
„Liebhaber“, das war wieder so ein Wort. Eines der Worte, von denen Sophie ahnte, dass sie der Grund waren, warum ihre Mutter derart argwöhnisch über die Bücher wachte, die sie las. Eines der Worte, die sich auf den geheimen Teil des Lebens bezogen, auf den, vor dem höhere Töchter streng abgeschirmt wurden. Sophie spürte sie immer wieder, diese unsichtbare Mauer des Schweigens, die alles umgab, was sich auf Mann und Frau und Kinderkriegen bezog. Wenn Cecilies Mutter ihr mit höchstem Stolz jeden Raum ihres neuen Hauses gezeigt hatte, selbst die Dienstbotenkammer, nur einen nicht, das eheliche Schlafzimmer. Wenn ihr Bruder Karl bei seinem letzten Urlaub von der Hochzeit eines seiner vorgesetzten Offiziere gesprochen und erzählt hatte, dass man das jungvermählte Paar zur Hochzeitsreise an den Bahnhof gebracht habe, und dabei mit einem so merkwürdigen Grinsen das Coupé apart erwähnt hatte, das die beiden bestiegen hätten, einem Grinsen, das ihm unter dem empörten Stirnrunzeln der Mutter und einem kurzen Blick auf sie, die ahnungslose Schwester, vergangen war. Wenn Mama plötzlich in scharfem Ton Frieda ins Wort fiel, weil diese unbefangen etwas ausplauderte, was sie beim Einholen auf dem Markt oder beim Gespräch mit anderen Dienstmädchen aufgeschnappt hatte, von einer Frau, die im Kindbett gestorben, oder einem Dienstmädchen, das wegen „anderer Umstände“ aus dem Haus gejagt worden war. Wenn im Religions- und Konfirmandenunterricht dunkle Worte vorgekommen waren — das sechste Gebot: Du sollst nicht ehebrechen — und man hätte fragen mögen, was genau das denn nun sei, Ehebruch, ob es da um das Gefühl, jemanden anderen zu lieben, gehe oder doch um etwas anderes, und keine sich getraut hatte, danach zu fragen.
Liebhaber ...
„Und jetzt hat Pierre diesen Dolochow zum Duell gefordert, und da stehen sie sich nun auf einer Lichtung im Wald gegenüber“, erklärte Cecilie, rückte näher ans Licht und begann zu lesen:
„‘Na los‘, rief Dolochow.
‚Auf was warten wir noch?', sagte Pierre, immer noch mit demselben Lächeln.
Allen war fürchterlich zumute ...“
Auf einmal war Cecilies Stimme weit weg. Wie durch Nebel drangen die Worte nur noch dumpf in Sophies Ohren, erreichten nicht mehr ihr Bewusstsein. Die Stickerei sank in den Schoß. Sophie saß starr. Und alles war wieder da. Die Nacht. Das Mondlicht. Die Schritte des Vaters im Nebenzimmer. Das leise Zuziehen der Wohnungstür. Und dann der Schrei der Mutter —
„Er machte ein paar unsichere, schwankende Schritte auf den Säbel zu und sank neben ihm in den Schnee“, las Cecilie vor. „Seine linke Hand war voller Blut, er wischte sie an seinem Rock ab und stützte sich darauf ...“
Ob damals auch Schnee gelegen hatte, damals, am 6. März 1875, damals, als der Vater in einem Duell getötet worden war, um seine Ehre zu retten?
„Sie waren nur noch zehn Schritte voneinander entfernt. Dolochow ließ den Kopf in den Schnee sinken, nahm lechzend etwas davon in den Mund ...“
Blut im Schnee. Oder hatte es geregnet, und das Blut des Vaters hatte sich mit dem schmutzigen Wasser einer Pfütze vermischt? Nein, nein, die Sonne, erst hatte der Mond geschienen und dann die Sonne —
Ein klagender Laut entwich Sophies Brust, ohne dass sie es wollte.
Cecilie blickte vom Buch auf. „Was ist? Aber Sophie — du weinst ja!“
Sophie schüttelte den Kopf. Und schluchzte immer heftiger. Die Freundin setzte sich neben sie auf das Sofa und legte den Arm um sie. „Du weinst ja!“, wiederholte sie. Da stürzten alle Schutzwälle ein, und die Worte brachen aus Sophie heraus: „Mein Vater, er ist bei einem Duell getötet worden. Ich weiß es noch nicht lange, meine Mutter spricht nie darüber, ich habe ein paar Zeitungsausschnitte gesehen, nur eine Überschrift konnte ich lesen, und Frau General von Klaasen, sie hat nicht widersprochen, als ich von dem Duell gesprochen habe, und nun ...“
„Das tut mir leid“, flüsterte Cecilie. „So leid. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte dir das hier doch nicht vorgelesen!“
Sophie lehnte sich an die Freundin, drückte ihren Kopf an deren Schulter. Nun, da sie einmal angefangen hatte zu reden, ließen sich die Worte nicht mehr aufhalten: „Und nun muss ich wissen, was es war, warum dieses Duell, ich muss es einfach wissen, wofür er gestorben ist, verstehst du?“
Cecilie nickte. „Meistens geht es um eine Frau“, erklärte sie.
Sophie rückte von ihr ab und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. „Eine Frau?“, fragte sie. „Wie meinst du das?“
„Na ja, so ähnlich wie hier in dem Roman eben. Einer sagt etwas über die Gattin eines anderen, etwas gegen die Ehre, und der erfährt davon, und dann muss er den anderen fordern. Oder er kommt dahinter, dass seine Frau mit einem anderen eine Beziehung ...“ Cecilie wurde rot und griff nach den Zeitungen, die auf dem Tisch verstreut lagen. „Ich habe erst gestern so einen Artikel gelesen, hier ist er: ‚Wie wir aus gutunterrichteten Kreisen erfahren, hat gestern Morgen in der Hasenheide bei Berlin ein Duell zwischen Baron von I. und Hauptmann von Walstetten stattgefunden. Der Hauptmann fiel. Erinnert sei in diesem Zusammenhang, dass das Strafgesetz den Zweikampf unter Strafandrohung stellt und insbesondere die katholische Kirche ihn verbietet. In ähnlich gelagerten Fällen hatten Duellanten gewöhnlich auf Beschluss Seiner Majestät des Kaisers eine sechswöchige Festungshaft zu verbüßen. Aus Kreisen des Militärs und des Adels war jedoch Zustimmung zu dem Duell zu hören. Es musste sein, verlautete es einhellig. Es heißt, dass eine Beziehung zwischen dem Hauptmann und der jungen Baronin bestanden haben soll, die zweifelsfrei durch Briefe belegt sei. Sogar eine gemeinsame Flucht sei in Betracht gezogen worden.‘“
„Eine Beziehung?“, flüsterte Sophie und starrte Cecilie an. „Du meinst, dass meine Mutter, meine Mutter, dass sie meinen Vater verlassen, mit einem anderen fliehen ...“
Cecilie machte ein betretenes Gesicht. „Das habe ich nicht gesagt! Ich habe nur gesagt, oft geht es um eine Frau. Nach dem eben, was in den Zeitungen und Büchern steht. Aber du musst das doch viel besser wissen als ich, es sind ja deine Kreise, in denen man sich duelliert, und nicht meine. Außerdem kann es auch etwas ganz anderes ...“ Ihre Stimme versickerte.
„Meine Mutter“, wiederholte Sophie tonlos. „Dann hat sie ja Schuld am Tod meines Vaters!“
Noch nie hatte das Stakkato so hart geklungen, das Fortissimo so laut, waren die Läufe so wild den Akkorden entgegengestürmt, den Akkorden, die in ihrer Dissonanz ein einziger Schrei waren, eine zornige Anklage. Sophie hämmerte auf das Klavier. Wo sonst sollte sie ihre Gefühle lassen, wo sonst konnte sie ihnen Ausdruck geben als in der Musik? Und nebenan, so dass Sophie sie durch die geöffnete Tür sehen könnte, wenn sie den Kopf wenden würde, saß die Mutter und hörte ihr Klavierspiel und wusste nicht, dass diese wütende Beschuldigung ihr galt.
Wie sich auf einmal alles zusammenfügte: das Schweigen der Mutter über den Tod des Vaters, das Schweigen, das auch Frieda mit hineinzog und Frau von Klaasen und überhaupt jeden, von dem Sophie etwas über ihren Vater hätte erfahren können. Das mehr als unterkühlte Verhältnis zwischen der Mutter und Onkel Albrecht, Oberst von Zietowitz, der sich nicht öfter als zwei, drei Mal im Jahr bei ihnen blicken ließ, obwohl er doch auch in Berlin wohnte, und der zwar für die Ausbildung ihres Bruders Karl an der Kadettenschule aufgekommen war, der Mutter aber noch nicht einmal einen Blumenstrauß zum Geburtstag schickte. Die plötzliche Armut, in der sie seit dem Tod des Vaters lebten, der Umzug aus der großen Wohnung in der Beletage hierher in die kleine, der Verkauf der meisten Möbel, Einrichtungsgegenstände und Wertsachen — wahrscheinlich hatte der Vater ein Testament gemacht, in dem er seiner Frau nichts hinterließ, da sie ihn so schändlich hintergangen und in den Tod getrieben hatte ...
Hatte der Vater auch Briefe gefunden, in denen stand, dass seine Frau ihn mit einem anderen verlassen wollte? Und nun war der Vater tot.
Das Presto endete mit Zorn. Ich hasse dich, Mutter, ich hasse dich! Wenn Frauen einander zum Duell fordern könnten, ich würde dich fordern. Mit Pistolen im Morgengrauen. Damit du erlebst, was mein Vater deinetwegen erleiden musste.
Sophie schluckte. Was waren das für Gedanken! Dabei hatte sie ja keine Beweise. Im Grunde waren es nicht mehr als Vermutungen. Vielleicht hatte das Duell auch einen anderen Anlass gehabt. Aber sie wusste genau, dass der Vater damals von der Mutter nicht Abschied genommen hatte. War das nicht Beweis genug?
Das Adagio klagte leiser, doch nicht weniger schmerzvoll. Ihr war, als würde ihr Herz verbluten, während sie es spielte. So wie das Herz ihres Vaters verblutet war.
Schließlich saß Sophie still am Klavier, das Gesicht in den Händen verborgen.
Aus dem Hinterzimmer drang das Husten der Mutter und dann ihr Rufen: „Komm wieder sticken, Sophie!“
Mit einem heftigen Knall schloss Sophie den Klavierdeckel. Kurz suchte sie den Blick des Vaters auf dem Gemälde über der Kommode. „Ich bekomme es heraus!“, versprach sie ihm flüsternd. Dann ging sie zur Mutter.
Sehr gerade saß diese dicht am Fenster, den Stickrahmen mit der Gobelinstickerei in der Hand. Garnstränge in den verschiedensten Farben waren auf dem Tisch vor ihr ausgebreitet. Mit kühlem Blick musterte Sophie ihre Mutter wie eine Fremde, betrachtete sie aus lieblos kritischer Distanz, sah die feinen Linien um den Mund, die von Enttäuschung, Stolz und Selbstbeherrschung sprachen, bemerkte die auffällige Blässe und die Müdigkeit, welche die Augen umschattete. „Du bist erschöpft“, stellte sie fest und hörte selbst den Klang ihrer Stimme, kalt und ohne Mitgefühl. „Wenn Vater noch lebte, bräuchten wir nicht den ganzen Tag zu sticken!“
„Wenn!“, erwiderte die Mutter harsch. „Nun ist es, wie es ist. Eine Zietowitz tut in jeder Lage ihre Pflicht — und eine geborene Rieskow allemal. Außerdem bin ich nicht erschöpft, sondern erkältet. Ich habe Frieda schon zum Prinz-Albrechtschen Garten geschickt, damit sie mir eine Flasche Brunnenwasser von dort bringt. Falls das gegen den Husten nicht hilft, werde ich nach Doktor Schneider schicken müssen. Freilich — die Ausgabe würde ich gerne sparen.“ Die Mutter hustete und presste dabei ihr Taschentuch an den Mund. Sichtlich bemühte sie sich, den Husten zu unterdrücken. Es gelang ihr nicht.
Sophie setzte sich und nahm ihre Stickerei wieder auf. „Halte dich gerader!“, ermahnte die Mutter sie, kaum dass der Hustenanfall vorbei war. „Du weißt doch, eine Dame muss so aufrecht sitzen, als ob sie ein Lineal im Rücken hätte! Leicht sollst du wirken beim Sticken, vergiss nicht, in den Augen der Gesellschaft vertreibst du dir die Zeit mit einer angenehmen Beschäftigung. Kein Beobachter dürfte auch nur von dem Gedanken gestreift werden, es sei eine Arbeit, die du verrichtest. Eine Dame arbeitet nicht. Und wenn sie es doch tut, dann muss es aussehen wie Müßiggang. Dieser Grundsatz muss dir in Fleisch und Blut übergehen, zu deiner zweiten Natur werden. Du aber beugst dich über deine Stickerei, als wärest du eine x-beliebige Näherin.“
Sophie schwieg. X-beliebige Näherin. Wie sie solche Sätze hasste!
„Und was das Presto angeht — technisch perfekt. Aber dieser Ausdruck: alles andere als angemessen, Sophie. So könntest du es auf keiner Gesellschaft hören lassen, es klang ja, als wolltest du auf die Barrikaden von Paris stürmen! Und nicht als Soldat des Königs, sondern als dieses unsägliche Weib mit der Fahne in der Hand, wenn du weißt, welches Gemälde ich meine. Das Schlimmste aber war deine Haltung dabei, oder besser gesagt deine exaltierten Bewegungen, alles andere als damenhaft, völlig selbstvergessen. Dazu neigst du überhaupt beim Pianospielen. Übertriebenes Mitgehen mit der Musik wirkt bei einer Dame deplatziert, um nicht zu sagen degoutant. Nun schau nicht so beleidigt, ich will dir mit meiner Kritik doch nur helfen, vor den Augen der Gesellschaft eine gute Figur zu machen!“
Sophie biss die Zähne aufeinander. Nichts sagen, sonst würde sie schreien. Nichts sagen, dann ging es vorüber.
Schweigend arbeiteten sie. Unter Sophies Händen entstanden die Umrisse einer Rosenblüte, die Blätter, der Stiel. Sie sah kaum, was sie schuf, unzählige Male hatte sie schon das gleiche Muster auf Handtäschchen, Sofakissen, Schmuckdöschen und Polsterbezüge gestickt.
Hin und wieder streifte sie von der Seite das Gesicht ihrer Mutter mit einem kurzen Blick. Die Mutter schien wirklich krank zu sein. Das Atmen machte ihr Mühe, feine Schweißperlen standen auf ihrer Stirn, und ihre Augen wirkten seltsam matt und glänzend zugleich.
Hat diese Frau da meinen Vater auf dem Gewissen? Hat sie ihn verlassen wollen, meinen Bruder und mich verlassen wollen, mit einem anderen Mann die Flucht geplant? Beziehung. Was sind diese sogenannten Beziehungen, dass sie so unaussprechlich sind und Offiziere sich deswegen duellieren? Um einen Kuss allein kann es dabei nicht gehen, da muss noch etwas anderes sein, etwas Dunkles, Verborgenes, etwas, was ich nicht wissen soll, weil es angeblich die Unschuld einer höheren Tochter gefährdet. Du sollst nicht ehebrechen ...
Und wenn ich ihr nun unrecht tue? Wenn meine Mutter am Tod meines Vaters unschuldig ist und ich sie hier ganz fälschlich verdächtige? Dann versündige ich mich gegen sie.
Mein Gott, hilf mir doch! Ich halte diese Gedanken nicht mehr aus!
Der Mann lag mitten im Schnee, kopfüber. Ein Säbel steckte in seinem Rücken. Nun erhob er sich taumelnd, drehte sich herum, brach wieder in die Knie. Blut lief über seine weiße Weste und tropfte in den Schnee, färbte ihn rot.
Sie wusste, sie musste ihm helfen. Aber sie stand starr und konnte sich nicht rühren. „Deine Mutter“, flüsterte er heiser, „sag ihr ...“ Er fiel vornüber, sein Gesicht grub sich in den Schnee. Keuchend ratterte ein Dampfzug über den Bahndamm.
Mit klopfendem Herzen lag Sophie im Bett. Die Mutter hustete. Sophie drehte sich auf die Seite, drückte das eine Ohr auf das Kopfkissen, presste die Zudecke gegen das andere, es nützte nichts. Wie sollte man schlafen bei diesem ständigen Husten der Mutter?
Wie sollte man schlafen bei solchen Träumen?
Die ganze Nacht schon jagten sie sich, einer nach dem anderen.
Immer und immer wieder der Vater in seinem Blut. Deine Mutter, sag ihr ...
Nun hatte sie die letzten Worte des Vaters nicht gehört, konnte seinen Willen nicht erfüllen. Würde die Wahrheit nie erfahren.
Am liebsten wäre sie aufgestanden, hätte die Mutter bei den Schultern gepackt, hätte sie gerüttelt und angeschrien: Hör auf zu husten! Sag mir lieber die Wahrheit! Was war das mit dem Duell? Warum hast du nicht Abschied von Vater genommen? Warum musste er sterben? Warum sind wir nach seinem Tod in Armut gestürzt? Was hast du mit Vaters Tod zu tun?
Sie tat es nicht. Sie würde es nie tun. Sie war eine Zietowitz, sie wusste, was sich gehörte und was nicht. Sie würde schweigen — und wenn sie daran erstickte.
Doch wie sollte sie weiterleben, mit der Mutter zusammenleben mit diesen Gedanken? Schwer genug war es, seit dem Abschluss der Höheren Töchterschule bis auf hin und wieder ein paar Stunden bei Cecilie die ganze Zeit mit der Mutter zu verbringen, jeden Augenblick unter deren Aufsicht zu stehen, von ihr pausenlos beobachtet, korrigiert, getadelt und angewiesen zu werden, sich deren Diktat von gutem Ton und erstrebenswerter Bildung unterordnen zu müssen. Schwer genug. Doch nun, wo die Fragen um den Tod des Vaters und der entsetzliche Verdacht hinzugekommen waren, erschien es Sophie völlig unerträglich.
Nebenan in der Küche rumorte es. Selbst Frieda konnte nicht schlafen, weil die Mutter sie alle mit ihrem Husten weckte. Frieda, das altgediente Dienstmädchen, das die Antworten wusste, aber nicht preisgab, weil die Mutter es verboten hatte.
Da war es wieder, das Kind, verängstigt in seinem Bett. Draußen im Flur schrie die Mutter. Und dann war Frieda da, Frieda mit ihren rauen Händen und weichen Brüsten, Frieda, die sie an sich drückte und sie wiegte und flüsterte: Ist ja gut, Sophie, ist ja gut. Ach Gott, Kindchen, armes Wurm! Hast keinen Vater mehr, weil der jetzt im Himmel ist, beim lieben Gott. Aber Frieda lässt dich nicht allein, die ist immer für dich da, das schwör ich dir.
Sophie lag ganz still. Diese Erinnerung, sie musste doch noch weitergehen. Hatte Frieda noch etwas gesagt, damals, am Morgen des 6. März?
Aber da war nichts mehr, nur das.
Die Mutter hustete. Sophie presste die Hände an die Ohren. Könnte sie einfach weggehen! Aufstehen, sich anziehen, Mantel, Hut und Muff nehmen, die Wohnung verlassen ohne ein Wort und niemals wiederkehren. Nein, nicht ohne ein Wort, von Frieda würde sie Abschied nehmen und ihr versprechen, dass sie ihr eine Karte schickte.
Und dann? Nach Hamburg fahren und sich nach Amerika einschiffen? Ach, was für ein Unsinn, ihr Geld reichte nicht einmal für eine Fahrkarte bis Hamburg, geschweige denn für die Überfahrt nach Amerika! Und auch wenn sie Englisch gelernt hatte, war ihre Bildung ansonsten mit Sicherheit nicht die richtige Voraussetzung, um sich in Amerika durchzuschlagen.
Also nicht Amerika. Nicht einmal ein paar Straßenzüge weiter in Berlin. Denn schließlich, womit sollte sie ihr Geld verdienen? Mit Sticken vielleicht? Wie wenig man dafür bekam, das wusste sie zur Genüge, es würde für Essen und Kleidung reichen, doch nicht für eine Wohnung oder ein Zimmer in einer anständigen Pension. Eine Stellung als Gouvernante oder Gesellschafterin, irgendwo auf einem Gut in der Mark oder in Ost- oder Westpreußen? Immerhin sprach sie gut Französisch und ganz passabel Englisch, konnte ordentlich Klavier spielen, singen und vorlesen, und in Fragen des Benehmens war sie so sicher, wie man es nur durch eine gute Kinderstube werden konnte. Ja, Gouvernante oder Gesellschafterin, das wäre das Einzige überhaupt, wofür sie das Rüstzeug hätte, was für sie denkbar wäre.
Aber wie sollte sie eine Anstellung bekommen, ohne Referenzen! Und ohne die Einwilligung ihrer Mutter und ihres Onkels. Mit so einem Namen, den jeder kannte. Keine einzige Familie würde es geben, die eine Zietowitz engagierte, ohne sich zu vergewissern, dass die Baronin von Zietowitz und der Oberst von Zietowitz damit einverstanden wären. Und diese Einwilligung würde sie niemals bekommen, unter keinen Umständen, denn Mutter und Onkel würden es als der Familienehre abträglich empfinden, wenn sie sich für Bezahlung engagieren ließ.
Und die Verwandten? Konnte sie zu den entfernten Verwandten reisen, bei denen durch das Majorat das Erbe geblieben war, das Schloss und das Gut, und sie um Aufnahme bitten? Sophie verzog das Gesicht. Denen auf der Tasche zu liegen als die arme Nichte, der man wohl oder übel Asyl gewähren musste und die man dafür täglich spüren ließ, wie unwillkommen sie war ...
Nein. Es gab keinen Ort, wohin sie gehen konnte.
Wenn nur einer käme, einer, durch den alles anders würde, mit einem Schlag! Einer, der sie fragen würde, ob sie mit ihm käme. Ja, würde sie sagen, bis ans Ende der Welt, und je weiter weg, desto lieber!
Aber da war keiner. Bei den Bällen zog sie bewundernde Blicke auf sich, das schon, manchmal erhielt sie auch galante Bemerkungen oder gar den Vorschlag eines Ausflugs in den Wintergarten. Aber nicht mit einem der Herren, die sie zum Tanz aufgefordert hatten, war es so gewesen wie mit Fürst Andrej und Natascha. Nicht einer hatte ihr Herz berührt. Und darauf kam es doch an, aufs Herz.
Sah denn keiner, was für ein Herz in ihr auf ihn wartete? Merkte keiner, dass da eine ganze Welt in ihr war wie ein unterirdischer See, der noch nicht entdeckt worden war? Ein ganzes verborgenes Meer von Liebe und Sehnsucht und Glück, das an die Oberfläche drängte und doch verschlossen war hinter einer eisernen Tür mit sieben Riegeln.
Ein trockenes Schluchzen war in ihrer Brust. Und sie rettete sich dahin, wohin sie sich immer rettete: in die Geschichten. Solange sie zurückdenken konnte, hatte sie sich immer Geschichten ausgedacht, auch davon geträumt, sie aufzuschreiben, wenn sie einmal groß war, sie hatte ja nicht geahnt, wie wenig Zeit sie haben würde, wenn es erst so weit war. Aber das Geschichtenerfinden, das ging immer weiter. Das war die Flucht, die keiner ihr nehmen konnte, nicht einmal die Mutter.
Mühelos nahm sie den Faden wieder auf, wo sie ihn ruhen gelassen hatte: bei dem jungen Rittmeister, der auf der Vorhut im Wald in einen Hinterhalt geraten und für tot gehalten und liegengelassen worden war, und bei der Förstertochter, die ihn gefunden und gerettet hatte. Und da pflegte sie ihn nun in ihrem Elternhaus, und keiner durfte wissen, dass er hier war, denn er war ja im Feindesland, und dann kamen Soldaten und ...
An der Tür, die das Hinterzimmer mit der Küche verband, klopfte es leise, und dann trat Frieda herein, in der einen Hand einen Becher, in der anderen einen Leuchter. „Gnädige Frau“, sagte Frieda, „ich hab' Sie so schrecklich husten hören, da hab' ich den Herd wieder angefeuert und einen Fencheltee gekocht. Wenn Sie mir den Schlüssel zur Speisekammer geben, dann kann ich Ihnen auch noch einen Honig herausholen, das wird Ihnen guttun, es gibt nichts Besseres als heißen Tee mit Honig bei so einem Husten.“ Damit stellte sie Leuchter und Becher auf das Tischchen und beugte sich über das Bett der Mutter, um dieser zu helfen, sich aufzurichten.
„Mein Gott, gnädige Frau!“, rief sie dann entsetzt. „Sie glühen ja! Und ganz nassgeschwitzt! Schnell, Fräulein Sophie, stehen Sie auf, wir müssen der Frau Major was Trockenes anziehen, sonst verkühlt sie sich noch mehr, und das Bett frisch beziehen, und dann will ich gleich zum Doktor laufen. Ihre Mutter ist gar nicht mehr ganz bei Sinnen vor lauter Fieber! Gott, ach Gott, die gnädige Frau so krank und ruft nicht nach mir! Holen Sie nur gleich ein frisches Nachthemd aus dem Schrank, gnädiges Fräulein!“
Sophie stieg aus dem Bett, warf sich den Morgenmantel über, schlüpfte in die Pantoffeln und zwängte sich zwischen Tisch und Kommode zum Schrank. Das Nachthemd in der Hand stand sie daneben, als Frieda der Mutter das durchgeschwitzte Hemd auszog und ihr damit Brust und Rücken abrieb. Sophie wollte nicht hinschauen und tat es doch.
Seit rund zwölf Jahren schlief sie mit der Mutter im selben Raum. Aber noch nie hatte sie diese unbekleidet gesehen, stets zogen sie sich voreinander verborgen hinter dem Paravent um. Und nun war da der nackte Oberkörper ihrer Mutter. Der Busen. Sophie starrte wider Willen.
Beschämend fand sie es für die Mutter und für sich selbst. Hatte Frieda denn nicht das geringste bisschen Schamgefühl, sonst war Frieda doch auch nicht so! Die Mutter jedoch ließ es ergeben mit sich geschehen, die Augen geschlossen, zu keinerlei Widerstand mehr in der Lage, auch nicht zur Wahrung ihrer Würde. Und an dieser Tatsache plötzlich begriff Sophie: Ihre Mutter war todkrank.
Da kam Bewegung in Sophie. Sie half Frieda, das Bett frisch zu beziehen, die Kissen aufzuschütteln, der Mutter den Tee einzuflößen und ihr einen Brustwickel zu machen. Sie hielt die Mutter an den Schultern, während ein Hustenanfall sie erschütterte. Dann eilte Frieda davon, und Sophie zog sich rasch an und räumte das Zimmer auf. Die schmutzige Bettwäsche und das gebrauchte Geschirr in die Küche bringen, die Kleider der Mutter hinter dem Paravent verschwinden lassen, das Fenster kurz öffnen, das eigene Bett machen und zudecken, die Petroleumlampe anzünden. Arbeiten, um nicht denken zu müssen. Vor allem nicht das eine: Hat mein Hass sie krank gemacht? Kann mein Hass sie etwa töten?
Hör auf!, rief sie sich selbst zur Ordnung. Lass solche heidnischen Gedanken! Christlich sind sie jedenfalls nicht. Bete lieber! Aus tiefer Not schrei' ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Lass meine Mutter nicht sterben, Gott! So war es doch nicht gemeint. Und selbst wenn sie schuld ist am Tod meines Vaters ... Nein, so geht das nicht.
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein Name ...
Sie versuchte den Ofen anzufeuern, es gelang ihr nicht, noch nie in ihrem Leben hatte sie sich darum kümmern müssen. Schließlich gab sie es auf. Nun fiel ihr nichts mehr ein, was sie tun könnte.
Wie lange dauerte es denn noch, bis Frieda endlich mit diesem Doktor Schneider zurückkam! Er würde doch gleich kommen, oder? Und wenn Frieda es nicht schaffte, ihn dazu zu bringen, mitten in der Nacht? Sie hätte lieber selbst gehen sollen, dann hätte er sich nicht entziehen können. Aber nein, das war unmöglich, eine junge Dame durfte nicht nachts auf die Straße, das war ganz und gar ausgeschlossen. Selbst wenn es für die Mutter um Leben und Tod ging?
Die Mutter hustete, ohne die Augen zu öffnen. Rang spürbar nach Luft. Und dann begann sie zu zittern. Sie zitterte so, dass es sie richtig schüttelte. Gespenstisch klapperten die Zähne aufeinander. Wie weiß ihr Gesicht war und wie unnatürlich rot die Backen glühten! Und die Lippen, bildete sie sich das ein, oder waren die Lippen wirklich bläulich? Und dieses Zittern der Nasenflügel, bei jedem Atemzug bebten sie, so etwas hatte sie noch nie gesehen — Doktor Schneider, um Himmels willen, beeilen Sie sich!
Sophie sprang auf, deckte ihr Bett wieder ab, nahm ihr Federbett und türmte es über das der Mutter. Die Mutter zitterte vor Schüttelfrost.
Aus der Kommode holte Sophie die alte schwere Kamelhaardecke und breitete sie ebenfalls über das Bett. Die Mutter zitterte. Jeder Atemzug klang wie ein Stöhnen. Diese Atemnot ...
Da setzte sich Sophie auf die Bettkante, nahm die heiße Hand ihrer Mutter zwischen ihre Hände und begann zu singen, sang gegen die Verzweiflung an und gegen die Angst, sang das Lied, das ihr früher die Mutter gesungen hatte, wenn sie krank gewesen war: „Der Mond ist aufgegangen, die güldnen Sternlein prangen ...“ Sie sang Strophe um Strophe. Ihr schien, die Mutter wurde ruhiger, das Zittern ließ nach. „Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unsre kranke Mutter auch“, sang Sophie. Da ging draußen die Tür, und kurz darauf trat Doktor Schneider herein.
Noch niemals war sie beim Anblick eines Menschen so erleichtert gewesen wie jetzt bei seinem. Die Verantwortung in kompetente Hände abgeben zu können und einen Ort zu haben, an den sie ihre Angst tragen konnte. Beinahe wortlos begrüßte sie ihn und machte den Platz frei am Bett ihrer Mutter.
Die Untersuchung beobachtete sie von ferne, das Fiebermessen, das Abklopfen und Abhorchen der Brust, das Pulsfühlen. Wie routiniert er das alles machte, wie sicher und doch gleichzeitig behutsam — ihm konnte man vertrauen. Er würde wissen, was zu tun war. Als die Mutter von einem neuen Hustenanfall erschüttert wurde, wandte er sich an Frieda: „Ein Spucknapf! Rasch!“ Dann sprach er eindringlich auf die Mutter ein: „Bitte, gnädige Frau, spucken Sie den Auswurf aus, hier in die Schale, vergessen Sie ausnahmsweise Ihre Kinderstube, ich muss mir das Sputum ansehen!“ Und die Mutter, die Sophie noch niemals hatte spucken sehen, fügte sich.
Ermattet sank die Mutter in die Kissen zurück. Er betrachtete den Inhalt das Spucknapfes — Sophie warf von weitem einen kurzen Blick darauf und erschrak zutiefst, als sie etwas Rotes sah: Blut! —, dann entnahm er seiner Tasche ein Gefäß und wusch sich die Hände. Sie erkannte den scharfen Geruch: Karbolsäure. „Gnädige Frau, Sie haben eine akute beidseitige Pneumonie, will sagen eine heftige Lungenentzündung. Damit ist nicht zu spaßen“, erklärte er mit großem Ernst und legte seine Hand auf die der Mutter. „Wenn Sie es wünschen, weise ich Sie in die Charité ein.“
Die Mutter öffnete die Augen. „Nicht die Charité!“, brachte sie nach Luft ringend hervor. „Keine Klinik. Zu Hause. Sophie ...“ Hilfesuchend ging ihr Blick zu Sophie, ehe sie wieder die Augen schloss.
Sophie schluckte. Nur zu klar war ihr, warum die Mutter eine Klinik ablehnte: Sie hatten das Geld nicht dafür.
Sie kniete am Lager der Mutter nieder, griff nach deren Händen. „Mutter“, fragte sie drängend, „Mutter, sag mir doch, wir könnten ja das Meissner Porzellan verkaufen oder die Standuhr, Mama, bitte ...“
Die Mutter gab keine Regung von sich. Sophie starrte ihr ins Gesicht und begriff: Die Mutter war nicht mehr ansprechbar. Jetzt kam es nur noch auf sie an. Einer plötzlichen Eingebung folgend, wollte sie sich über die Mutter beugen und sie auf die Stirn küssen, doch der Arzt legte ihr die Hand auf die Schulter und hielt sie zurück. „Nicht, Baronesse! Kommen Sie Ihrer Frau Mutter nicht so nahe, es besteht Infektionsgefahr!“
„Infektionsgefahr?“, fragte sie und zuckte zurück.
Er nickte. „Pneumokokken. Das Bakterium hat Professor Koch vor einigen Jahren isoliert. Sie müssen sich vor Ansteckung hüten. Kein unmittelbarer Kontakt mit der Frau Major, schon gar nicht mit dem Sputum, dem Auswurf — immer die Hände desinfizieren, ich erkläre es Ihnen gleich. Und niemals anhusten lassen, wir wollen doch nicht zwei Patientinnen haben! Das ist einer der Gründe, warum ich die Klinik vorgeschlagen habe. Aber wenn Sie und das Dienstmädchen sich an meine Instruktionen halten, werden wir das in den Griff bekommen.“
„Sie meinen, es geht auch zu Hause?“, fragte sie mühsam den Arzt.
Dr. Schneider nickte. „Wenn ich der Meinung wäre, dass die Einweisung in die Klinik die einzig richtige Entscheidung wäre, hätte ich das mit großer Bestimmtheit erklärt und nicht Ihrer Frau Mutter anheimgestellt. Im Gegenteil, vielleicht sind die Heilungschancen zu Hause sogar besser. Viel ausrichten kann die Klinik auch nicht. Jetzt ist alles eine Frage der richtigen Maßnahmen und der richtigen Pflege, der Konstitution Ihrer verehrten Frau Mutter und des Willens von dem da oben“, damit drehte er seine Augen kurz zur Zimmerdecke.
„So ernst?“, brachte Sophie heiser hervor.
„Ernst“, bestätigte er ruhig, „aber ich habe die Hoffnung, dass die verehrte Frau Major durchkommt. Am meisten Sorge macht mir nicht die Lunge, sondern das Herz. Ich schreibe Tropfen dafür auf, Hustensaft, Stärkungsmittel, alles, was möglich ist. Doch das Wesentliche ist die Pflege. Soll ich Ihnen behilflich sein, eine professionelle Pflegerin zu engagieren?"
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, die Pflege übernehme ich selbst. Oder meinen Sie, ich kann das nicht?“
Er lächelte. „Sie können es mit Sicherheit, gnädiges Fräulein, daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Allerdings steht Ihnen da eine anstrengende Zeit bevor. Doch der Tochter eines preußischen Offiziers liegt die Pflichterfüllung im Blut, nicht wahr? Ich bin gewiss, Sie werden meine Anweisungen auf das Genaueste einhalten. Und ich werde zweimal täglich vorbeischauen. Gehen wir in den Salon, dann erkläre ich Ihnen, worauf es ankommt!“
Sophie nickte. Sie würde alles tun, alles.
„Ich habe drüben eingeheizt“, erklärte Frieda, vom Salon hereinkommend. „Jetzt legen Sie sich nur noch einmal hin, Fräulein Sophie, ich bin wieder an der Reihe am Bett von der gnädigen Frau! Sie müssen zusehen, dass Sie bei Kräften bleiben. Wenn Sie auch noch krank würden, nicht auszudenken!“
Sophie nickte und stand auf. Seit die Mutter krank war, hatte Frieda stillschweigend so etwas wie eine Mutterrolle übernommen, und obwohl das nicht in Ordnung war, es tat gut.
Sophie achtete darauf, dass alle Anweisungen von Doktor Schneider erfüllt wurden: die richtige Lagerung der Mutter im Bett mit einer zusammengerollten Decke unter dem Brustkorb, das Befeuchten der Luft mit nassen Tüchern überall im Raum, das gründliche Lüften und immer wieder die Freiluftbäder, für die sie das Bett direkt ans offene Fenster rückten und bei denen die Mutter genau beobachtet werden musste, damit sie sich nicht abdeckte und verkühlte, die Herztropfen und der Hustensaft, die Brustwickel und Einreibungen, die fiebersenkenden Maßnahmen, das unermüdliche Einflößen von Honigtee und alles andere. Frieda aber achtete auf das Aufrechterhalten des Haushaltes und vor allem auf sie, auf Sophie.
„Was täte ich nur ohne dich, Frieda?“, seufzte Sophie und lächelte müde der alten Dienerin zu.
„Nun aber mal halblang!“, meinte diese. „Ich hab' Sie gepflegt, als Sie die Masern, die Windpocken und den Keuchhusten hatten — und da soll ich mich jetzt nicht um Sie sorgen dürfen?“
„Ach, Frieda!“ Ein letzter Blick auf die Mutter, die mit geschlossenen Augen dalag und stöhnend nach Luft rang. Konnte sie sie jetzt wirklich verlassen? Ihr schien, der Atem ging immer schwerer. Und das Fieber war höher denn je. „Aber wenn etwas ist, dann rufst du mich gleich! Und wenn Herr Doktor Schneider kommt, auch!“
„Aber ja doch, gnädiges Fräulein, da können Sie ganz getrost sein!“, beruhigte Frieda sie.
Sophie ging in den Salon, in dem auf Anraten von Doktor Schneider nun auf dem Sofa ihr Lager aufgeschlagen war, zog den Morgenmantel aus und schlüpfte unter die Decke. Todmüde fühlte sie sich, zum Umfallen erschöpft. Die erste Hälfte der Nachtwache hatte Frieda gehalten, doch seit Mitternacht sie selbst. Draußen graute der Morgen nach einer Nacht, in der sie Stunde um Stunde in dem Sessel gesessen, die Mutter beobachtet und ihr Handreichungen gemacht hatte. Sie war am Ende. Nur eine halbe Stunde schlafen —
Kaum lag Sophie, war sie überwach. Ihre Augen brannten. Unruhe im ganzen Körper. Ein dumpfes Ziehen und Krampfen in den Beinen.
Dreimal war Doktor Schneider gestern gekommen. Drei Mal. Das sagte mehr als alle Worte: Es stand äußerst ernst um die Mutter.
Und wenn die Mutter starb?
Sophie presste die Faust vor den Mund. Soll ich meinem Bruder telegrafieren, er ist in Westpreußen stationiert?, hatte sie gestern Abend den Herrn Doktor gefragt. Er hatte kurz überlegt und dann genickt: Telegrafieren Sie, gnädiges Fräulein. Er soll dringend um Urlaub ersuchen — die Krankheit nähert sich der Krisis. Ich will es Ihnen nicht verhehlen: Bald wird sich entscheiden, nach welcher Richtung der Zeiger ausschlägt. Die naturwissenschaftliche Medizin ist das eine, da tue ich, was in meiner Macht steht, doch ein Serum gegen Pneumokokken gibt es nicht. Oft genug sind uns Ärzten die Hände gebunden, dann heißt es auf das andere vertrauen, auf das, was wir nicht in der Hand haben, das Unwägbare. Da spielen der Glaube hinein und die Gefühle. Vielleicht, wer weiß, gibt die Liebe eines Sohnes den Ausschlag fürs Leben.
Und die Liebe einer Tochter? Konnte die nicht das Leben herbeiwünschen? Oder der Hass den Tod?
Sophie grub die Zähne in den Knöchel ihres Daumens. Hass war es doch nicht, was sie ihrer Mutter gegenüber empfunden hatte, das musste sie sich doch nicht vorwerfen, oder? Aber so vieles hatte sie unerträglich gefunden, all dies Starre, das Gegängeltwerden, besonders aber das Schweigen ...
Am liebsten hätte sie die Gedanken aus ihrem Kopf herausgerissen, die sie in letzter Zeit gehabt hatte, den ganzen Ärger über die Mutter — vor allem aber den schrecklichen Verdacht gegen sie. Es ging nicht. Sie öffnete die Augen. Kein Gedanke an Schlaf. Ihr Blick fiel auf den Sekretär.
Ich darf das nicht. Sie würde es nicht wollen. Ich würde ihre Krankheit ausnützen, um sie zu hintergehen. Und sie liegt nebenan, krank auf den Tod.
Aber ich muss es wissen! Jetzt dringender denn je.
Sophie sprang aus dem Bett, lief zum Sessel, holte den Schlüsselbund aus der Tasche ihres Morgenmantels, den Schlüsselbund der Mutter, der seit deren Erkrankung in ihre Obhut übergegangen war.
Sie fingerte den kleinsten Schlüssel heraus, den Messingschlüssel mit dem zierlichen Bart, erprobte ihn an der Schreibklappe des Sekretärs. Mühelos ließ diese sich aufschließen. Sophie zog den Stuhl heran, setzte sich, öffnete ein Fach nach dem anderen, blätterte in vergilbten Papieren und alten Briefen, zog Kästchen heraus, fand angelaufene Schmuckstücke, Orden, eine braune Locke am verblichenen blauen Band und getrocknete Blumen, und dann endlich eine Mappe, auf welcher der Name ihres Vaters stand. Schon als sie die Schleife löste, mit der die Mappe zugebunden war, wusste sie, dass sie am Ziel ihrer Suche war.
Als Erstes fiel die Todesanzeige heraus.
Ihre Hände zitterten, als sie diese aufnahm, doch erfuhr sie aus der Anzeige nichts, was sie nicht schon wusste — kein Wort von Duell. Dann aber der erste kurze Zeitungsausschnitt:
Duell im Morgengrauen
Wie jetzt erst bekannt wurde, fiel Baron Woldemar von Zietowitz, Major des 2. Garderegimentes Seiner Majestät, am vergangenen Dienstag bei einem Duell in den frühen Morgenstunden. Der Zweikampf fand in Anwesenheit der Sekundanten auf dem Tempelhofer Feld statt. Er wurde mit Pistolen ausgetragen. Major von Zietowitz wurde bereits von der ersten Kugel tödlich getroffen. Sein Herausforderer war der Reserveleutnant Walter Hansen, welcher Major von Zietowitz für den Freitod seiner Tochter Elisabeth verantwortlich machte. Major von Zietowitz hatte kurzfristig eine Beziehung zu der bis dahin unbescholtenen fünfzehnjährigen Elisabeth Hansen unterhalten.
Sophie starrte auf den Zeitungsausschnitt. Sie las, und doch blieb ihr fern und fremd, was sie las. Kein Gefühl, nichts. Langsam erst tropften einzelne Worte in ihr Bewusstsein. Freitod — Beziehung — unbescholtene fünfzehnjährige Elisabeth. Da stand der Name ihres Vaters. Und doch konnte es nichts mit ihm zu tun haben, es war nicht möglich.
Sie fror.
Für ungezählte Minuten saß sie zitternd da, spürte nichts als diese Kälte und Fremdheit. Dann endlich griff sie nach dem nächsten Zeitungsausschnitt. Er würde alles zurechtrücken, das Missverständnis erklären, die Wahrheit offenbaren.
Die ersten Absätze las sie, ohne sie aufzunehmen. Doch dann auf einmal trieb es ihren Herzschlag in die Höhe:
Elisabeth Hansen war in anderen Umständen. Tragischerweise wusste sich das minderjährige Mädchen in seiner Verzweiflung keinen anderen Ausweg als den Tod. Elisabeth Hansen sprang von einer Spreebrücke und kam ums Leben. Sie hinterließ einen Brief, in dem sie ihre Eltern um Verzeihung für ihren Fehltritt bat und den Namen des Liebhabers offenbarte. Sie habe nicht gewusst, dass Major von Zietowitz verheiratet sei, er habe keinen Ring getragen. Sie sei des Glaubens gewesen, er meine es ernst.
Ein Laut des Entsetzens entfuhr ihr. Aufspringen wollte sie, weglaufen, nichts wissen von alldem und las doch weiter, nun mit fliegender Hast. Die Zeitungsartikel berichteten immer neue Details, in rücksichtsvollen Worten für den hochrangigen Toten und die Gefühle der Leser die einen, in schonungsloser Anklage oder genüsslicher Breite die anderen:
Inhaber eines kleinen Dachdeckerbetriebes fordert blaublütigen Major — einzigartiges Duell
Damit hatte Baron von Zietowitz wohl nicht gerechnet, als er sich den Ehering abzog und beim Tanzen in einem Wilmersdorfer Gartenlokal ein blutjunges Mädchen verführte: dass der Vater des Mädchens als Einjähriger gedient und es bis zum Reserveleutnant in einem Pionierregiment gebracht hatte. Und auf einmal wurde aus einer kleinen Affäre, die der Baron vermutlich mit Geld zu regeln gedachte, ein tödlicher Zweikampf.
Es darf angenommen werden, dass sich der zweiundvierzigjährige Major des Sittlichkeitsverbrechens der Verführung einer unbescholtenen Minderjährigen schuldig gemacht hat. Sein arglistiges Vorgehen erweist sich darin, dass er sich den Ehering vom Finger zog, ehe er das fünfzehnjährige Mädchen ansprach. Sind in unserem Land unschuldige, ahnungslose junge Mädchen etwa Freiwild? Doch so verständlich die Gefühle sind, die den Vater des unglücklichen Mädchens trieben, den Major zu fordern — man hätte sich gewünscht, Reserveleutnant Hansen hätte stattdessen den Major angezeigt und dieser wäre zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.
Gefängnisstrafe?! Wie ein gemeiner Verbrecher! Sittlichkeitsverbrechen ... Schon allein dieses Wort! Und das sollte ihr Vater sein, er?
Den Ehering abgezogen. Verführung. Minderjährig. Unmöglich, es war unmöglich, und doch, all die Artikel ...
Und das Mädchen, dieses arme, arme Mädchen. In anderen Umständen!
Auch wenn die Mutter niemals mit ihr über dergleichen sprach und es in der Schule ein totgeschwiegenes Thema gewesen war, so ahnungslos war sie denn doch nicht, dass sie nicht wusste, was das bedeutete.
Elisabeth Hansen hatte ein Kind erwartet, und der Vater war schuld daran. Verführt hatte er das arme Mädchen, was auch immer genau das war. Ein Kind zu bekommen, ohne verheiratet zu sein — der Gipfel der Schande. Etwas Schlimmeres konnte es kaum geben. Für eine Offizierstochter unvorstellbar. Vielleicht hätten ihre Eltern sie verstoßen. Da hatte sie sich in ihrer Verzweiflung umgebracht. Mit fünfzehn Jahren.
Tränen liefen Sophie über das Gesicht, Übelkeit fühlte sie in sich aufsteigen. Sie presste die Hand vor den Mund. Hätte sie diese Papiere nie angerührt! Wüsste sie nur nichts von alldem! Und doch blätterte sie weiter, las, weinte, las. Dann hielt sie plötzlich ein Kuvert in Händen, auf dem Agathe von Zietowitz, der Name ihrer Mutter, stand, wendete es um — und erkannte das erbrochene Siegel ihres Vaters. Das durfte sie nicht lesen, nein, das nicht auch noch. Verrat wäre es an der Mutter, die nebenan lag, todkrank. Verrat auch am toten Vater. Doch —
Sophie nahm den Papierbogen aus dem Kuvert.
Liebe Agathe!
Wenn Du dies liest, bin ich nicht mehr. Das letzte Gegenübertreten wollte ich Dir ersparen — oder auch mir. Ich bin da in eine Sache hineingeschlittert, aus der es keinen anderen Ausweg gibt. An sich eine Geschichte, die kaum der Rede wert schien: Ich habe mich in einem Gartenlokal umgetan und ein hübsches Mädchen kennengelernt — mein Gott, ich habe sie nicht gefragt, wie alt sie ist, sie sah sehr reif aus. Und wer konnte ahnen, dass ihr Vater Reserveleutnant ist! Erlauben die Pionierregimenter denn jetzt schon Krethi und Plethi, ihr Offizierspatent zu erwerben, sogar einem Dachdecker? Welcher Offizier lässt seine Tochter sonntags allein mit zwei Freundinnen zum Tanz? Aber dieser Herr Hansen tat mir immerhin den Gefallen, mir einen Sekundanten zu schicken und nicht die Polizei. Dann wäre mir auch nur der Tod geblieben, denn dass ein Zietowitz ins Gefängnis geht, und sei es nur für ein paar Monate, ist unvorstellbar — und wie so etwas angesichts Elisabeths tragischem Freitod vor Gericht ausgehen würde, wüsste man nie. Das Schießen wird Herr Hansen bei den Pionieren ja gelernt haben, und ich halte ihm meine Breitseite hin.
Liebe Agathe, ich kenne Deinen Stolz und weiß, wie sehr es den trifft. Vor allem wird sich die Presse genüsslich auf die Berichterstattung stürzen. Verzeih mir, wenn Du kannst. Du warst immer eine untadelige Ehefrau. Aber ich bin wohl zur ehelichen Treue nicht fähig, und nun büße ich dafür mit dem Tod. Noch etwas liegt mir schwer auf der Seele: Ich lasse Dich und die Kinder in katastrophalen finanziellen Verhältnissen zurück. Ich habe Dir nichts davon gesagt, weil ich immer noch auf Rettung gehofft habe. Nun ist es zu spät. Ich hatte Aktien gekauft — der Börsenkrach vorletzten Herbst hat sie fast völlig entwertet. Dann kam eines zum anderen. Am Spieltisch, an dem ich sonst so manches Glück gemacht hatte, versuchte ich Land zu gewinnen — es riss mich noch tiefer hinein. Kurz: Ich stecke tief in der Kreide. Auch bei meinem Bruder habe ich Verpflichtungen, die ich nicht einlösen kann, und er besitzt selber nicht mehr viel. Du wirst die Wohnung aufgeben müssen und Deine Preziosen und den meisten Hausrat verkaufen, nur um die Schulden zu begleichen. Ich hinterlasse Dir und unseren Kindern nichts als einen Namen, dessen Ehre mit Blut wieder reingewaschen ist. Verzeih mir, Agathe. Du hättest ein besseres Schicksal verdient.
Woldemar
Das Entsetzen schnürte Sophie die Kehle zu. Da half kein Sträuben mehr und kein Abwehren: Der Vater war es selbst gewesen, der seinen Tod verschuldet hatte. Der Vater, nicht die Mutter. Und nicht nur an seinem eigenen Tod war er schuld, sondern auch an dem dieser Elisabeth. Ein fünfzehnjähriges Mädchen — drei Jahre jünger als sie selbst!
Ein trockenes Schluchzen brach aus ihrer Brust. „Mama!“, stöhnte sie und sprang auf, krachend fiel der kostbare Stuhl um, sie achtete nicht darauf, rannte zur Tür, riss sie auf. Frieda, neben dem Bett der Mutter im Korbsessel sitzend, fuhr zu ihr herum und hob zu einer Frage an. „Geh, Frieda, geh in die Küche, lass mich mit meiner Mutter allein!“, würgte Sophie hervor. Mit einem bestürzten Blick verließ das Dienstmädchen das Zimmer.
Sophie fiel neben dem Bett der Mutter auf die Knie, die Mutter lag da mit weißem, abgezehrtem Gesicht und dunkel umschatteten geschlossenen Augen, ihr Atem ging stöhnend und schwer, bei jedem Atemzug flatterten die Nasenflügel. Dies Antlitz, war es überhaupt noch von dieser Welt?
Sophie ergriff die heiße Hand der Mutter und drückte ihr Gesicht hinein. „Mama“, flüsterte sie, „Mama, du darfst nicht sterben! Bitte, stirb nicht, Mama! Es tut mir leid, was ich gedacht habe, es tut mir leid, was geschehen ist. Mama, was hast du mitgemacht und hast geschwiegen, hast alles alleine getragen, das Herz muss es dir gebrochen haben, aber du hast es nicht gezeigt, hast mir das reine Andenken an den Vater erhalten wollen, nie ein Wort gegen ihn, nie ein Wort von seiner Schuld, so unvorstellbar, was er getan hat, und du, hast mich erzogen, als wäre nichts, hast fast deinen ganzen Besitz verkauft, so tapfer, Mama ...“ Sie küsste den Handrücken, alle Ermahnungen des Arztes in den Wind schlagend, wiederholte immer wieder nur dies eine Wort: „Mama“.
Da auf einmal fühlte sie eine Hand auf ihrem Haar, eine heiße, leichte Hand. Sophie blieb ganz still und spürte dieser Berührung nach, konnte es kaum glauben und wusste doch: Es war die Mutter. Endlich hob sie den Kopf, sah der Mutter ins Gesicht und begegnete deren Blick.
Als wenig später Doktor Schneider kam, erklärte er die Krisis für überstanden und sprach von einem Wunder.
Jede Regung ihrer Mutter beobachtete sie, jedes Stöhnen, jedes Husten, jedes Röcheln. Löffelweise Tee und Hustensaft einflößen, die Stirn kühlen, die Wickel erneuern. Seit Stunden saß Sophie schon wieder am Krankenbett. Sie merkte es kaum. Zeit spielte keine Rolle mehr. Auch die ganze Welt schien versunken, als gäbe es keine Welt mehr außerhalb dieses engen Kreises. Die Gedanken über den Vater, die Pflege der Mutter, sonst nichts.
Dieses Gesicht — wie hager es geworden war. Schmal war es schon immer gewesen, aber nun schien es wie eingetrocknet. Kondensiert. Die Müdigkeit eines ganzen Lebens sah man darin, all diese Anstrengung, den Schein aufrechterhalten zu müssen. Die Mühsal, trotz aller Armut ein standesgemäßes Leben zu führen, den Normen Genüge zu tun. Die Erschöpfung durch das ewige Sticken. Die Bitterkeit über die miserable Bezahlung. Die Notwendigkeit, den beschwerlichen Broterwerb vor den Augen der Gesellschaft auch noch verbergen zu müssen. Und den unbeugsamen Stolz, aus dem die Kraft floss, dies alles zu tun, Tag für Tag. Des Namens wegen. Der Ehre wegen. Der Kinder wegen. Damit die Kinder einmal wieder den Platz einnehmen könnten, den ihr Vater verspielt hatte.
Sophie schluckte. Warum hatte sie das nie gesehen?
Und zu all dem noch die Zerreißprobe, vom Gatten tief gekränkt worden zu sein, womöglich über ihn entsetzt zu sein und ihn zu verachten, und dennoch sein Ansehen hochzuhalten — es zugleich beschädigt zu wissen und diese Beschädigung vergessen zu machen und vor den eigenen Kindern zu verbergen. Was musste die Mutter gelitten haben all die Jahre! Und hatte es niemals gezeigt, nicht ein einziges Mal. Ob die Mutter den Vater noch immer liebte, trotz allem? Ob sie ihn hasste? Oder ob er ihr längst gleichgültig war?
Sie, die Tochter, die praktisch jede Stunde des Tages und der Nacht in der Gegenwart der Mutter verbrachte, sie hatte nicht die geringste Ahnung davon. Eine Agathe von Zietowitz zeigte ihre Gefühle nicht.
Vorsichtig öffnete Sophie die oberen Knöpfe am Nachthemd der Mutter, schob den Wickel etwas zur Seite, sorgfältig darauf bedacht, den Busen der Mutter weder zu entblößen noch zu berühren, strich etwas von der durch Doktor Schneider verordneten Salbe auf die Brust, schloss das Hemd wieder, zog die Zudecke hoch bis unter das Kinn.
Die Mutter öffnete kurz die Augen. Fiebrig glänzten sie, aber sie nahmen die Welt wieder wahr. Einen Atemzug lang kreuzten sich ihre Blicke. Dann schlossen sich die Lider wieder.
Sacht legte Sophie ihre Hand auf die der Mutter. Ihr schien, ihre Hand war willkommen. So viel Nähe hatte Sophie bisher weder gekannt noch gewünscht. Und sie wusste, dass sie auch jetzt nur ein Teil des Ausnahmezustandes war, in dem sich die Mutter befand und sie mit ihr. Wenn die Welt ringsum wieder zu existieren beginnen würde, dann würde kein Gedanke mehr daran sein, die Hand der Mutter zu halten.
Ob die Mutter am Morgen der Krisis verstanden hatte, was sie ihr gesagt hatte? Ob die Mutter begriffen hatte, dass sie in den alten Papieren gelesen hatte und nun über den Tod des Vaters und den Grund ihrer Armut Bescheid wusste?
Kein Wort hatte die Mutter bisher darüber verloren. Sie würde es wahrscheinlich nie tun. Alles, was an jenem Morgen geschehen war, würde dem Schweigen anheimfallen, diesem allgegenwärtigen Schweigen, das nicht nur in dem Ausbleiben einer Antwort bestand, nein, viel mehr noch in der Unmöglichkeit einer Frage. Und doch hatte es diesen Augenblick gegeben und spürte Sophie noch immer die heiße Hand ihrer Mutter auf ihrem Scheitel.
Die Mutter wurde unruhig. Sie stöhnte leise, kein stöhnendes Atmen, sondern ein Stöhnen aus schwerem Herzen. Die Augen rollten unter den geschlossenen Lidern hin und her. Das sind die Fieberträume, hatte Doktor Schneider erklärt, als sie ihn darauf angesprochen hatte, kein Grund zur Sorge, ganz im Gegenteil, alles nehme seinen rechten Verlauf. Dachte die Mutter in ihren Fieberträumen auch immer wieder an den Morgen des 6. März?
Und wenn du dein Nachtgebet sprichst, dann bete für mich. Sagt es, geht hin und lässt sich erschießen von dem Vater des Mädchens, das er ins Unglück gestürzt und in den Tod getrieben hat.
Elisabeth ging noch in die Schule, stand in einer der Zeitungen. Fünfzehn Jahre.
Dieses schreckliche Zitat, dunkel, finster: Verführung einer unbescholtenen Minderjährigen, Sittlichkeitsverbrechen. Was um alles in der Welt ist das genau? Ist es wirklich ganz allein seine Schuld oder nicht auch die des Mädchens? Schließlich hatte es ja seine Eltern um Verzeihung für den Fehltritt gebeten, hieß es in der Zeitung. Aber mein Vater war erwachsen und musste wissen, was er tat, und als Offizier hatte er eine besondere Verpflichtung zu ehrenvollem Lebenswandel. Und sie war nur ein einfaches Schulmädchen, das das Leben noch nicht kannte. Er hat ihr verschwiegen, dass er verheiratet ist, und sie hat geglaubt, er wolle sie heiraten ... Sie war drei Jahre jünger als ich.
Mein Gott, ich habe sie nicht gefragt, wie alt sie ist, sie sah sehr reif aus.
Konnte man diesen Satz seines Briefes als ernste Reue werten? Oder war er nicht eher eine Art von zynischer Rechtfertigung seines Verbrechens? Sophies Herz schlug dumpf. Wie dachte sie hier über ihren Vater! Welche Worte gebrauchte sie für ihn! Er war doch ihr Vater. Und ganz gleich, was er getan hatte, er hatte sie geliebt, und sie hatte ihn geliebt, und sie liebte ihn doch noch immer!
Durfte sie das überhaupt?
Was hatte die Mutter ihr erspart all die Jahre, indem sie ihr nichts davon gesagt und auch noch dafür gesorgt hatte, dass sie es auch von anderer Seite nicht erfuhr! Was wäre ihr erspart geblieben, wenn sie nicht heimlich den Sekretär geöffnet und gegen den Willen der Mutter all diese Papiere gelesen hätte! Dann könnte sie noch immer dieses reine und strahlende Bild ihres Vaters in sich tragen, das Bild des Helden, des Ritters.
Und doch. Und doch. Sie hatte sie wissen müssen, die Wahrheit. Und sie konnte es auch jetzt nicht bereuen, sich Zugang dazu verschafft zu haben, so unerträglich es auch war. Denn das Dunkle, das war ja auch da, wenn man es nicht wusste und nicht sehen wollte, und brach sich seine Bahn. Verfolgt hatte es sie, ohne dass sie geahnt hatte, was es war. Diese Erinnerung an den 6. März, die über sie gekommen war — sie bewies ja, dass sich die Wahrheit nicht totschweigen ließ, mochte die Mutter sich auch noch so sehr darum bemühen.
Wenn es nur einen gäbe, mit dem man darüber reden könnte. Aber es ging nicht. Es war nicht möglich. Und die Einzige, die es könnte, lag hier mit ihrem unbeugsamen Stolz und diesem Schweigen um den Mund.
Wie hatte die Mutter das nur alles ertragen? Geboren und aufgewachsen in einem Schloss. Ein glanzvolles Haus geführt als Baronin von Zietowitz. Und dann das. Zwei Zimmer. Die alte Frieda. Das heimliche Sticken. Jeden Pfennig umdrehen. Und diese schreckliche Geschichte mit dem Vater.
Was für ein Spießrutenlauf musste das damals für die Mutter gewesen sein, als all diese Sachen über den Vater in der Zeitung gestanden hatten. Man hätte sich gewünscht, Herr Hansen hätte den Major angezeigt und dieser wäre zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.
Und das einer Geborenen von Rieskow. Verheiratet mit einem, der ein Verbrechen begangen hatte und sich mit Absicht im Duell hatte erschießen lassen, damit er nicht ins Gefängnis musste.
Und das sollte ihr Vater sein, er, dessen Autorität für sie als Kind unangreifbar gewesen war? Wie hatte sie sich vor ihm gefürchtet, wenn sie zu ihm wegen eines kindlichen Vergehens zitiert worden war, weil sie genascht hatte oder gelogen! Gefürchtet nicht nur wegen des Rohrstocks, viel mehr noch, weil es ihr vorgekommen war, gegen Gott selbst verstoßen zu haben, sich vor Gott selbst rechtfertigen zu müssen und es nicht zu können. Und wie göttliche Gnade war es ihr erschienen, wenn er ihr verziehen hatte. Und nun sollte dieser Gott so schreckliche Sachen gemacht haben.
Wie lieb er gewesen war und wie streng. Wie unangreifbar. Wie hoch er über ihr gethront hatte, unerreichbar, und wie er sich doch immer wieder mit so zärtlicher Liebe zu ihr herabgeneigt hatte.
Sollte das alles nicht mehr gelten? Sollte er wirklich ein Verbrecher sein? Einer, der ein junges Mädchen arglistig getäuscht hatte? Kein Gott, sondern ein Teufel? Nein, nein, nein, so etwas durfte sie nicht denken. Wir sind allzumal Sünder, hatte der Herr Pastor zu sagen gepflegt, bei dem sie Religionsunterricht gehabt hatte. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Was um alles in der Welt war das genau: ein Sittlichkeitsverbrechen?
Was auch immer es war, ein Mädchen hatte sich deswegen umgebracht, von einer Spreebrücke hatte es sich gestürzt. Fast noch ein Kind. Tränen liefen Sophie über das Gesicht, tropften auf ihr Kleid. Draußen ging der Türklopfer, Frieda durchquerte den Raum, um zu öffnen. Sophie merkte es nicht. Erst als Doktor Schneider ihr einen guten Abend wünschte, hob sie den Kopf. Sie sah ihn kaum durch den Schleier von Tränen.
Er neigte sich nicht wie sonst formell über ihre Hand. Er sah sie mit einem Blick aufmerksamer Zuwendung an und legte ihr seine Rechte auf die Schulter. Ruhig, warm, fest. Eigentlich unvorstellbar, dass ein Mann einem jungen Mädchen, mit dem er nicht verwandt war, auf diese Art die Hand auf die Schulter legte. Und doch auf seine Art vollkommen richtig. Diese Berührung, außerhalb jeder gesellschaftlichen Konvention, erreichte tief ihr Herz. Auf einmal fühlte sie sich getröstet. Sie schluchzte erleichtert auf.
Er griff in seine Brusttasche und reichte ihr ein makellos gebügeltes Taschentuch. „Ihre Frau Mutter wird wieder gesund“, sagte er. „Mit all meiner ärztlichen Erfahrung gebe ich Ihnen mein Wort dafür, Fräulein von Zietowitz.“
Sie nickte und weinte. Das Weinen tat gut. Und auf einmal spürte sie das Verlangen, ihren Kopf an seine Schulter zu lehnen und von ihm gehalten zu werden wie von einem Vater.
Da stand sie auf und ging rasch aus dem Raum.