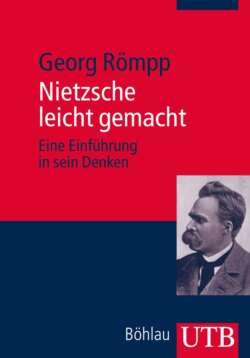Читать книгу Nietzsche leicht gemacht - Georg Römpp - Страница 9
1.2 Apollo und das individuierende Bestimmen
ОглавлениеWenn eine solche Frage nach dem Wissen und der Wissenschaft mithilfe des Problems einer „Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ untersucht werden soll, so wird beansprucht, diese Untersuchung auf der Grundlage einer Reflexion auf die Kunst durchführen zu können. In der Tat hat Nietzsche auch in seinem späteren Kommentar zu seinem eigenen Frühwerk diesen Zusammenhang betont: das Problem der Wissenschaft könne nicht auf dem Boden der Wissenschaft erkannt werden
<–19|
(GT III-1, 7), weshalb es gelte, „die Wissenschaft unter der Optik des Künstlers zu sehen“ (GT III-1, 8) Man sollte sich zumindest vorläufig verdeutlichen, wogegen sich eine solche Perspektive absetzt: es soll Wissenschaft offenbar nicht zum Thema werden unter dem Gesichtspunkt, wie sich Sätze möglichst adäquat auf Zusammenhänge in der Welt beziehen können, was traditionell als ‚Wahrheit‘ bezeichnet wurde (adaequatio intellectus et rei). Aber vielleicht versuchte sich Nietzsche gerade mit der Frage nach der Kunst dem Problem der Wahrheit zu nähern. Die Richtung der Reflexion geht aber auf das Entstehen dieser Auffassung von Wahrheit, die uns als adaequatio geläufig wurde, und auf die Herkunft jener Vorstellungen über den richtigen Umgang mit jenen wahren Erkenntnissen, die mit dem so definierten Begriff verbunden wurden.
Dass dieses Buch ein zunächst nur unter künstlerischen Gesichtspunkten bedeutsames Thema mit der Frage nach der Wissenschaft zusammenführt, stellt auf jeden Fall den Ausdruck des Anspruchs dar, dass in ihm gerade das Künstlerische, das Kreative, das ästhetische Weltenschaffen als die Grundlage des möglichen Wissens von der Welt und vom Menschen erklärt werden könne. Später wird Nietzsche in seiner Reflexion auf dieses Buch von einer „ästhetischen Weltauslegung“ sprechen. Den größten Gegensatz dazu wird er dann in der moralischen Weltauffassung des Christentums sehen (GT III-1, 12). Die ‚artistische‘ Lehre wird damit als ein prinzipiell ‚anti-christliches‘ Denken aufgefasst (GT III-1, 13). Es wird sich auch zeigen, dass Nietzsche bereits in seinem frühen Buch das Christentum als Erbe dessen auffasst, was er bald als ‚Platonismus‘ bezeichnet, also als die zu einer ‚Lehre‘ verfestigte Philosophie Platons.
Die Grundlage der Kunst findet Nietzsche in einer Dualität, die das eigentliche Thema dieses Buches darstellt: von Apollinischem und Dionysischem, und diese Ambivalenz des Künstlerischen scheint ihm für die Kunst eine analoge Bedeutung zu haben wie die Zweiheit der Geschlechter für die Fortpflanzung des Menschen (GT III-1, 21). Diese Unterscheidung muss dann aber nicht nur für die Aufklärung der ‚Geburt der Tragödie‘ wichtig sein, sondern auch für das Thema der Aufklärung der Wissenschaft als einer – und heute meist der – Form des Wissens. Deshalb stellt im Zusammenhang des Denkens von Nietzsche das Verhältnis von Apollinischem und Dionysischem nicht ein Spezialthema unter der Perspektive einer Aufklärung der Kunstform der Tragödie, der Musik allgemein oder sogar der Kunst als solcher dar. In Bezug auf Wissenschaft, Sprache und das menschliche Denken handelt es sich in der Tat um einen der wichtigsten Züge in Nietzsches Philosophie. Dies wird vor allem dann deutlich, wenn es gelingt, die wesentlichen Strukturen dieser Unterscheidung beizubehalten und sich dennoch von der Verengung auf eine allzu metaphorische Bedeutung zu lösen. Wir sollten aber schon an dieser Stelle und vor der Erörterung des Apollinischen und Dionysischen deutlich sehen, dass es hier nicht um zwei isolierte Kunsttendenzen
<–20|
oder Kulturrichtungen geht, sondern um die Bedeutung, welche deren Vereinigung gewinnt – und auch um die Notwendigkeit dieses Zusammenwirkens. Nietzsche wies ausdrücklich darauf hin, dass wir „in jenem Bruderbunde des Apollo und des Dionysos die Spitze ebenso wohl der apollinischen als der dionysischen Kunstabsichten anerkennen“ müssen (GT III-1, 146).
Über das Verhältnis zwischen diesen beiden künstlerischen Prinzipien, die zugleich Prinzipien des Wissens und damit der menschlichen Beziehung zur Welt sind, hat sich Nietzsche nach zwei Richtungen geäußert. An manchen Stellen scheint es so, dass das Dionysische ihm als die Wahrheit der Welt galt, während das Apollinische ein bloßer Schein sein sollte, der diese Wahrheit verdeckt. Etwa sprach er diese Funktion dem apollinischen Bewusstsein zu (GT III-1, 30). An einer anderen Stelle ist die Rede von der „glänzende(n) Traumgeburt des Olympischen“ (d. h. des Apollinischen), welches die Griechen vor „die Schrecken und Entsetzlichkeiten des Daseins“ stellen musste, um leben zu können (GT III-1, 31). Noch an anderer Stelle schreibt Nietzsche von der ‚metaphysischen Annahme‘,
„dass das Wahrhaft-Seiende und Ur-Eine, als das Ewig-Leidende und Widerspruchsvolle, zugleich die entzückende Vision, den lustvollen Schein, zu seiner steten Erlösung braucht: welchen Schein wir, völlig in ihm befangen und aus ihm bestehend, als das Wahrhaft-Nichtseiende d. h. als ein fortwährendes Werden in Zeit, Raum und Kausalität, mit anderen Worten, als empirische Realität zu empfinden genötigt sind.“ (GT III-1, 34 –35)
Hier findet sich aber bereits eine Charakterisierung des Verhältnisses zwischen apollinischem und dionysischem Prinzip, welche in eine andere Richtung weist, und diese Richtung ist auch diejenige, welche in Nietzsches Denken wirklich Bedeutung gewinnen sollte und die Struktur dieser Philosophie fundamental prägt. Zwar soll wohl das Dionysische das „Wahrhaft-Seiende“ darstellen, aber es ist offensichtlich ein sehr mängelbehaftetes Seiendes, wenn es den Schein geradezu „braucht“. So ganz wahr kann das Wahre nicht sein, wenn es noch etwas außer seiner selbst braucht, um zu dem zu kommen, was Nietzsche als dessen „Erlösung“ bezeichnet. Ganz entsprechend nennt Nietzsche die „Erlösung durch den Schein“ auch „das ewig erreichte Ziel des Ur-Einen“ (GT III-1, 35). Dieser Schein ist allerdings kein ‚bloßer Schein‘, von dem wir etwa dann sprechen, wenn ein Gegenstand nicht wirklich vorhanden ist, wir aber doch durch bestimmte Sinneseindrücke glauben, er sei wirklich, wie dies vielleicht der Fall ist, wenn wir in der Dunkelheit einen Schatten als einen Hund wahrnehmen, was sich beim genaueren Hinsehen und bei besserer Beleuchtung als Irrtum herausstellt.
<–21|
Der von Nietzsche gemeinte Schein ist vielmehr gerade das, was wir als ‚wirklich‘ zu bezeichnen gewohnt sind, nämlich die „empirische Realität“ und deren „fortwährendes Werden in Zeit, Raum und Kausalität“, was er als „das Wahrhaft-Nichtseiende“ bezeichnete (GT III-1, 35). Dieser Ausdruck klingt ungewöhnlich – vor allem deshalb, weil nicht das gemeint ist, was beim ersten Lesen verstanden werden könnte: nämlich das, was in Wahrheit nicht ist. Gemeint ist vielmehr das, was auf eine wahrhafte Weise nicht das ist, was im dionysischen Sinne ist, und dieses ‚wahrhaft‘ sollten wir hier mit Bezug auf ‚Wahrnehmung‘ oder ‚Wahrscheinlichkeit‘ auffassen. Die empirische Realität ist also insofern ‚wahrhaft‘, als sie der Schein ist, in dem „das Wahrhaft-Seiende und Ur-Eine“ zu seiner Erlösung kommt (GT III-1, 34). Wenn es einer solchen Erlösung bedürftig ist, dann war es offensichtlich zuvor nicht vollständig das, was es sein muss. Dann aber ‚gibt es‘ das Dionysische nicht ohne das Apollinische und das Wahre nicht ohne sein Scheinen.
An dieser Stelle muss wohl darauf aufmerksam gemacht werden, dass Nietzsches bisweilen irreführende Formulierungen über das Dionysische als das ‚Wahre‘ oder der ‚Urgrund‘ der Welt in der Schrift „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ weitgehend auf den noch anhaltenden Einfluss der Philosophie Schopenhauers zurückgehen, der auf den merkwürdigen Gedanken gekommen war, Kants Rede von einem An-sich als einen Hinweis auf so etwas wie einen ‚Willen an sich‘ zu deuten, den er dann un-kantisch als den eigentlichen Grund der Welt verstand. In der vorliegenden Darstellung wird auf eine nähere Erläuterung von Schopenhauers vorübergehendem Einfluss auf Nietzsches Denken verzichtet. Bereits in der „Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ wird bei genauerem Lesen deutlich, dass sich Nietzsche schon weitgehend von dem Denken jenes Schriftstellers gelöst hatte.
Nietzsches Auffassung ist auf jeden Fall besser zu verstehen, wenn wir sie mit Grundzügen der Kantischen Philosophie vergleichen. Nach Kant können wir eine Erkenntnis nur von der ‚Erscheinung‘ erreichen, unter welcher bei ihm das verstanden wird, was wir als Subjekte mithilfe unserer reinen Verstandesbegriffe aus den Sinnesdaten machen, die allein uns in der Form von Anschauungen gegeben sind. Wir konstruieren die Welt der Erscheinung also, obwohl dies kein willkürliches Tun ist, sondern ein Vorgang, der notwendig ist für ein Wesen, das sich von der Welt der Objekte unterscheidet und darin für sich selbst seine Identität finden kann. Insofern ist diese Erscheinung keineswegs ein Schein, der uns das verstellt oder falsch darstellt, was wirklich ist. Sie ist vielmehr das Wirkliche, nur dass wir das Wirkliche auffassen müssen als etwas, das zusammen mit der bewussten Identität des Subjekts in der Anwendung von Urteilsformen bzw. reinen Verstandesformen auf die Anschauung ‚hergestellt‘ wird – nämlich hergestellt wird als die Welt des Subjekts. Natürlich kann ‚hinter‘ dieser Welt keine andere sein,
<–22|
von der sie die Erscheinung wäre, denn eine solche ‚Hinterwelt‘ wäre eben keine Welt für ein Subjekt. Um von einer solchen ‚Hinterwelt‘ sprechen zu können, müssten wir den Gedanken eines ‚Meta-Subjekts‘ fassen, also eines Subjekts, für das Subjekt und ‚Hinterwelt‘ auffassbar wären. Wir müssten also den Standpunkt Gottes einnehmen, von dem wir jedoch gerade nach der Kantischen Lehre (Kritik der rationalen Theologie) nichts wissen können (obwohl wir daran glauben können).
Nietzsche führte allerdings nicht wie Kant die Entwicklung und Begründung von reinen Verstandesbegriffen aus der Notwendigkeit durch, mithilfe von Urteilsformen aus einem Satz eine genügend bestimmte Behauptung über die Welt machen zu müssen. Von einem Subjekt, das im Verhältnis zur objektiven Welt seine Identität findet, ist ebenfalls nicht die Rede. Dennoch ist der ‚Schein‘ und ‚Traum‘ des Apollinischen ebenso wenig ein ‚bloßer Schein‘, hinter dem irgendwie die Wahrheit stecken könnte, wie dies für Kants Welt der Erscheinung galt. Die empirische Welt ist im einen Fall eine Konstruktion des identischen Subjekts, im anderen Fall ist sie die Weise, in der sich das Formlose, Rauschhafte des Dionysischen darstellen kann. Vielleicht ist es nicht ganz überflüssig zu erwähnen, dass als ‚empirische Welt‘ hier – ebenso wie bei Kant – nicht die Welt der Sinneswahrnehmungen bzw. –daten zu verstehen ist, sondern, wie das Wort sagt, die Welt der Erfahrung, d. h. die Welt, in der wir Objekte erfahren, ihre Zusammenhänge feststellen und darüber (u. a.) wissenschaftliche Erkenntnisse sammeln. Wir kommen also auch hier zurück zu der eingangs erwähnten Fragestellung nach der Form des Wissens, welche zu dem Phänomen gehört, das wir als Wissenschaft kennen. Diese Form des Wissens zeigte sich für Nietzsche nun in diesem frühen Stadium als eine Weise der apollinischen – d. h. umgrenzten und zur Gestalt gebildeten – Darstellung des Dionysischen, also als ein Geschehen des Bildens und des Erzeugens von Bestimmtheit.
Eine solche Darstellung setzt jedoch den Gedanken einer Dualität voraus. In Nietzsches ästhetischer Terminologie wird sie als Dualität zwischen „der Kunst des Bildners“ (Apollo) auf der einen und der „unbildlichen Kunst der Musik“ (Dionysos) ausgedrückt (GT III-1, 21). Diese Dualität erläuterte Nietzsche durch die Unterscheidung zwischen den „getrennten Kunstwelten des Traumes und des Rausches“ (GT III-1, 22). Das ‚Bilden‘ steht also mit dem ‚Traum‘ auf der einen Seite der Musik und dem ‚Rausch‘ auf der anderen Seite gegenüber. Wenn hier von ‚Traum‘ die Rede ist, so sollte man nicht an Albträume oder an visuelle Wunscherfüllungen denken, sondern in erster Linie daran, dass im Traum Gestalten und Bilder erschaffen werden, die so in der Wirklichkeit nicht existieren, auch wenn es Zusammenhänge mit der wirklichen Welt gibt. Ebenso ist wichtig, dass der Traum in einem ambivalenten Sinne als ‚Schein‘ gilt – jedenfalls in Bezug auf die Wirklichkeit, in der der Träumer erwacht,
<–23|
obwohl er ihm während des Schlafes meist sehr real erscheint. Nietzsche nennt hier die „maßvolle Begrenzung“ als Charakteristikum des Traum-Bildens, durch welche der Schein uns nicht als „plumpe Wirklichkeit“ betrügen könne, so dass sich durch dieses ‚Maß‘ der Schein von der Realität unterscheiden kann (GT III-1, 24).
Die Seite des Gottes Apollo in der Kunst ist also diejenige der Begrenzung, des Gestaltens und damit des Schaffens von einzelnen Bildern bzw. Wesen. Nietzsche nannte Apollo deshalb den Gott „des principii individuationis“, „aus dessen Gebärden und Blicken die ganze Lust und Weisheit des ‚Scheines‘ samt seiner Schönheit“ zu uns sprechen (GT III-1, 24). Apollo ist der „Gott der Individuation und der Gerechtigkeitsgrenzen“ (GT III-1, 67). Der letztere Ausdruck besagt, dass damit ein Prinzip in der Welt ist, durch das die Dinge begrenzt sind bzw. so verstanden werden, und diese Grenzen werden als die eigenen der Dinge aufgefasst, die ihnen ‚gerecht‘ sind – m. a. W.: Apollo ist nach dieser Auffassung der Gott der Bestimmtheit der Dinge, so dass sie sind, was sie sind und nichts anderes, d. h. sie sind unterschieden. Das Prinzip der Individuierung (‚Gott der Individuation‘) ist hier nicht auf den Menschen eingeschränkt zu verstehen, sondern in seiner allgemeinsten Bedeutung, d. h. so, dass jede Abgrenzung einzelner Wesen, Begriffe, Gedanken und Ideen damit gemeint sein kann.
Es handelt sich also im Grunde um das Prinzip, dass A nicht B ist und dass sich beide von C unterscheiden, was auch immer als A, B oder C bezeichnet werden mag. Offensichtlich ist dies eines der Grundprinzipien des Sprechens und des Denkens überhaupt. Ohne dieses Prinzip könnten wir eigentlich überhaupt nichts sagen, denn das Gesagte würde stets auch etwas ganz anderes bedeuten können, so dass es dem Hörer nichts sagen würde, weshalb er ihm weder zustimmen noch widersprechen könnte. Wenn wir nichts sagen können, dann können wir aber auch nichts denken, jedenfalls nichts, was auf irgendeine Weise bestimmt wäre, und würden wir nur Unbestimmtes denken, so könnten wir uns eben nicht etwas denken und es auch nicht für uns selbst so festhalten, dass wir andere Gedanken daran anschließen können.
Dieses Prinzip mag uns als selbstverständlich erscheinen, aber wir sollten bedenken, dass die Möglichkeit des Denkens auch darauf beruht, dass wir die Individuierung wieder aufheben bzw. relativieren können, indem wir von A etwa behaupten, es sei unter einem bestimmten Aspekt doch B, weil A und B doch Fälle von C seien. Hauskatzen sind in der Regel keine Tiger, aber immerhin gehören beide der Gattung der Feliden an und unterscheiden sich damit von den Kaniden, die ebenso Wölfe wie Dackel sein können. Hauskatzen sind also Feliden, aber doch nicht ‚ganz‘, denn zum einen gibt es noch andere Feliden wie z. B. Großkatzen, und zum anderen unterscheiden sich Katzen durch eine spezifische Differenz von der Gattung ‚Feliden‘. Hauskatzen sind
<–24|
also unter einem besonderen Aspekt doch ‚so etwas‘ wie Tiger, weil beide Katzen sind, obwohl sie sich doch unterscheiden.
Solche Differenzierungen, durch die einzelne Entitäten als bestimmt aufgefasst werden, sind nach Nietzsche nun nicht einfach in der Welt vorhanden, sondern sie werden auf eine Weise ‚gemacht‘, die als kreativ und damit grundsätzlich als ähnlich demjenigen Schaffen aufgefasst wird, das wir als Kunst bezeichnen. Wenn Nietzsche hier von ‚Bilden‘ durch ‚Begrenzung‘ spricht, so macht er also darauf aufmerksam, dass eine solche ‚Individuierung‘ auf der Grundlage einer kreativen Tätigkeit geschieht und nicht von selbst in der Natur vorhanden ist. In der Welt des griechischen Denkens findet Nietzsche dafür das Prinzip eines Gottes (des Apollo), der sich von einem anderen Gott unterscheidet (dem Dionysos), obwohl beide in der griechischen Götterwelt doch selbst nur Individuen unter anderen waren.
Das individuierende Bilden ist aber nicht nur in der Kunst zu finden, sondern es handelt sich um ein Prinzip, das für alles Bestimmen gilt. Es ist also auch die Grundlage des Selbstbezugs, durch den sich ein Mensch von anderen Menschen unterscheidet. Dieses Ausbilden von Identität wurde in Griechenland in der Regel ethisch verstanden:
„Diese Vergöttlichung der Individuation kennt, wenn sie überhaupt imperativisch und Vorschriften gebend gedacht wird, nur Ein Gesetz, das Individuum, d. h. die Einhaltung der Grenzen des Individuums, das Maß im hellenischen Sinne. Apollo, als ethische Gottheit, fordert von den Seinigen das Maß und, um es einhalten zu können, Selbsterkenntnis. Und so läuft neben der ästhetischen Notwendigkeit der Schönheit die Forderung des ‚Erkenne dich selbst‘ und des ‚Nicht zu viel!‘ her.“ (GT III-1, 36)
Das Maß des Menschlichen ist demnach das Ergebnis eines Prozesses, in dem das Individuelle entsteht, indem Begrenzung und Gestaltbilden geschieht. Auch das ‚Menschliche‘ ist nicht vorhanden, sondern entsteht in prinzipiell künstlerischen Prozessen, also aus der Verbindung des Dionysischen und des Apollinischen, in der Form, Begrenzung und damit Bestimmtheit geschaffen werden.