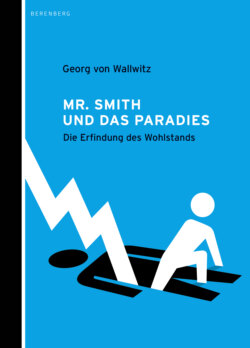Читать книгу Mr. Smith und das Paradies - Georg von Wallwitz - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
THEORIE UND PRAXIS DER VERARMUNG
ОглавлениеVoltaires Einsichten liegen gut 250 Jahre zurück und sind eigentlich ganz einfach zu verstehen. Schafft die Privilegien und die Willkürherrschaft ab und setzt Verstand und Wissenschaft an ihre Stelle, lasst die Kaufleute in Frieden und Sicherheit wirtschaften, stellt die Tüchtigen über die Faulen, und das Land wird in Wohlstand erblühen. Und tatsächlich brachte die Verbindung von Ökonomie und Politik die Industrielle Revolution hervor, welche, nach einer längeren Elendsstrecke, den allgemeinen Wohlstand deutlich verbesserte. So klingt heute konsensfähig, was damals revolutionär war. Aber der Barock steckt uns noch tief in den Knochen, tiefer, als es die Vernunft wahrhaben möchte, und so sehnt sich der Einzelne nach wie vor nach einer Vorzugsbehandlung. Niemand, der in einer gefestigten Stellung ist, hat gerne Konkurrenz und freien Wettbewerb. Sie bedeuten nur vermehrte Anstrengung und verminderten Gewinn, nichts Schönes.
Die großen Krisen in Europa, den USA und Japan seit der Jahrtausendwende, welche noch in dem stolzen Bewusstsein begangen wurde, das Ende der Geschichte sei zum Greifen nah, haben viel mit lähmenden Partikularinteressen zu tun und sind gewissermaßen ein gelebtes Stück Barock. In jedem Land liegt das Problem etwas anders, aber überall hat es denselben Effekt. Privilegien entstehen ganz natürlich, und wenn sie einmal errichtet sind, wenn die Wenigen sich einmal daran gewöhnt haben, auf Kosten der Vielen zu leben, kostet jede Veränderung so viel Kraft wie eine Revolution. Sie werden schnell Teil einer Kultur, graben sich in die Lebensweise und die Erwartungen ein, denn kaum etwas hat so viel Beharrungsvermögen wie der Glaube an das eigene Erwähltsein. Ein Staat, der nicht Opfer einer Vetternwirtschaft werden möchte, muss daher starke und zentralisierte Institutionen haben, um sich gegen die schlechte Gesellschaft zu wehren. Bei aller Stärke muss er aber auch offen, durchlässig und gut kontrolliert sein, um nicht selbst zur Quelle von Privilegien zu werden. In dieser Balance, die stets neu gefunden werden muss, befinden sich nicht viele Gemeinwesen.
Die Aufklärung hat jedenfalls nicht das Ende der Privilegien gebracht, nirgendwo, allenfalls das Ende der gepuderten Perücken. In jedem Land, in jeder Gesellschaft entstehen jene unverdienten Vergünstigungen, die Voltaire angeprangert hatte. Der Mechanismus funktioniert heute, jenseits der Aufklärung, etwa folgendermaßen: Kleine Gruppen von Leuten, die viel zu gewinnen haben und die einander aus der Szene kennen, schließen sich gerne zusammen, wenn es darum geht, ihren Anteil am Kuchen noch zu vergrößern. Sind es nicht zu viele, verteilt sich die Beute auf eine geringere Anzahl von Mitjägern und für jeden Einzelnen lohnt sich der Einsatz. Man stelle sich etwa die sehr überschaubare Zahl der Firmen in der Private-Equity-Industrie vor, die gerne weniger Steuern zahlen würden. Für die großen Spieler kann das eine Ersparnis im hohen zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich bedeuten, und für jeden von ihnen würde sich eine entsprechende Gesetzesänderung bezahlt machen, selbst wenn er die Lobbyarbeit vollständig selbst bezahlen müsste. Für die Gruppe insgesamt lohnt es sich allemal.
Gerne hängen sich dann auch noch die Anwälte dieser Firmen an das Projekt, denn sie wittern die Gelegenheit, ihre Honorare in (ebenfalls von der Steuer zu befreienden) Beteiligungen an den Private-Equity-Investitionen bezahlen zu lassen. So haben ein paar Wenige ein massives Interesse an einer kleinen Änderung des Gesetzes, wonach die Bezahlung der Private-Equity-Manager nicht mehr als Einkommen besteuert wird. Das Thema ist obskur genug, dass es einer breiten Öffentlichkeit verschlossen bleibt, und so finden sich genügend sympathische Abgeordnete, die das Vorhaben bald Gesetz werden lassen. Ans Licht kommt so eine Konstruktion eigentlich nur, wenn ein unvorsichtiges Mitglied der Community sich zu sehr aus dem Fenster lehnt, wie etwa der republikanische Präsidentschaftskandidat des Jahres 2012, Mitt Romney, dessen Steuersatz von 14 % einem allzu großen Teil der arbeitenden Bevölkerung nicht vermittelbar war.
Je größer die Gruppen, desto schwieriger sind sie auf eine Linie zu bringen. Die Hohe Schule ist hier die Gründung von Gewerkschaften. Massen von Menschen zu organisieren ist nicht einfach, weil es keine Golfclubs gibt, in denen sich ganze Belegschaften zu vertrauensbildenden Maßnahmen zurückziehen und diskret auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen können. Und der Gewinn muss auf viele hungrige Mäuler verteilt werden, was für den Einzelnen oft nicht über ein Taschengeld hinaus geht. Jedes einzelne Mitglied riskiert den Verlust des Arbeitsplatzes und damit die Lebensgrundlage der Familie, hat aber auf der anderen Seite allenfalls eine sehr überschaubare Lohnerhöhung zu gewinnen. Viele Arbeiter kamen in der Gründungsphase der Gewerkschaftsbewegung schnell dahinter, dass ihr persönlicher Gewinn in keinem guten Verhältnis zum Risiko stand, und so waren die Streikführer (die sehr viel zu gewinnen hatten) im 19. Jahrhundert ganz wesentlich damit beschäftigt, immer paradiesischere Zustände zu versprechen und, wo es nottat, Streikbrecher mit Knüppeln von der Arbeit abzuhalten. Dem Einzelnen musste sein Interesse auf die eine oder andere Weise verdeutlicht werden.
Ist das Privileg erst einmal unter Dach und Fach, sehen die Insider zu, dass möglichst Wenige etwas davon haben. Es ist immer unerfreulich, einen Gewinn teilen zu müssen, sodass, wo immer Partikularinteressen durchgesetzt werden, auch ein natürlicher Hang zur Exklusivität entsteht. Gewerkschaften erstreiten Lohnabschlüsse und ein Arbeitsrecht, das diejenigen, die einen Job haben, vor denen schützt, die einen Job wollen. Ärzte halten unbedingt an einem Niederlassungsrecht fest, das sie vor Konkurrenz schützt. Bauern erhalten Prämien für das Stilllegen von Flächen, auch wenn sie darüber hinaus noch Subventionen erhalten, um auf genau diesen Flächen bestimmte Pflanzen zur Energiegewinnung anzubauen – und würden ähnliche Konstruktionen in anderen Branchen sicher merkwürdig finden.
Ob Gewerkschaftsboss, Bauernpräsident oder Private-Equity-Manager, sie spielen verschiedene Instrumente, aber nach denselben Noten. Sie setzen ihre Interessen auf Kosten der apathischen Masse durch, behaupten dabei mit großer Selbstverständlichkeit, nur das Gemeinwohl im Auge zu haben, und lähmen so die Gesellschaft. Sie verhindern Konkurrenz und gleichen Zugang zu Märkten und Institutionen, leiten die Geldströme so gut es eben geht in die eigenen Taschen und sorgen für immer kompliziertere Regulierungen mit immer mehr Ausnahmen, Sonderfällen und Vergünstigungen, bis ein Gewebe entstanden ist, in dem sich nur noch die Gewitzten zurecht finden. Aus den Gewitzten von heute werden die Privilegierten von morgen, die dann, wie Voltaire beklagt, indem sie sind, was sie sind, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt lahmlegen.
Je schwächer die Institutionen, desto barocker die Zustände, könnte man bei oberflächlicher Betrachtung der Eurozone meinen. Wo der Zentralstaat schwach ist, haben allerlei Interessengruppen die Möglichkeit, sich mit unverdienten Rechten zu versorgen oder, direkter, sich gleich an den öffentlichen Kassen zu bedienen. Der Staat wird dort nicht als gemeinschaftliches Projekt, als Agent der Interessen seiner Bürger, sondern als Mittel zur Ausbeutung begriffen. Ein Staatsbankrott hat daher in Lateineuropa für die eher staatsfern gesinnte Bürger, die aus langer Erfahrung wissen, wie sie für sich zu sorgen haben, lange nicht den Schrecken wie etwa für die Deutschen, die ohne ihren Staat oft nichts mit sich anzufangen wissen.
Die moderne Privilegienwirtschaft ist jedenfalls auch ein kulturelles Phänomen und keineswegs nur von den Institutionen abhängig. Ländern wie Griechenland ist nicht damit geholfen, die Gesetze und den Staatsaufbau Dänemarks zu übernehmen, dadurch würde dort nichts geändert. Der griechische Staat, der ein beliebtes Beispiel für den europäischen Niedergang ist, hat bei weitem nicht die Gewalt über seine Bürger, wie es die auf einer staatstragenden Tradition gegründeten Bürokratien des Nordens haben. Es herrscht dort Barock ohne Absolutismus. Das gibt bestimmten Gruppen die Möglichkeit, sich Pfründe zu verschaffen, sobald sie an der Macht sind. Wenn also die Sozialisten die Regierung stellen, versorgen sie ihre Parteigänger mit Jobs, etwa bei der Staatsbahn, so wie es zuvor die Bürgerlichen mit ihren Freunden getan haben. So geht es bei staatlichen Unternehmungen oder Bürokratien nicht so sehr um die Erreichung eines äußeren Ziels, sondern vielmehr um die Versorgung der Insider auf Kosten aller anderen.
Im Ergebnis standen 2009 bei der griechischen Staatsbahn einem jährlichen Umsatz von € 174 Millionen Personalkosten in Höhe von € 290 Millionen gegenüber sowie allein € 422 Millionen an Zinszahlungen auf den Schuldenberg von knapp acht Milliarden Euro. Ein durchschnittlicher Bahnangestellter verdiente € 65.000 im Jahr, vom Schrankenwärter bis zum Lokomotivführer. Oder: In Griechenland konnten Männer mit 55 in Rente gehen und Frauen mit 50, wenn sie einen »mühevollen« Beruf hatten. Als »mühevoll« waren etwa 600 Berufe klassifiziert, wie Friseur, Radioansager, Kellner oder Musiker. Oder: Erst seit 2010 wurde ein unabhängiges nationales Statistikamt aufgebaut. Bis dahin kamen die Zahlen zur Verschuldung, zur Wirtschaftsleistung etc. von einer Unterabteilung im Finanzministerium und da wunderte es nicht, wenn sie vor und nach jeder Wahl gründlich frisiert wurden. Oder: Nur ein Drittel aller Ärzte in Griechenland zahlte überhaupt Steuern, der Rest verdiente, glaubte man ihren Steuererklärungen, weniger als das steuerfreie Existenzminimum von € 12.000 im Jahr. Das waren nicht mal 20 % des Lohns eines durchschnittlichen Eisenbahners. Griechenland war zu dieser Zeit das Land mit der höchsten Quote von Selbständigen in Europa, was nicht verwundert, wurden doch Unternehmer praktisch nicht besteuert – so hoch die Steuersätze auf dem Papier auch gewesen sein mögen. Und wenn einer doch mal zum Steuern zahlen herangezogen wurde, konnte er immer noch vor Gericht gehen, wo die Fälle bis zu 15 Jahre lang anhängig blieben. So lange bis irgendjemand, die Richter oder das Finanzamt, keine Lust mehr hatten. Oder: Die damalige französische Finanzministerin Lagarde vertraute 2010 ihrem griechischen Kollegen eine Liste mit den Namen von fast 2.000 griechischen Kunden bei der HSBC in Genf an. Von diesen sollte man ausstehende Steuern eintreiben, so die Hoffnung der Geldgeber Griechenlands aus der EU, und mit den Einnahmen die Finanzen des Landes sanieren. Frau Lagarde war wohl so diskret, die Liste nicht durchzugehen, denn sonst hätte es sie nicht wundern müssen, dass sie sofort verloren ging. Auf der Liste stand natürlich die Klientel der politischen Klasse, und die Sache verlief im Sand. In einem Land, in dem jeder irgendwie privilegiert ist und zu irgendeiner Klientel gehört, hat niemand Interesse an Veränderung und genießt vielmehr das Leben, so lange es gut geht. Der Staat wird von den Insidern als Mittel zur Bereicherung gesehen und von allen anderen als Dieb.
So wie in Griechenland verhält es sich in großen Teilen der Welt, nur weniger pittoresk und stiller. Die Aufklärung hat es nicht leicht, sie kann auch über viele Generationen erfolglos anrennen gegen das Heilige und Althergebrachte und ihr Versprechen von Wohlstand durch Verdienst und Effizienz kann so ungehört verhallen wie die Ankündigung des kommenden Messias durch den Rufer in der Wüste.
Das kulturelle Erstaunen, das Europa in seiner großen Krise erfasst, ist nicht neu, es ist ein Widerhall dessen, was Italien seit seiner Gründung vor 150 Jahren erlebt. Die französisch und österreichisch geprägten Norditaliener kannten mächtige Stadtstaaten mit durchsetzungsstarken Regierungen, waren von einer durchgehenden Rechtstradition geprägt, hatten (spätestens seit der Besetzung durch Napoleon) die Aufklärung mitgemacht und sich industrialisiert und verfielen irgendwie, man weiß nicht mehr warum, auf die Idee, dass die Italiener südlich Roms nicht grundsätzlich anders tickten als sie selbst. So lag die Idee nahe, das französische Staatsverständnis von Piemont aus über das ganze Land zu verbreiten und die Brüder in Kampanien, Sizilien, Kalabrien und Apulien aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Wie naiv das war, wie wenig sich durch das Pathos der Befreiung, der Vernunft, der Effizienz ändert, ist das Thema von Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman Der Leopard. Dort sieht sich der Fürst, Symbol der Geschichte Siziliens, der aber gleichzeitig ein Mann der Wissenschaft und durch oberflächliche Anmutungen hindurchzuschauen gewohnt ist, mit der Machtübernahme des Nordens konfrontiert, der die Reform seines mittelalterlich gebliebenen Landes verspricht. Russo, der Vertreter der neuen Zeit, versichert dem Fürsten, »Glauben Sie mir, Exzellenz, alles wird besser werden. Die Männer, die ehrenhaft und geschickt sind, werden vorankommen. Das Übrige wird sein wie zuvor.« Der Fürst interpretiert das für den Süden: »Diese Leute, diese elenden kleinen Liberalen vom Lande, wollen nichts als die Möglichkeit, leichter zu profitieren. Schluss, Punkt.« Er, und mit ihm auch viele einfache Leute, sehen in der italienischen Einigung unter der Vorherrschaft Piemonts nur den Austausch der herrschenden Klasse, der alten Aristokratie, durch die Händler und Wucherer. Am Ende sieht der Sizilianer die Piemonteser nicht mit anderen Augen als zuvor schon die Griechen, die Römer, die Araber, die Normannen, das Haus Anjou, die Aragonesen, die Habsburger und die Bourbonen, die alle mit irgendwelchen neuen Ideen gekommen und nie geblieben waren. Die Kaufleute des Nordens, die nun eine neue Welt und Wohlstand versprechen, sind nicht besser und die Sizilianer werden ihre Lebensweise für sie nicht ändern. Die alte Ordnung wird bleiben, wie ein Harz alles verklebend, was von außen Einfluss auf den alten Stamm nehmen zu können meint. In dieser Welt kann die Aufklärung nur ganz anders ankommen, als sie einst gedacht war, denn sie findet keine Kultur vor, die ihr ein Mutterboden sein könnte.
Warum fällt es den Menschen so schwer, etwas zu ändern, auch wenn sie genau wissen, dass sie auf ihrem gegenwärtigen Kurs wirtschaftlich scheitern und moralisch nichts gewinnen werden? Anton Tschechow beschreibt in seinem Kirschgarten die Lähmung einer privilegierten Gesellschaft, die sich nicht ändern und nicht verzichten kann. Eine ehemals wohlhabende russische Adelsfamilie wird in dem Stück mit dem Ende ihrer finanziellen Ressourcen konfrontiert. Sie hat sehr lange sehr gut gelebt und sich nie Gedanken darüber gemacht, wo das Geld eigentlich herkommt. Ihr Lebensstandard war nicht etwa unelegant an die verfügbaren Ressourcen angepasst, das wäre ihnen vorgekommen wie ein zu lange getragener Konfirmationsanzug. Vielmehr erwarteten sie vom Schicksal die Bereitstellung alles dessen, was zu einem gelingenden Leben gehörte, wie etwa ein jahrelanger Aufenthalt in Paris und ein unverbauter Ausblick auf den Fluss. Die Stimme der Vernunft in diesem Stück gehört Lopachin, einem ehemaligen Knecht der Familie, der als Unternehmer zu Geld gekommen ist. Er hegt Sympathien für die alte Herrschaft und versucht ihr zweierlei klar zu machen: Dass sie vom Ruin bedroht ist und wie sie den drohenden Untergang abwenden kann. Sein Vorschlag lautet, den schönsten Teil des Geländes, den Kirschgarten, zu parzellieren und dort Sommerhäuschen für Städter zu bauen. Lopachin dringt aber weder mit dem einen noch mit dem anderen durch, denn die Familie klammert sich lieber an luftige Hoffnungen, als sich mit ödem Zahlenwerk und angeblicher wirtschaftlicher Notwendigkeit die Laune verderben zu lassen:
Gajew. Die Tante in Jaroslawl hat uns Geld versprochen – aber wann sie es schickt, und wieviel, kann ich noch nicht sagen.
Lopachin. Wieviel wird sie schicken? Hundert-, zweihunderttausend?
Ljubow Andrejewna. Nun, wenn’s auch nur zehn- oder fünfzehntausend sind, ist uns schon geholfen.
Lopachin. Verzeihen sie, so leichtsinnige Herrschaften wie Sie, so unerfahrene, sonderbare Leute sind mir noch nie vorgekommen. Ich sage Ihnen klipp und klar: Ihr Gut kommt unter den Hammer, und Sie tun, als sei das gar nichts.
Ljubow Andrejewna. Was sollen wir machen? So belehren Sie uns doch!
Lopachin. Tag für Tag gebe ich mir Mühe, Sie zu belehren. Tag für Tag rede und rede ich, immer ein und dasselbe. Sie sollen den Kirschgarten und das ganze Terrain am Flusse parzellieren und Sommerhäuschen darauf bauen, und zwar sofort, jetzt, in diesem Augenblick. Der Versteigerungstermin steht vor der Tür. Begreifen sie doch endlich! Sobald Sie sich erst mal zu der Parzellierung entschlossen haben, steht Ihnen so viel Geld zur Verfügung, wie Sie nur wollen, und Sie sind gerettet.
Ljubow Andrejewna. Sommerhäuschen, Sommergäste – das klingt so gewöhnlich, nehmen Sie mir’s nicht übel.
Gajew. Ich bin ganz deiner Meinung.
Lopachin. Weinen möcht’ ich, schreien, in Ohnmacht fallen, wenn ich das höre. Ich halt’s nicht länger aus, Sie foltern mich zu Tode.
Es kommt, wie es kommen muss, es passiert nichts. Auf der Zwangsversteigerung kauft Lopachin selbst das Gut und tut dann das wirtschaftlich Sinnvolle. Der Kirschgarten wird abgeholzt. Am Ende hört man im Hintergrund die Sägen, welche die wunderschönen Bäumen, die aber leider keinen Ertrag bringen, aus dem Weg schaffen. So ergeht es Gesellschaften, in denen die Privilegien die Phantasie zerstört haben: Sie gehen eher unter, als sich zu reformieren. Das ist der tiefere Grund der schlechten Prognosen für das Europäische Projekt.
Das Spielfeld, das eine offene Gesellschaft und eine funktionierende Ökonomie benötigen, sollte ein perfekter Rasen sein und kommt doch selten über einen holprigen Bolzplatz hinaus. Umso kühner war die Idee des eitlen Voltaire, eine Welt von Verstand und Verdienst, Gleichheit und Gerechtigkeit zu imaginieren, in der das Paradies auf die Erde geholt und dort zur allgemeinen Wirklichkeit gemacht wurde. So etwas gab es nie und so etwas kann es wohl auch gar nicht geben, jedenfalls nicht solange der Mensch den Vorteil sucht und die Mühe scheut. Aber dem Utopisten ist das einerlei, er darf kühn über die träge Beharrungsfähigkeit der Menschen hinausgreifen und sich ausmalen, wie das hiesige Himmelreich aussehen könnte.