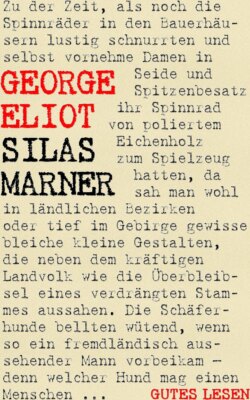Читать книгу Silas Marner - George Eliot, George Eliot, Manor Books - Страница 5
Erster Abschnitt
ОглавлениеZu der Zeit, als noch die Spinnräder in den Bauerhäusern lustig schnurrten und selbst vornehme Damen in Seide und Spitzenbesatz ihr Spinnrad von poliertem Eichenholz zum Spielzeug hatten, da sah man wohl in ländlichen Bezirken oder tief im Gebirge gewisse bleiche kleine Gestalten, die neben dem kräftigen Landvolk wie die Überbleibsel eines verdrängten Stammes aussahen. Die Schäferhunde bellten wütend, wenn so ein fremdländisch aussehender Mann vorbeikam – denn welcher Hund mag einen Menschen leiden, der unter einem schweren Packen gebückt geht? – und ohne diese geheimnisvolle Last gingen jene blassen Leute selten über Land. Den Schäfern selbst war es zwar sehr wahrscheinlich, in dem Packen sei nichts als Garn und Stücke Leinen, aber ob sich diese Weberei, so unentbehrlich sie sein mochte, ganz ohne Hilfe des Bösen betreiben ließe, das war ihnen nicht so sicher. In jener fernen Zeit hing sich der Aberglaube leicht an jeden und jedes, was überhaupt ungewöhnlich war oder auch nur selten und vorübergehend vorkam, wie die Besuche des Hausierers oder Scherenschleifers. Wo diese Herumtreiber zu Hause seien oder von wem sie stammten, wußte kein Mensch, und was konnte man sich bei jemand denken, wenn man nicht wenigstens einen kannte, der seinen Vater oder Mutter kannte?! Für die Bauern von damals war die Welt außerhalb des Bereichs ihrer unmittelbaren Anschauung etwas Unbestimmtes und geheimnisvolles; für ihren an die Scholle gefesselten Sinn war ein Wanderleben eine so unklare Vorstellung wie das Leben der Schwalben im Winter, die mit dem Frühlinge heimkehrten, und selbst wenn sich ein Fremder dauernd bei ihnen niederließ, blieb fast immer ein Rest von Mißtrauen gegen ihn bestehen, so daß es niemand überrascht hätte, wenn der Fremdling nach langer tadelloser Führung schließlich doch mit einem Verbrechen endete – zumal, falls er im Rufe stand, gescheit zu sein, oder besonders geschickt war in seinem Gewerbe. Jede Begabung, sei es im raschen Gebrauch der Zunge oder in einer andern Kunst, mit der das Landvolk nicht recht vertraut war, galt an sich für verdächtig; ehrliche Leute, deren Herkunft und Lebensweise offen zu Tage lag, waren meist nicht zu klug oder geschickt, – wenigstens nicht mehr, als daß sie sich aufs Wetter verstanden; und, wie man zu solcher Zungenfertigkeit oder sonstigen Gewandtheit käme, war so vollständig unbekannt, daß Hexerei dahinter stecken mußte. So kam es denn, daß die verstreut wohnenden Leinweber, die meist aus der Stadt eingewandert waren, für ihre bäuerlichen Nachbarn Fremde blieben bis ans Ende und in Folge davon gewöhnlich auch die Seltsamkeiten annahmen, die einem einsamen Leben eigen sind.
In den ersten Jahren dieses Jahrhunderts trieb ein solcher Leinweber, namens Silas Marner, sein Gewerbe in einem steinernen Häuschen, welches nahe bei dem Dorfe Raveloe, nicht weit von dem Rande eines alten Steinbruchs, zwischen Hecken von Nußbäumen stand. Der bedenkliche Klang von Marners Webstuhl, der so ganz anders war als das natürliche lustige Geklapper der Schwingmaschine oder der einfache Takt des Dreschflegels, hatte einen schaurigen Reiz für die Jungen des Dorfs, die oft ihr Nüssesammeln oder Vogelnestersuchen unterbrachen, um in dem steinernen Häuschen durchs Fenster zu gucken, wobei ihrem Schauder über das einförmige Klappern des Webstuhls das behagliche Gefühl spöttischer Überlegenheit bei dem Anblick der gekrümmten Haltung des Webers die Waage hielt. Aber bisweilen bemerkte dann Marner, wenn er grade innehalten mußte, um an seiner Arbeit etwas in Ordnung zu bringen, die kleinen Schelme, und so lieb ihm seine Zeit war, wurde er über die ungebetenen Gäste so böse, daß er seinen Platz am Webstuhl verließ, an die Tür trat und den Jungen einen Blick zuwarf, der sie schleunigst in die Flucht trieb. Denn wie war es möglich, daß die großen braunen vorstehenden Augen in Silas Marners blassem Gesichte wirklich nur ganz in der Nähe deutlich sehen sollten? Mußte man nicht vielmehr glauben, sie könnten mit ihrem starren Blick jedem Jungen, der ihnen zu nahe käme, Krämpfe, Gliederzucken und Gesichtsschmerzen verursachen?! Vielleicht hatten die Jungen ihre Eltern andeuten hören, Silas Marner könne Gliederschmerz heilen, wenn er nur wolle, – mit dem noch leiseren und dunkleren Zusatze, wer den Teufel nur gut zu nehmen wisse, der könne den Doktor sparen. Solche seltsame Nachklänge des alten Wunderglaubens kann ein aufmerksamer Beobachter vielleicht noch jetzt bei manchen Bauersleuten treffen; denn ein roher Sinn vereinigt nicht leicht die Begriffe von Macht und Güte. Die dunkle Vorstellung einer Macht, die durch vieles Zureden sich dahin bringen läßt, einem kein Leid zu tun, – das ist die Form, welche das Gefühl des Unsichtbaren am leichtesten bei Menschen annimmt, die immer mit den gewöhnlichsten Bedürfnissen zu kämpfen haben und deren mühevolles Dasein nie von begeistertem religiösen Glauben verklärt wird. Für sie hat Kummer und Unglück einen viel größeren Bereich als Freude und Glück; für Bilder der Hoffnung und Sehnsucht ist ihre Einbildungskraft unfruchtbarer Boden, vielmehr ganz überwachsen von Erinnerungen, die ihrer Furcht stete Nahrung bieten. »Könnt Ihr Euch nichts ausdenken, was Ihr gern essen möchtet?« fragte ich mal einen alten Arbeitsmann in seiner letzten Krankheit, der alle Speisen ausschlug, die ihm seine Frau bot. »Nein«, antwortete er, »ich bin immer nur an einfache Kost gewöhnt gewesen und jetzt mag ich die nicht.« Seine Lebensweise hatte keine Vorstellung in ihm geweckt, die ihm hätte Appetit machen können.
Und Raveloe war ein Dorf, wo noch mancher alte Klang nachhallte, den die lebendigen Stimmen der Gegenwart nicht übertönten. Nicht daß es ein ödes Kirchspiel gewesen wäre an den äußersten Grenzen der Zivilisation, nur von magern Schafen und ein paar Schäfern bewohnt; im Gegenteil, es lag in der fruchtbaren Ebene mitten im lustigen England, wie wir’s zu nennen belieben, und hatte Bauerhöfe, die – geistlich zu sprechen – die schönsten Zehnten bezahlten. Aber es lag gemütlich in einem wohlbewaldeten Tale versteckt, eine ganze Stunde zu reiten von jeder Chaussee entfernt, und kein Ton vom Posthorn oder der öffentlichen Meinung drang je dahin. Es war ein stattliches Dorf; mittendrin eine schöne alte Kirche und ein großer Kirchhof; zwei oder drei große massive Häuser aus Backstein mit wohlummauerten Obstgärten und zierlichen Wetterhähnen standen dicht an der Hauptstraße und überstrahlten mit ihren Fassaden die Pfarrwohnung, die auf der andern Seite des Kirchhofs aus den Bäumen hervorguckte, – ein Dorf also, welches auf den ersten Blick die Spitzen seines geselligen Lebens zeigte und einem geübten Auge erzählte, es sei kein Park und Edelhof in der Nähe, sondern es gebe da mehrere gleich vornehme Leute, die nach Belieben schlecht wirtschaften konnten, weil sie von ihrer schlechten Wirtschaft Geld genug zogen, um in den Kriegszeiten lustig zu leben und sich Weihnachten, Pfingsten und Ostern einen vergnügten Tag zu machen.
Es war fünfzehn Jahre her, daß Silas Marner nach Raveloe gekommen – ein blasser junger Mann mit vorstehenden, kurzsichtigen braunen Augen, dessen Äußeres für Leute von mittlerer Bildung und Erfahrung nichts Auffallendes gehabt hätte, aber für die Bauern, unter denen er sich niederließ, geheimnisvolle Eigenheiten hatte, die mit seinem bedenklichen Gewerbe und seiner Herkunft aus dem unbekannten »Norden« – das war so der allgemeine Begriff – nur zu gut stimmten. Auch seine Lebensweise entsprach dem: Er nötigte niemanden über seine Schwelle und ging auch nie ins Dorf, um einen Krug Bier im »Regenbogen« zu trinken oder beim Stellmacher ein Stündchen zu verplaudern; er suchte keine Menschenseele auf, außer in seinem Geschäfte oder wenn er Einkäufe machen mußte, und die Schönen von Raveloe erkannten bald genug, er werde sich keiner von ihnen jemals aufdrängen – beinahe als habe er sie mit eigenen Ohren sagen hören, sie nähmen keinen, der von den Toten erstanden sei. Diese Ansicht über Marner hatte noch einen andern Grund, als sein blasses Gesicht und seine wundersamen Augen; Hans Rodney, der Hamsterjäger, versicherte nämlich, er habe eines Abends beim Nachhausegehen Silas Marner an ein Geländer gelehnt getroffen, seinen schweren Packen auf dem Rücken, statt ihn auf das Geländer zu stützen, wie jeder vernünftige Mensch getan haben würde; als er an ihn herangetreten, seien Marners Augen so starr gewesen, wie die eines Toten; er habe ihn angesprochen und geschüttelt, und seine Glieder seien ganz steif gewesen und seine Hände hätten den Packen so fest gehalten, als wären sie von Eisen; aber grade, als er sich überzeugt gehalten, der Weber sei tot, sei er wieder zu sich gekommen, beinahe wie im Handumdrehen, habe gute Nacht gesagt und sei fortgegangen. Das alles, schwor Hans, habe er gesehen und zwar grade an dem Tage, wo er auf Squire Cass, seinem Lande da unten bei der alten Sägegrube Hamster gefangen habe. Über diese Geschichte waren im Dorfe verschiedene Ansichten; die einen meinten, Marner müsse einen »Zufall« gehabt haben – ein Wort, womit man sonst unerklärliche Dinge hinlänglich zu erklären glaubte, aber der streitsüchtige Küster Macey schüttelte den Kopf und fragte, ob einer je einen Zufall gehabt hätte, ohne hinzufallen. Ein Zufall sei ein Schlag, das sei doch klar, und ein Schlag nehme einem Menschen den teilweisen Gebrauch seiner Glieder, so daß er der Gemeindekasse zur Last falle, wenn er keine Kinder habe, die für ihn sorgten. Nein, nein, bei einem Schlage bleibe kein Mensch auf seinen Beinen stehen und ginge nachher weiter, als wenn nichts passiert wäre. Aber es gebe wohl so’n Ding in der Welt, daß eines Menschen Seele sich von seinem Leibe löse und aus und ein gehe, wie ein Vogel aus seinem Nest, und das sei der Grund, daß manche Leute überklug würden; in diesem Zustande nämlich gingen sie bei – der Himmel wisse bei wem in die Schule, der ihnen mehr beibrächte, als andere Leute mit ihren fünf Sinnen beim Pastor lernen könnten. Wo habe Meister Marner wohl seine Kenntnis von Kräutern her und von Zaubertränken auch, wenn er nur damit herausrücken wollte? Hans Rodney seine Geschichte könne keinen überraschen, der sich erinnere, wie Marner die arme Sally Oates kuriert und in den Schlaf gebracht habe wie ein Kind, nachdem sie unter dem Doktor seinen Händen ganze zwei Monate und darüber so fürchterlich am Herzklopfen gelitten habe als sollte ihr die Brust zerspringen. Marner könne noch andere Leute heilen, wenn er nur wolle; jedenfalls müsse man sich gut mit ihm halten, schon damit er einem nichts Böses tue.
Dieser unbestimmten Furcht verdankte es Marner zum Teil, daß er von der Verfolgung frei blieb, die ihm sein seltsames Wesen sonst zugezogen hätte, aber noch mehr half es ihm, daß der alte Leinweber im benachbarten Dorfe grade gestorben war und daß er nun wegen seiner Geschicklichkeit den wohlhabenden Bauerfrauen in der ganzen Umgegend und selbst den sparsamen Häuslerinnen sehr gelegen kam, die am Jahresschluß immer einen kleinen Vorrat Garn zusammengesponnen hatten. Dies Gefühl von seiner Nützlichkeit genügte, um jede Abneigung und jeden Argwohn zu überwinden, den nicht etwa ein Mangel in der Güte oder Ellenzahl seines Leinens bestätigt hätte. Und so vergingen Jahre, ohne in der Ansicht der Nachbarn über Marner eine Veränderung hervorzubringen, außer daß sie sich an ihn gewöhnt hatten. Nach Verlauf von fünfzehn Jahren sagten die Leute in Raveloe von Silas Marner genau dasselbe, wie zu Anfang; sie sagten’s nicht mehr so oft, aber sie glaubten fester daran, wenn sie’s sagten. Nur einen bedeutenden Zusatz hatten die Jahre gebracht, nämlich daß sich Meister Marner ein hübsch Stück Geld gespart habe und es mit Leuten aufnehmen könne, die dicker täten als er.
Aber während die Ansicht der Welt über ihn sich fast gleich geblieben war und seine Lebensweise äußerlich keine merkliche Änderung zeigte, hatte sein inneres Leben eine Entwicklung und eine Geschichte, wie sie jede heißblütige Natur haben muß, die in die Einsamkeit flieht oder verdammt wird. Sein früheres Leben hatte er in der Anregung, der geistigen Tätigkeit und der engen Verbrüderung einer kleinen religiösen Sekte hingebracht, wo auch der ärmste Laie sich durch die Gabe der Rede auszeichnen kann und wenigstens das Gewicht ausübt, bei der Regierung seines Gemeinwesens eine schweigende Stimme zu haben. In der kleinen stillen Welt, die sich selbst als die Kirche kannte, welche sich in der Laternengasse versammelte, stand Marner in hohem Ansehen; er galt für einen jungen Mann von musterhaftem Lebenswandel und festem Glauben, und ein besonderes Interesse knüpfte sich an ihn, seit er in der Betstunde in eine wunderbare Starrheit und Bewußtlosigkeit gefallen war, so daß man ihn schon für tot hielt, da der Zustand länger als eine Stunde dauerte. Nach einer natürlichen Erklärung dafür zu suchen, wäre sowohl in seinen eigenen Augen wie in denen des Predigers und der andern Brüder eine eigensinnige Verschließung gegen die geistige Bedeutung gewesen, die darin liegen konnte. Silas war offenbar ein Bruder, den sich der Geist zu einem besonderen Werke auserwählt hatte, und obschon sich bei der Bemühung, diesen verborgenen Zweck zu deuten, der Mangel einer inneren Vision, die er bei diesem äußern Zufall hätte haben müssen, schwer fühlbar machte, so glaubten doch sowohl er selbst wie die andern, die Wirkung habe sich in einer vermehrten Helligkeit und Wärme gezeigt. Ein weniger ehrlicher Mensch hätte sich leicht versucht fühlen können, nachträglich eine Vision in der Form wiederkehrender Erinnerung zu schaffen, und ein weniger verständiger Mensch hätte dann selbst daran glauben können, aber Silas war sowohl verständig wie ehrlich, nur hatte bei ihm, wie bei manchen ehrlichen Leuten mit heißem Herzen, die Bildung dem Sinne für das Geheimnisvolle noch nicht seine rechten Wege gewiesen, so daß er nun auch da sich breit machte, wo Forschung und Kenntnis am Platz gewesen wäre. Von seiner Mutter hatte er einige Bekanntschaft mit heilenden Kräutern und ihrer Zubereitung ererbt – ein kleiner Vorrat von Kenntnissen, den sie ihm als ein feierliches Vermächtnis hinterlassen hatte, – aber in den letzten Jahren waren ihm Zweifel aufgestiegen, ob er auch recht tue, diese Kenntnis anzuwenden, da nach seinem Glauben kein Kraut wirksam sein konnte ohne Gebet, und Gebet helfen konnte ohne jedes Kraut, und so erschien ihm die Freude, die es ihm bis dahin gemacht hatte, über Land zu gehen und nach Fingerhut, Löwenzahn und Huflattich zu suchen, allmählich als eine Versuchung.
Unter den Mitgliedern seiner Gemeinde war ein junger Mann, ein wenig älter als er selbst, mit dem er seit langer Zeit in so enger Freundschaft lebte, daß es unter den andern Brüdern sprichwörtlich geworden war, sie David und Jonathan zu nennen. Mit seinem wirklichen Namen hieß der Freund Wilhelm Dane, und auch er galt für ein glänzendes Beispiel jugendlicher Frömmigkeit, obschon etwas übertrieben strenge gegen schwächere Brüder und etwas verblendet von seinem eigenen Lichte, so daß er sich für weiser hielt als seine älteren Brüder und Lehrer. Aber welche Fehler auch andere an Wilhelm sehen mochten, für seinen Freund war er fehlerlos; denn Marner war eine von den bestimmbaren schüchternen Naturen, die in den Jahren der Unerfahrenheit ein befehlendes Wesen bewundern und sich an jemanden anlehnen, der ihnen widerspricht. Gegen den Ausdruck vertrauensvoller Einfalt in Marners Gesicht, den jener Mangel an scharfer Beobachtung, jener sanfte an Rehaugen erinnernde Blick, welcher großen, vorstehenden Augen eigen ist, noch erhöhte, – stach der selbstgefällige Ausdruck halbunterdrückten Stolzes sehr ab, der in den kleinen, verdrehten Augen und den zusammengekniffenen Lippen Wilhelms lauerte. Ein Lieblingsgegenstand der Unterhaltung war für die beiden Freunde die Gewißheit der Gnade; Silas gestand, er könne es nie höher bringen als zu Hoffnung mit Furcht gemischt, und hörte mit sehnsüchtiger Verwunderung zu, wenn Wilhelm erklärte, seine Gewißheit stehe unerschütterlich fest, seit er in der Zeit seiner Bekehrung im Traume die Worte: »berufen und auserwählt« ganz allein auf einem weißen Blatte in der offenen Bibel habe stehen sehen. Solche Unterredungen haben schon manche Weber mit blassen Gesichtern beschäftigt, deren ungebildete Seelen kleinen, halbflüggen Vögeln glichen, welche einsam und verlassen in der Dämmerung flattern.
Dieser Freundschaft mit Wilhelm hatte es, wie der arglose Silas meinte, keinen Eintrag getan, daß er ein noch innigeres Verhältnis einging. Seit einigen Monaten war er mit einem jungen Dienstmädchen verlobt, und sie warteten nur noch auf einen kleinen Zuwachs ihrer beiderseitigen Ersparnisse, um sich zu heiraten, und es war ihm eine große Freude, daß Sarah bei ihren sonntäglichen Zusammenkünften gegen Wilhelms Gesellschaft nichts einzuwenden hatte. Um diese Zeit war es, daß Silas in der Betstunde in Ohnmacht fiel, und unter den verschiedenen Fragen und teilnehmenden Äußerungen der Brüder stand die Erklärung, welche Wilhelm der Sache gab, ganz allein mit der allgemeinen Teilnahme in schneidendem Widerspruch, die sich für einen so besonders begnadeten Bruder kundgab. Er bemerkte, dieser Anfall scheine ihm mehr eine Heimsuchung des Teufels als ein Beweis göttlicher Gnade, und er warnte seinen Freund, er möge sich wohl vorsehen, ob er auch was böses auf dem Herzen habe. Silas hielt sich verpflichtet, Zurechtweisung und Ermahnung von einem Bruder anzunehmen, und war über die Zweifel des Freundes nicht entrüstet, sondern nur betrübt; zugleich bemerkte er bald darauf mit einiger Besorgnis, daß Sarah in ihrem Benehmen gegen ihn in ein seltsames Schwanken geriet, indem sie sich bald bemühte, ihm noch größere Achtung zu bezeigen, und bald unwillkürlich verriet, daß sie eine gewisse Abneigung gegen ihn empfand. Er fragte sie, ob sie das Verhältnis abzubrechen wünsche, aber das verneinte sie; ihre Verlobung war der Gemeine bekannt und in den Betstunden hatte man Fürbitte für sie getan; sie konnte nicht abgebrochen werden, ohne daß strenge Rechenschaft gefordert wäre, und Sarah vermochte keinen Grund anzugeben, den die Gemeinde gutgeheißen hätte. Um diese Zeit wurde einer der Vorsteher gefährlich krank, und da er ein kinderloser Wittwer war, so pflegten ihn einige von den jüngern Brüdern und Schwestern. Silas teilte sich oft mit Wilhelm in die Nachtwachen, so daß sie einander um zwei Uhr ablösten. Der alte Mann schien wieder auf dem Wege zur Genesung, als Silas eines Nachts, wo er am Bette wachte, plötzlich bemerkte, sein gewöhnlich so hörbarer Atem gehe nicht mehr. Das Licht war tief herabgebrannt und er mußte es in die Höhe heben, um das Gesicht des Kranken deutlich zu sehen. Sofort erkannte er, der Alte sei tot und müsse schon seit einiger Zeit tot gelegen haben, da die Glieder ganz starr waren. Silas fragte sich, ob er vielleicht geschlafen habe, und sah nach der Uhr: Es war schon vier Uhr morgens. Wie kam es, daß Wilhelm ihn nicht abgelöst hatte? In großer Sorge ging er fort, um Hilfe zu suchen, und bald waren mehrere Freunde, darunter der Pfarrer, im Hause versammelt, während Silas an die Arbeit ging, nachdem er vergebens auf Wilhelm gewartet hatte, um von ihm den Grund seines Ausbleibens zu hören.
Aber um sechs Uhr, als er schon daran dachte, seinen Freund aufzusuchen, kam Wilhelm und der Prediger mit ihm. Sie forderten ihn nach dem Betsaal, wo die Mitglieder der Gemeinde auf ihn warteten, und auf seine Frage nach der Ursache gaben sie nur die Antwort: »das sollst Du schon hören«. Weiter wurde nichts gesagt, bis Silas in der Sakristei saß, dem Prediger gegenüber, und die Augen derer, die für ihn Gottes Volk waren, mit feierlichem Ernst auf ihn geheftet. Der Prediger holte ein Taschenmesser hervor, zeigte es Silas und fragte ihn, ob er wisse, wo er das Messer gelassen habe. Silas antwortete, er wisse nicht, daß er es wo anders gelassen habe als in seiner eigenen Tasche, aber er zitterte bei diesem seltsamen Verhör. Dann ermahnte man ihn, er solle seine Sünde nicht verbergen, sondern gestehen und bereuen; das Messer sei in dem Schreibtisch neben dem Bett des verstorbenen Vorstehers gefunden, und zwar an der Stelle, wo der kleine Beutel mit der Kirchenkasse gelegen habe, den der Prediger selbst noch den Tag vorher gesehen; jemand habe diesen Beutel entwendet, und wer könne das anders gewesen sein, als der, dem das Messer gehöre? Eine Zeit lang saß Silas stumm vor Staunen; dann sagte er: »Gott wird mich reinigen von diesem Verdacht; ich weiß nichts davon, daß das Messer da war, oder daß das Geld fort ist. Durchsucht mich und meine Wohnung; ihr werdet nichts finden, als drei Pfund von meinen eigenen Ersparnissen, die ich – Wilhelm kann es bezeugen – schon sechs Monate habe.« Bei diesen Worten stöhnte Wilhelm, aber der Prediger sagte: »der Beweis ist stark gegen Euch, Bruder Marner; das Geld ist letzte Nacht weggekommen, und niemand ist bei unserm verstorbenen Bruder gewesen als Ihr, denn Wilhelm Dane ist durch ein plötzliches Unwohlsein verhindert worden, Euch zur gewöhnlichen Stunde abzulösen, und Ihr selbst gebt zu, daß er nicht dagewesen ist.«
»Ich muß eingeschlafen sein«, meinte Silas, und nach einer Pause fügte er hinzu: »oder ich habe wieder eine Heimsuchung gehabt, wie damals hier vor Euer aller Augen; da wird der Dieb gekommen sein, während ich nicht im Leibe, sondern außer dem Leibe war. Aber ich wiederhole, durchsucht mich und meine Wohnung, denn ich bin sonst nirgendwo gewesen.«
Man suchte nach und das Suchen endete damit, daß Wilhelm Dane den wohlbekannten Beutel leer hinter der Kommode in Silas Stube fand! Nun ermahnte Wilhelm seinen Freund, seine Sünde offen zu gestehen. Silas warf ihm einen Blick voll bitteren Vorwurfs zu und sagte: »Wilhelm, neun Jahre sind wir Tag für Tag zusammen gewesen, hast Du mich je eine Lüge sagen hören? Aber Gott wird mich reinigen.«
»Bruder«, antwortete Wilhelm, »wie kann ich wissen, was Du in Deinem Herzenskämmerlein getan haben magst, um dem Satan Gewalt über Dich zu geben?«
Noch immer blickte Silas den Freund an; plötzlich überzog eine tiefe Röte sein Gesicht, und er war schon im Begriff, heftig loszufahren, als ihn ein innerer Kampf zurückzuhalten schien, der die Röte vertrieb und ihn zittern machte. Endlich sagte er mit matter Stimme, indem er Wilhelm ansah:
»Jetzt erinnere ich mich – das Messer war nicht in meiner Tasche.«
Wilhelm erwiderte: »ich weiß nicht, was Du meinst«; aber die andern Anwesenden fingen an sich zu erkundigen, was Silas damit sagen wolle; doch wollte er keine weitere Erklärung geben und sagte nur: »ich bin tief betrübt; sagen kann ich nichts: Gott wird mich reinigen.«
Bei der Rückkehr in den Betsaal wurde weiter beraten. Gerichtliche Maßregeln zur Entdeckung des Verbrechers widersprachen den Grundsätzen der Gemeinde; Verfolgung galt ihnen für unchristlich, selbst wenn es sich nicht zugleich um ein Ärgernis für das Volk Gottes gehandelt hätte. Sie beschlossen zu beten und zu losen – ein Beschluß, der nur die überraschen kann, die mit den religiösen Vorgängen unbekannt sind, welche im Stillen in den Gassen und Winkeln unserer Städte sich ereignen. Silas kniete mit den Brüdern nieder; er war gewiß, seine Unschuld würde durch unmittelbare Einwirkung von oben bestätigt werden, aber Schmerz und Trauer, das fühlte er, warteten doch auf ihn; sein Glaube an die Menschheit war grausam zerstört. Das Los erklärte, Silas Marner sei schuldig. Er wurde feierlich aus der Kirchengemeinde ausgestoßen und aufgefordert, das gestohlene Geld herauszugeben; nur wenn er gestände und dadurch Reue bewiese, könne er als verirrtes Lamm wieder in die Herde aufgenommen werden. Schweigend hörte Marner das an. Endlich, als alle sich erhoben, um fortzugehen, trat er auf Wilhelm Dane zu und sagte mit einer Stimme, die vor Aufregung bebte:
»Das letzte Mal, als ich mein Messer gebrauchte, das war, als ich für Dich den Riemen schnitt. Ich kann mich nicht erinnern, daß ich’s wieder in die Tasche steckte. Du hast das Geld gestohlen und Du hast mich in ein Netz verstrickt, daß die Schuld auf mich fällt. Aber trotzdem mag’s Dir wohl gut gehen; es gibt keinen gerechten Gott, der die Erde rechtschaffen regiert, – nur einen Gott der Lüge, der Zeugnis ablegt wider den Gerechten.«
Ein allgemeiner Schauder ging bei dieser Gotteslästerung durch die Gemeinde.
Wilhelm erwiderte sanft: »die Brüder mögen urteilen, ob das die Stimme des Satans ist, oder nicht. Silas, ich kann nur für Dich beten.«
Der arme Silas ging fort, im Herzen die Verzweiflung, den erschütterten Glauben an Gott und Menschen, der für eine Natur voll Liebe an Wahnsinn grenzt. In der Bitterkeit seines verwundeten Gemüts sagte er sich: »jetzt wird sie mich auch verstoßen«, und er überlegte sich, wenn sie ihn nicht auch für schuldig halte, so müsse ihr ganzer Glaube ebenso zerstört sein, wie der seinige. Wer gewohnt ist, über die Formen nachzudenken, in denen sein religiöses Gefühl sich verkörpert hat, der kann sich kaum in den einfachen natürlichen Seelenzustand versetzen; wo die Form und das Gefühl nie durch einen Akt der Reflexion getrennt sind. Man sollte meinen, ein Mensch in Marners Lage müsse notwendig die Frage aufgeworfen haben, ob denn auch eine Berufung auf die Entscheidung Gottes durchs Los verläßlich sei, aber das wäre für ihn ein Akt geistiger Freiheit gewesen, wovon er nichts wußte, und er hätte diesen Aufschwung in einem Augenblick nehmen müssen, wo seine ganze Kraft sich in den tiefen Jammer eines gestörten Glaubens verloren hatte. Wenn es einen Engel gibt, der die Leiden der Menschen so gut verzeichnet wie ihre Sünden, dann weiß er, wie mannigfach und tief die Leiden sind, die aus falschen Vorstellungen entspringen, für die kein Mensch die Schuld trägt.
Marner ging nach Haus und saß einen ganzen Tag allein, betäubt von Verzweiflung, ohne daß es ihn trieb, zu Sarah zu gehen und sie von seiner Unschuld zu überzeugen. Den zweiten Tag suchte er vor dem erstarrenden Unglauben bei der Arbeit am Webstuhl Zuflucht, und wenige Stunden nachher kam der Prediger mit einem der Vorsteher und kündigte ihm an, Sarah betrachte ihre Verlobung als aufgelöst. Schweigend nahm Silas die Nachricht hin und wandte sich wieder an die Arbeit. Einen Monat darauf heirateten sich Sarah und Wilhelm Dane, und nicht lange nachher erfuhren die Brüder in der Laternengasse, Silas Marner sei nicht mehr in der Stadt.