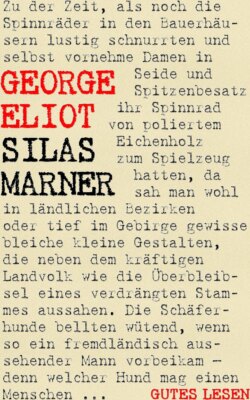Читать книгу Silas Marner - George Eliot, George Eliot, Manor Books - Страница 7
Dritter Abschnitt
ОглавлениеDer größte Mann in Raveloe war Squire Cass, welcher der Kirche schräg gegenüber in dem großen roten Hause mit der hübschen Treppe davor, und dem großen Stalle dahinter wohnte. Es gab außer ihm noch mehrere Grundbesitzer im Dorfe, aber er allein hatte den Ehrentitel Squire; denn obschon Herrn Osgoods Familie auch von sehr alter Herkunft war – die Leute von Raveloe hatten sich mit ihren Gedanken nie in die schreckliche Zeit zurückgewagt, wo es noch keine Osgoods gab – so gehörte ihm doch nur der Hof, den er bewohnte, während Squire Cass ein paar Pächter hielt, die sich über das viele Wild bei ihm beklagten, grad als wäre er ein Lord gewesen.
Damals war noch jene herrliche Kriegszeit, die für eine besondere Gunst der Vorsehung gegen den Grundbesitz galt, und das Sinken der Preise hatte noch nicht die kleinen Gutsbesitzer und Pächter den Weg des Verderbens geführt, wozu ihnen bereits eine üppige Lebensweise und schlechte Wirtschaft hinreichend die Räder schmierte. Raveloe lag fern ab von der Strömung industrieller Tätigkeit und puritanischen Ernstes; die Reichen aßen und tranken nach Herzenslust und nahmen Gicht und Schlaganfälle als etwas hin, was merkwürdigerweise in anständigen Familien läge, und die Armen meinten, die Reichen täten ganz recht, ein lustiges Leben zu führen; nebenbei fiel bei ihrem Schmausen immer mancherlei ab, worauf die Armen angewiesen waren, und besonders galten die großen Festlichkeiten im Laufe des Jahres als etwas recht Gutes. Die Festlichkeiten in Raveloe nämlich waren wie die Rinderbraten und die Bierfässer – sie wurden auf einem großen Fuß gehalten und dauerten eine gute Weile, namentlich zur Winterszeit. Wenn Damen einmal ihre besten Kleider und Kopfputze eingepackt und es riskiert hatten mit der kostbaren Last in Regen oder Schnee über Ströme zu setzen, wo man gar nicht wissen konnte, wie hoch das Wasser gestiegen war oder noch steigen würde, da ließ sich natürlich nicht erwarten; daß sie sich mit einer kurzen Freude abfänden. Deshalb hatte man es so eingerichtet, daß in den kurzen Tagen, wo es wenig zu tun gab und einem die Stunden lang wurden, verschiedene Nachbarn nach einander offenes Haus hielten. Waren dann die Gerichte bei Squire Cass nicht mehr ganz so frisch und reichlich, so brauchten seine Gäste nur etwas im Dorfe hinauf zu gehen zu Mr. Osgood »im Obstgarten« und sie fanden wieder ganze Schinken und Rippenstücke und frische Schweinepasteten, die eben vom Feuer kamen, – kurz alles, was ein wählerischer Appetit verlangen konnte, vielleicht feiner zubereitet, wenn auch nicht reichlicher als beim Squire. Die Frau des Squires war nämlich lange tot und das rote Haus entbehrte die Hausfrau und Mutter, diese Quelle rechter Liebe und Furcht in Wohnstube und Küche, und daraus erklärte sich nicht nur, daß es bei den Festlichkeiten mehr üppig als fein herging, sondern auch daß der stolze Squire sich so oft herabließ, in dem Gastzimmer der Schenke zum Regenbogen den Vorsitz zu führen, statt in seinem eigenen dunkel getäfelten Eßzimmer am Tisch zu sitzen, und vielleicht auch entschuldigte es die Tatsache, daß seine Söhne nicht besonders anschlugen. Die Leute in Raveloe waren nicht grade strenge in ihren moralischen Anforderungen, aber es galt doch für eine Schwäche des Squire, daß er alle seine Söhne zu Hause müßig gehen ließ, und obschon man jungen Herren, deren Väter es haben konnten, gern manches nachsah, schüttelten die Leute doch den Kopf über den zweiten Sohn Dunstan, oder, wie er gewöhnlich hieß, Dunsey, dessen Vorliebe für gewisse Tauschgeschäfte und Wetten leicht zu einem schlimmeren Ende führen könnte, als daß er sich bloß die Hörner ablief. Übrigens, sagten die Nachbarn, komme nicht viel drauf an, was aus Dunsey würde, diesem hämischen, boshaften Burschen, dem sein Trank umso besser schmecke, wenn andere Leute mit trockenem Munde dabei säßen, – wenn er nur nicht grade Schande brächte über eine Familie wie die seinige, die ein Grabmal in der Kirche habe und Silberzeug älter als König Georg. Aber jammerschade wäre es, wenn der älteste Sohn und Hoferbe Gottfried, ein hübscher, gutmütiger junger Mann mit einem offenen Gesicht, auch auf die Sprünge seines Bruders käme, wie es in der letzten Zeit leider den Anschein gewonnen habe. Wenn er so fortführe, so solle er sich nur auf Fräulein Nancy Lammeter keine Hoffnung machen; denn man wisse ja, daß sie seit Pfingsten vorm Jahr sehr zurückhaltend gegen ihn sei, wo es so viel Gerede gemacht habe, daß er viele Tage gar nicht nach Haus gekommen. Es müsse was mit ihm los sein – das sei ganz klar; er sähe nicht halb so frisch und heiter aus wie sonst. Früher habe jeder gesagt, welch ein hübsches Paar er und Nancy abgeben würden, und wenn sie mal das Regiment führte im roten Hause, das wäre eine Änderung zum bessern, denn die Lammeters ließen kein Körnchen Salz verkommen und doch sei bei ihnen alles reichlich und vom Besten. Solch eine Schwiegertochter wäre eine rechte Ersparnis für den alten Squire, wenn sie ihm auch keinen Pfennig ins Haus brächte, denn leider sei anzunehmen, daß er trotz seines großen Einkommens mehr Löcher in der Tasche habe, als das, wo er die Hand hineinstecke. Aber, wenn Musjö Gottfried sich nicht ganz umtue, dann möge er sich nur jeden Gedanken an Fräulein Nancy vergehen lassen.
Dieser einst so hoffnungsvolle Gottfried war’s, der in jenem fünfzehnten Jahr von Marners Aufenthalt in Raveloe eines Nachmittags spät im November in dem dunkel getäfelten Wohnzimmer stand, die Hände in den Seitentaschen seines Rocks und mit dem Rücken gegen das Feuer. Das matte Licht des Tages fiel trübe auf die mit Gewehren, Reitpeitschen und Fuchsschwänzen geschmückten Wände, auf Röcke und Hüte, die auf den Stühlen herumlagen, auf große Humpen, aus denen ein Geruch von abgestandenem Bier aufstieg, und auf ein halb verglommenes Feuer, neben dem in den Ecken des Kamins eine Menge Tabakspfeifen standen – alles Zeichen eines häuslichen Lebens, welches jedes veredelnden Reizes entbehrte. Der Ausdruck düsteren Ärgers in Gottfrieds Gesicht paßte nur zu gut dazu. Er schien jemanden zu erwarten und zu horchen, ob er käme, und gleich drauf ließ sich auch draußen in dem großen leeren Flur ein schwerer Tritt und ein Pfeifen hören.
Die Tür öffnete sich, und ein untersetzter, derber, junger Mann trat herein mit dem geröteten Gesicht und der keck gehobenen Haltung, welche den Anfang der Betrunkenheit bezeichnen. Es war Dunsey, und bei seinem Anblick verlor sich der düstere Ausdruck zum Teil von Gottfrieds Gesicht, um dem belebteren Ausdruck des Hasses Platz zu machen. Der hübsche braune Wachtelhund, der vor dem Kamin lag, zog sich unter einen Stuhl in der Ecke zurück.
»Nun, Musjö Gottfried, was willst Du von mir?« sagte Dunsey spöttisch, »Du bist der älteste, und so mußte ich wohl kommen, als Du nach mir schicktest.«
»Was ich will, ist dies – aber schüttle Dich erst, daß Du nüchtern wirst und es begreifst, hörst Du?« – sagte Gottfried wild; er hatte selbst mehr getrunken, als ihm gut war, um seine trüben Gedanken los zu werden und etwas in Ärger zu kommen.
»Ich will Dir sagen, ich muß unserm Alten das Pachtgeld von Fowler ausbezahlen oder ihm sagen, daß ich es Dir gegeben habe; denn er droht mit Pfändung und es kommt doch bald ’raus, ich mag’s ihm sagen oder nicht. Noch so eben, als er wegging, hat er gesagt, er wollte zum Advokaten schicken und Fowler pfänden lassen, wenn er nicht diese Woche käme und seinen rückständigen Pachtzins bezahlte. Dem Alten ist das Geld etwas knapp und er ist in verdammt schlechter Laune, und Du weißt was er Dir angedroht hat, wenn er Dich je wieder darauf ertappte, daß Du was von seinem Gelde verbracht hast. Also sieh Dich vor und schaff das Geld, und hübsch schnell, verstehst Du?«
»Oho!« sagte Dunsey höhnisch, indem er an seinen Bruder herantrat und ihm ins Gesicht sah. »Wie wär’s, mein Junge, Du selbst schafftest das Geld und spartest mir die Mühe, he? Da Du so gütig warst, es mir zu übergeben, so wirst Du mir auch die Gefälligkeit nicht abschlagen, es für mich zurückzuzahlen; hast’s ja aus reiner brüderlicher Liebe getan, weißt Du!«
Gottfried biß sich auf die Lippen und ballte die Faust. »Komm mir nicht mit dem Blick zu nah, oder ich schlage Dich zu Boden.«
»Ih, das wirst Du hübsch bleiben lassen«, sagte Dunsey, trat aber doch einen Schritt zurück. »Du weißt doch, was ich für ein gutmütiger Bruder bin. Ich könnte Dich ja von Haus und Hof bringen; könnte dem Alten erzählen, daß sein hübscher Junge das nette junge Ding, die Molly Farren geheiratet hat und sehr unglücklich ist, weil er’s bei dem versoffenen Weibe nicht aushalten kann, und dann träte ich an Deine Stelle, so leicht und behaglich, wie was sein kann. Aber siehst Du, das tu’ ich nicht, dazu bin ich viel zu gutmütig. Du tust mir dafür auch jeden Gefallen, und jetzt schaffst Du die hundert Pfund, – ich weiß, Du tust’s!«
»Wie kann ich das Geld schaffen?« antwortete Gottfried bebend; »ich hab’ keinen Schilling in der Tasche. Und daß Du an meinen Platz kömmst, das ist eine Lüge; Du würdest auch weggejagt, darauf verlaß Dich. Denn wenn Du anfängst zu erzählen, dann fang ich auch an. Bob ist Vaters Liebling, das weißt Du recht gut. Der Alte wäre froh, wenn er Dich los wäre.«
»Einerlei«, sagte Dunsey, neigte den Kopf zur Seite und sah zum Fenster heraus. »Es wär’ zu nett, wenn ich in Deiner Gesellschaft abzöge – Du bist so’n netter Bruder, und wir haben uns immer so gern mit einander gezankt; ich wüßte nicht, was ich ohne Dich anfangen sollte. Aber Dir ist’s gewiß lieber, wenn wir beide zusammen im Hause bleiben; darin kenn’ ich Dich schon. Das bißchen Geld wirst Du schon schaffen, und so adieu, Herr Bruder, es tut mir leid Dich zu verlassen.«
Damit wollte Dunsey fortgehen, aber Gottfried stürzte hinter ihm her, packte ihn am Arm und rief fluchend:
»Ich sage Dir, ich hab’ kein Geld und kann keins schaffen.«
»Borg beim alten Kimble.«
»Ich sag’ Dir, er leiht mir nichts mehr, und ich mag ihn nicht bitten.«
»Na, denn verkauf Feuerbrand.«
»Ei, das ist leicht gesagt; ich muß das Geld sofort haben.«
»Ih, Du brauchst’n ja morgen bloß auf die Jagd mitzunehmen, da sind Leute genug, die ihn kaufen; Bryce und Keating kommen gewiß hin.«
»Das wär ’ne schöne Geschichte, da käm ich abends um acht nach Haus und wär’ schmutzig bis über die Ohren; ich will Frau Osgoods Geburtstag mit feiern und tanzen.«
»Oho«, sagte Dunsey, indem er den Kopf auf die Seite legte und einen möglichst zierlichen Ton annahm. »Die reizende Nancy kommt da auch hin, und dann werden wir mit ihr tanzen, ihr versprechen, immer hübsch artig zu sein, und wieder zu Gnaden angenommen werden und …«
»Halt Dein Maul mit Fräulein Nancy, Du Narr«, sagte Gottfried purpurrot im Gesicht, »oder ich erwürge Dich.«
»Was willst Du nur?« sagte Dunsey, noch immer mit gekünsteltem Tone, aber indem er eine Peitsche vom Tisch nahm und mit der Hand am Griff spielte. »Du hast ganz gute Aussichten. Schmeichle Dich nur hübsch wieder bei ihr ein; es spart Zeit, wenn Molly vielleicht eines schönen Tages einen etwas zu starken Schlaftrunk nimmt und Dich zum trauernden Wittwer macht. Nancy würde auch Deine zweite Frau, wenn sie von der ersten nichts wüßte. Und so’n gutmütiger Bruder wie ich, – ich würde Dein Geheimnis gut bewahren, Du tätst mir ja alles zu Gefallen.«
»Hör mal, ich will Dir was sagen«, sagte Gottfried bebend und bleich. »Meine Geduld ist ziemlich zu Ende. Hätt’st Du ein bißchen mehr Verstand, so würdest Du wissen, daß man einen Menschen auch zu weit treiben kann, und dann springt er ebensogut nach der einen Seite wie nach der andern. Ich könnte ebensogut hingehen und dem Alten selbst alles gestehen – Dich wär ich dann wenigstens los. Und zudem, ’mal erfährt er’s doch. Sie hat gedroht, sie wolle selbst herkommen und es ihm sagen. Schmeichle Dir also nicht, Dein Schweigen sei jeden Preis wert, den Du dafür forderst. Du ziehst mich so aus, daß mir am Ende nichts mehr bleibt, um sie zu beruhigen, und dann führt sie ihre Drohung aus. Das ist eins wie’s andere. Ich will Vater selbst alles sagen, und dann magst Du zum Teufel gehen.«
Dunsey sah ein, er habe übers Ziel geschossen und es gebe wirklich einen Punkt, wo selbst der schwankende Gottfried zu einer Entscheidung getrieben werden könnte; aber er sagte gleichgültig:
»Ganz wie Du willst, aber erst muß ich einen Schluck Bier haben.« Dabei zog er die Klingel, warf sich auf zwei Stühle und schlug mit dem Griff seiner Peitsche aufs Fensterbrett.
Gottfried blieb mit dem Rücken gegen das Feuer stehen, fuhr unruhig mit den Fingern in den Taschen herum und sah zu Boden. In seinem derben muskulösen Körper stack physischer Mut genug; aber der half ihm zu keiner Entscheidung, wenn er Gefahren trotzen sollte, die sich weder zu Boden schlagen noch erwürgen ließen. Seine natürliche Unentschlossenheit und moralische Feigheit wurden noch durch seine Lage vermehrt, in der die bedenklichsten Folgen ihn von allen Seiten gleichmäßig zu bedrängen schienen, und nicht so bald war er in seinem Ärger so weit gegangen, Dunstan zu trotzen und sich alle möglichen Entdeckungen seines Geheimnisses auszumalen, als ihm auch schon das Elend, welches dadurch über ihn kommen müßte, viel unerträglicher schien als seine gegenwärtige Lage. Nach einem Geständnis handelte es sich nicht mehr um Möglichkeiten, sondern um eine schreckliche Gewißheit; eine Entdeckung war aber doch nur eine Möglichkeit. Von dem klaren Anblick jener Gewißheit kam er mit einem Gefühl von Beruhigung auf die Ungewißheit und das Schwankende seiner jetzigen Lage zurück. Der enterbte Sohn eines kleinen Gutsbesitzers, der eben so wenig graben mochte wie betteln, war fast hilflos wie ein entwurzelter Baum, der mit Hilfe von Erde und Himmel an der Stelle, wo er zuerst aufschoß, zu einem hübschen Stamme herangewachsen ist. Vielleicht hätte er sich an den Gedanken, zu graben oder sonst zu arbeiten, mit einer gewissen Heiterkeit gewöhnen können, wenn Nancy Lammeter dadurch zu gewinnen wäre, aber da er auf sie ebenso unwiderruflich hätte verzichten müssen wie auf die Erbschaft, und jedes Band auf Erden brechen, außer dem einen, welches ihn herabzog und von jeder Besserung zurückhielt, so konnte er sich hinter einem etwaigen Geständnis keine andere Zukunft denken, als die, Soldat zu werden – und das war in den Augen wohlhabender Familien ein höchst verzweifelter Schritt, der nahe an Selbstmord grenzte. Nein, lieber dem Zufall vertrauen, als seinem eigenen Entschluß – lieber sitzen bleiben und weiter schmausen und den Wein trinken, den er liebte, wenn auch das Schwert über ihm hing und die Angst ihm am Herzen nagte – lieber als fortzustürzen in das kalte Dunkel, wo keine Freude seiner wartete. Dunstans Vorschlag wegen des Pferdes schien ihm schon leichter als die Ausführung seiner eigenen Drohung. Aber sein Stolz erlaubte ihm nicht, das Gespräch anders wieder aufzunehmen als mit neuem Streit. Dunstan wartete darauf und trank sein Bier in kleineren Zügen als gewöhnlich.
»Es sieht Dir recht ähnlich«, fuhr Gottfried bitter heraus, »mir so ruhig davon zu sprechen, daß ich Feuerbrand verkaufen soll – das letzte, was ich auf der Welt mein eigen nenne, und das beste Stück Pferdefleisch, was ich je im Leben gehabt habe. Und wenn Du einen Funken Stolz in Dir hättest, so würdest Du Dich schämen, daß die Ställe so leer sind und daß uns alle Welt darüber verhöhnt. Aber ich glaube, Du könntest Dich selbst verkaufen, bloß um die Freude zu haben, daß ein andrer ein schlechtes Geschäft macht.«
»Ja, ja«, sagte Dunstan sehr versöhnlich, »ich sehe, Du läßt mir Gerechtigkeit widerfahren. Du weißt, beim Geschäft zieh’ ich den Leuten das Fell über die Ohren. Und darum rat’ ich Dir, laß mich Feuerbrand verkaufen. Ich reite ihn morgen auf die Jagd – für Dich tu’ ich das mit wahrem Vergnügen. Ich nehme mich zwar im Sattel nicht so gut aus als Du, aber die Leute bieten aufs Pferd und nicht auf den Reiter.«
»Jawohl, das wär ’ne schöne Geschichte – ich Dir mein Pferd anvertrauen!«
»Ganz wie Du willst«, sagte Dunstan und schlug wieder mit höchster Gemütsruhe auf die Fensterbank, »das Geld von Fowler hast Du zu bezahlen, mich geht’s nichts an. Du hast das Geld von ihm bekommen und Du hast dem Alten gesagt, es wär’ noch nicht bezahlt. Ich habe nichts damit zu tun; Du warst so gefällig, es mir zu geben, das ist alles. Willst Du das Geld nicht bezahlen, dann laß es bleiben; mir ist’s all einerlei. Ich hätte Dir gern geholfen und das Pferd für Dich verkauft, da es Dir ja nicht paßt, morgen einen so weiten Weg zu machen.«
Gottfried schwieg einige Augenblicke; am liebsten wär’ er auf Dunstan losgesprungen, hätte ihm die Peitsche aus der Hand gerissen und ihn halb tot geprügelt, und keine leibliche Furcht hätte ihn davon zurückgehalten, aber eine andere Furcht schreckte ihn, und die war stärker als sein Mut. Als er antwortete, geschah es in einem halbfreundlichen Tone.
»Nun, Du hast doch nicht wieder Unsinn vor mit dem Pferde, he? Du verkaufst das Tier in aller Ordnung und bringst mir das Geld? Sonst, weißt Du, kommt die Geschichte zum Klappen; denn ich kann mir nicht mehr helfen. Und ’s wird Dir nicht so viel Spaß mehr machen, mir das Haus über’m Kopfe einzureißen, seit Du weißt, daß es Dir mit auf den Schädel fällt.«
»Schön«, sagte Dunstan sich erhebend, »das ist abgemacht. Ich wußte wohl, Du nähmst doch noch Vernunft an. Bryce soll schon anbeißen. Ich schaff Dir hundertundzwanzig für den Feuerbrand, das sollst Du sehen.«
»Aber wenn’s nun morgen vom Himmel heruntergießt wie gestern, dann kannst Du ja nicht fort«, sagte Gottfried und er wußte kaum, ob er ein solches Hindernis wünschen solle oder nicht.
»’s wird schon nicht«, sagte Dunstan; »ich bin immer glücklich mit dem Wetter; es könnte vielleicht regnen, wenn Du selbst ausreiten wolltest. Du hast nie die Trümpfe, weißt Du – ich immer. Du hältst es mit der Liebe, und ich habe das Glück, darum mußt Du mich als Heckpfennig bei Dir behalten; ohne mich wirst Du nie fertig.«
»Hol’ Dich der Henker, halt’ Dein Maul«, rief Gottfried heftig. »Und, hörst Du, daß Du morgen nüchtern bleibst; sonst stürzest Du beim Nachhausereiten mit dem Pferde und das möchte Feuerbrand schlecht bekommen.«
»Darüber mag sich Dein zärtliches Herz beruhigen«, sagte Dunstan und öffnete die Tür. »Ich sehe nie doppelt wenn’s ’n Geschäft gilt; es verdirbt einem die Freude. Überdies, wenn ich auch falle, ich falle immer auf die Füße.«
Damit schlug Dunstan die Tür hinter sich zu und überließ Gottfried den bitteren Gedanken über seine persönliche Lage, die ihn schon seit vielen Tagen unablässig bedrängten und nur von der Aufregung der Jagd, des Trinkens und Spielens, oder dem selteneren und tiefer haftenden Vergnügen unterbrochen wurden, Fräulein Nancy Lammeter zu sehen. Die feinen und vielfachen Schmerzen, welche aus der größeren Empfindlichkeit gebildeter Naturen hervorgehen, verdienen vielleicht weniger Mitleid, als der jammervolle Mangel an geistigem Genuß und Trost, welcher rohere Gemüter der steten beängstigenden Gemeinschaft ihrer eigenen Leiden und Plagen überläßt. Das Leben jener Landleute in früherer Zeit, die wir uns leicht als sehr prosaische Figuren denken – als Leute, deren einzige Beschäftigung war, ihre Felder abzureiten, bis sie dabei immer schwerer im Sattel hingen, und die den übrigen Teil ihrer Zeit in einer halb teilnahmslosen Befriedigung ihrer durch ein einförmiges Dasein abgestumpften Sinne hinbrachten – dieses Leben hatte doch ein gewisses Pathos. Unglück hatten sie auch, und die Irrtümer ihrer Jugend führten zu schlimmen Folgen. Vielleicht hatte die Liebe zu einem süßen Geschöpf, einem Bilde von Reinheit, Ordnung und Ruhe, ihren Blicken die Vision eines Lebens erschlossen, in welchem die Tage auch ohne Zechen und Schmausen nicht zu lang zu sein versprachen, aber sie hatten das Mädchen nicht bekommen, die Vision verschwand, und was blieb ihnen dann, zumal wenn sie zu schwer geworden waren zur Jagd, was anders, als zu trinken und sich zu erheitern oder zu trinken und sich zu ärgern, so daß sie nach keiner Abwechslung mehr fragten und mit eifrigem Nachdruck die Dinge wiederholten, die sie in den letzten zwölf Monaten schon bei jeder Gelegenheit gesagt hatten? Gewiß gab es unter diesen dicken und beschränkten Leuten einige, die – Dank ihrer angeborenen Herzensgüte – selbst in der Ausschweifung nicht brutal wurden, einige, die, als ihre Wangen noch jugendfrisch waren, den scharfen Stachel des Schmerzes oder der Reue empfunden, oder unbedachtsam ihre Glieder in Fesseln gelegt hatten; von denen nachher kein Zerren sie lösen konnte, und in diesen traurigen Verhältnissen, die uns allen gemein sind, fanden ihre Gedanken keinen Ruheplatz außerhalb des ausgetretenen Kreises ihrer eigenen kleinlichen Geschichte.
Das wenigstens war die Lage von Gottfried Cass in seinem sechsundzwanzigsten Jahre. Ein Anflug von Reue, zusammen mit der Gefügigkeit einer bestimmbaren Natur gegen alle persönlichen Einflüsse hatte ihn zu einer heimlichen Ehe getrieben, die ihm das Leben verbitterte. Es war eine häßliche Geschichte von gemeiner Leidenschaft, Täuschung und Enttäuschung, die wir nicht aus der Verborgenheit seiner bitteren Erinnerungen ans Licht ziehen wollen. Nicht lange nachher hatte er entdeckt, die Täuschung habe zum Teil daher gerührt, daß Dunstan, welcher in der Mißheirat seines Bruders das Mittel sah, zugleich seinen eifersüchtigen Haß und seine Habgier zu befriedigen, ihm eine Falle gelegt hatte. Indes, hätte Gottfried sich lediglich als ein Opfer ansehen können, so wäre das eiserne Gebiß, welches das Geschick ihm in den Mund gelegt, ihm nicht so unerträglich gewesen. Wenn die Flüche, die er halblaut murmelte, so oft er allein war, nur gegen Dunstans teuflische Hinterlist gegangen wären, so hätte er sich vielleicht vor den Folgen eines Geständnisses weniger gefürchtet. Aber er mußte noch etwas anderem fluchen – seiner eigenen sündhaften Torheit, die ihm jetzt so toll und unverantwortlich schien, wie fast alle unsere Torheiten und Laster, wenn sie hinter uns liegen. Vier Jahre hatte er auf Nancy Lammeter gehofft und mit stiller geduldiger Verehrung um sie geworben; der Gedanke an sie erheiterte und verschönte ihm die Zukunft; er hoffte, sie solle seine Frau werden und es ihm daheim so reizend machen, wie seines Vaters Haus nie gewesen, und in ihrer steten Nähe würde es ihm leicht werden, die Narrheiten abzuschütteln, die keine Freuden waren, sondern nur eine fieberhafte Art, die leere Zeit auszufüllen. Gottfried war ein überwiegend häuslicher Mensch; in einem Hause aufgewachsen, wo der Herd kein Lächeln bot und das tägliche Leben nicht durch Ordnung geweiht war, verfiel er bei seinem leichten Temperament widerstandslos der Art dieses väterlichen Hauses, aber das Bedürfnis einer dauernden zärtlichen Neigung, das Verlangen nach einer fremden Einwirkung, die ihm das Streben nach dem Guten erleichtere, ließ ihm die Nettigkeit, Reinheit und behagliche Ordnung des Lammeterschen Hauses, welches sich in Nancys Lächeln sonnte, so schön erscheinen, wie die frischen herrlichen Morgenstunden, wo die Versuchungen schlafen gehen und das Ohr ganz der Stimme des guten Engels überlassen, die zum Fleiß, zur Besonnenheit und zum Frieden einladet. Und doch hatte selbst die Hoffnung auf dies Paradies ihn nicht von einem Schritte abzuhalten vermocht, der ihn für immer davon ausschloß. Statt sich fest an das starke seidene Tau zu halten, woran ihn Nancy gewiß auf das grüne sichere Ufer gezogen hätte, hatte er sich hinabreißen lassen in Schlamm und Schmutz, aus dem er nicht wieder empor kommen konnte. Er hatte sich in ein Verhältnis gegeben, welches ihm jeden guten Trieb entzog und ihn immer mehr erbitterte.
Indes eine Lage gab es, die war noch schlimmer als die gegenwärtige; das war die, wenn das häßliche Geheimnis an den Tag käme, und über jede andere Empfindung siegte fortwährend das Verlangen, den Unglückstag hinauszuschieben, wo ihn die schwere Entrüstung seines Vaters treffen würde für die Wunde, die er dem Stolze der Familie versetzt, – wo er vielleicht der Hoffnung auf die reiche Erbschaft an Vermögen und Ehren den Rücken wenden müßte, um die es sich doch noch der Mühe verlohnte zu leben, und mit sich nehmen müßte die Gewißheit, aus Nancys Augen und aus Nancys Achtung für immer verbannt zu sein. Je länger die Frist, desto mehr Aussicht hatte er, wenigstens von einer der schrecklichsten Folgen bewahrt zu bleiben, denen er sich selbst preisgegeben hatte, desto häufiger durfte er auf die Freude hoffen, Nancy zu sehen und ihr wieder einige Zeichen ihrer Achtung abzugewinnen. Nach dieser Freude trieb es ihn ab und zu, wenn er sie wochenlang vermieden hatte als den fernen, fernen glänzenden Preis, nach dem er jetzt nur noch die Hände ausstreckte, um desto schmerzhafter die Kette zu fühlen, die ihn zurückhielt. Ein solcher Anfall von Sehnsucht hatte ihn heute gepackt, und das wäre allein hinreichend gewesen, lieber sein Pferd dem Bruder anzuvertrauen, als auf die Freuden des kommenden Tages zu verzichten; aber er hatte noch einen andern Grund zur Abneigung, die Jagd am andern Tage mitzumachen. Sie sollte nämlich nahe bei Batherley stattfinden, dem Marktflecken, wo das unglückliche Weib lebte, dessen Bild ihm täglich verhaßter wurde, und der bloße Gedanke an sie verleidete ihm die ganze Gegend. Wenn ein Mensch sich durch eigenes Unrecht ins Joch bringt, so erzeugt das Haß auch in der liebevollsten Natur, und der gutmütige, herzliche Gottfried Cass wurde immer verbitterter, und grausame Wünsche suchten ihn heim, die zu kommen, zu gehen und wiederzukommen schienen, gleich Dämonen, die in seinem Innern eine bereite Stätte gefunden.
Wie sollte er heute Abend seine Zeit verbringen? Am besten ging er wohl ins Wirtshaus und hörte vom Hahnenkampf sprechen; alle Leute waren da versammelt und was sollte er sonst vornehmen, obschon er sich aus dem Hahnenkampf nicht viel machte. Der braune Wachtelhund, der sich vor ihn hingesetzt und ihn einige Zeit beobachtet hatte, sprang jetzt ungeduldig an ihm auf, um die lang erwartete Liebkosung zu erhalten, aber Gottfried wehrte ihn von sich ab, ohne ihn anzusehen, und verließ das Zimmer – das Hündchen ruhig hinter ihm her; es trug ihm nichts nach.