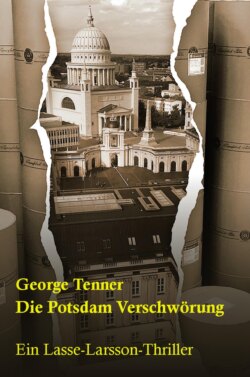Читать книгу Die Potsdam-Verschwörung - George Tenner - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Kapitel
ОглавлениеIn einem der Sechsgeschosser am Hubertusdamm hatten sie mithilfe des Leiters der Druckerei, Martin Vogelsang, eine Zweieinhalbzimmerwohnung gefunden. Alem Manuel Diogonis und Nuguse Berhane und auch die Freundin Berhanes, Temshe Mehari, richteten sich dort ein. An den Wänden erinnerten afrikanische Masken und Fotos, die Nuguse Berhane, dessen Leidenschaft es war zu fotografieren, in kleinem Rahmen an die Heimat. Für das Wohnzimmer, das sie gemeinsam nutzen, hatte Nuguse Berhane eines seiner Farbbilder, das die Trockensavanne mit trockenem Grasland und einigen Trockenwäldern, mit Schirmakazien und Affenbrotbäumen darstellte, zu einem großen Plakat drucken lassen.
Kaum waren sie unter sich, sprachen sie Makhuwa, eine der vielen Bantusprachen, die im Norden Mosambiks vorherrschte. Mit Vogelsang unterhielten sie sich in der Amtssprache ihres Landes, portugiesisch. Nur während der Arbeit sprachen sie mit ihren Kollegen gebrochen deutsch. Obwohl sie hin und wieder sehnsüchtig an ihre Heimat dachten, lebten sie sich gut ein. Selbst die Vergütung ihrer Arbeit als angelernte Helfer war, verglichen sie es mit den Möglichkeiten in der Heimat, geradezu fürstlich.
Während Nuguse Berhane und dessen Freundin Temshe Mehari ausschließlich hergekommen waren, um Geld für ihre Familien zu erarbeiten, um die deutsche Sprache und einen Beruf zu erlernen, verfolgte Alem Manuel Diogonis einen anderen Plan. Zwar schickte er seiner Mutter jeden Monat hundert Euro. Er hatte nie vergessen, dass sein Vater eines der Opfer war, die in der DDR von Neonazis ermordet wurden. Das war für ihn der Grund, in Deutschland arbeiten zu wollen. Er hatte vor, sich an dem Mann zu rächen, der der Anführer der vier Männer war, die den Mord an seinem Vater begangen hatten. Mord war Mord, doch nicht jedem Vertragsarbeiter, der im Land der Diktatur des Proletariats umgebracht wurde, hatte man die Füße zusammengebunden und ihn solange hinter dem Zug hergezogen, bis die Einzelteile über 10 Kilometer verteilt waren. Der Kopf Antonio Manuel Diogonis‘ wurde erst Tage nach dem Torso, bei dem Beine fehlten, gefunden.
Opfer gab es auf beiden Seiten. In Mosambik waren es sieben landwirtschaftliche Entwicklungshelfer aus der DDR gewesen, die im Bürgerkrieg ihr Leben lassen mussten. Offiziell schob die Regierung unter Präsident Machel Samora und der Frente de Libertação de – FRELIMO, welche die Staatsmacht verkörperten, die Tat der Resistência Nacional Moçambicana – RENAMO zu. Die Opfer wurden in der DDR obduziert. Die Munition, die für die Tat benutzt wurde, konnte eindeutig der AK 47 Kalaschnikow zugeordnet werden. Dieses Gewehr wurde nahezu ausschließlich von der Frelimo verwendet, doch gab es Beutewaffen, die bei Anschlägen auf die Frelimo allzu gern benutzt wurden. Bis heute ist strittig, welche der Parteien die Entwicklungshelfer aus der DDR ermordete. Das war das Ende der Entwicklungshilfe durch Personal aus Ost-Berlin in Unango. Die verantwortlichen Politiker in der DDR beendeten unmittelbar nach Bekanntwerden des Anschlages die Zusammenarbeit im Norden Mosambiks. Der Bürgerkrieg kostete durch Kämpfe und Hungerkatastrophen bis zu 900.000 Menschenleben. Über fünf Millionen Zivilisten wurden vertrieben und zahlreiche Menschen durch Landminen verstümmelt, die auch heute noch Opfer unter der Zivilbevölkerung fordern. Das war in den 80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Jetzt, dreißig Jahre später, sah die Sache ganz anders aus. Die alt gewordenen Vertragsarbeiter, die nach dem Zusammenbruch der DDR in ihre Heimat Mosambik zurückkehrten, trauerten der Zeit nach, in der sie in der DDR tätig sein durften. Madgermanes werden in Mosambik die rund 15.000 Mosambikaner genannt, die als Vertragsarbeiter aufgrund eines Staatsvertrages zwischen der DDR und Mosambik seit 1979 in der DDR arbeiteten. Sie wurden nach der Wende in der DDR 1989 durch die Bundesrepublik nach Mosambik ausgewiesen. Nur sehr wenige konnten in Deutschland bleiben.
Alem Manuel Diogonis hatte über das Internet alles recherchiert, was über die Todesfälle an Vertragsarbeitern aus Mosambik in der DDR aufzutreiben war. So gelangte er schließlich an ein Bild, das eine Gruppe von jungen Nazis in der DDR zeigte. Nun war es bewiesen: In der DDR gab es Neonazis und sie lynchten Gastarbeiter. Es glich an ein Wunder, doch Diogonis glaubte, auf dem in der Mitte des Bildes stehenden Mann Ulrich Werfel zu erkennen, der, den anderen gleich, seinen Arm zum Hitlergruß ausgestreckt hatte. Fortan suchte er dessen Freundschaft, was nicht schwer war. So unglaublich das Diogonis erschien, Werfel stieg auf diese Versuche ein. Er zeigte ihm sogar, wie der Gabelstapler zu bedienen war, wenn er selbst nicht da sein würde. Freilich gehörte eine staatlich verordnete Prüfung dazu, eine solche Maschine bedienen zu dürfen. Werfel fand offene Ohren beim Leiter Druck vor, Diogonis für eine solche Prüfung vorzubereiten. Um die Lebensumstände kennenzulernen, nahm Diogonis eine Einladung zum Essen in Werfels Wohnung an.
*
Die Wohnung Werfels lag in der Peter-Altmann-Straße in einem älteren Einfamilienhaus, nahe der Bushaltestelle Hermann-Struve-Straße. Neugierige Blicke folgten Diogonis, als er aus dem Bus stieg. Er ging die kurze Strecke zur Adresse zurück, die ihm Ulrich Werfel genannt hatte. Den kleinen Blumenstrauß in der Hand, betätigte Alem Manuel Diogonis die Klingel. Die Frau, die die Tür öffnete, wird Mitte sechzig sein, dachte Diogonis. Er lächelte sie an.
Die Frau lächelte zurück.
»Sie sind der Arbeitskollege von meinem Mann. Herzlich willkommen. Uli, der Besuch ist da«, rief sie in die Wohnung.
Ulrich Werfel kam aus dem Wohnzimmer.
»Schön, dass du da bist, Alem«, sagte er. »Komm bitte herein.« Er gab Diogonis die Hand.
»Darf ich Ihnen die Blumen abnehmen?«, fragte die Frau.
»Gerne.«
Die beiden Männer gingen voraus, und Werfels Frau nahm den Umweg über die Küche.
»Du weißt schon, dass Potsdam bis 1989 zur DDR gehörte«, begann Ulrich Werfel die Unterhaltung.
»Ja.«
»Wir hatten damals auch Vertragsarbeiter, die bei uns eine Ausbildung genossen und über Jahre eine feste Verdienstmöglichkeit hatten. Es waren alles Männer und Frauen aus den sozialistischen Ländern, aus Vietnam zum Beispiel, aus Kuba und eben auch aus Mosambik.«
Werfels Frau kam herein. »Mit dem Essen dauert es noch ein Weilchen«, sagte sie. »Möchten Sie vielleicht etwas trinken?«
»Ein Wasser, wenn es Ihnen nichts ausmacht«, sagte Diogonis.
Die Frau ging in die Küche zurück.
»Seit 1979 bis 1989 waren mehrere Tausend Mosambikaner als Vertragsarbeiter aufgrund eines Staatsvertrages zwischen der DDR und Mosambik in der DDR«, sagte Werfel. »Wir haben gut mit ihnen zusammengearbeitet.« Er stand auf und holte aus dem Wohnzimmerschrank ein dickes Fotoalbum. »Es gibt hier eine Menge Fotos, die beweisen, wie herzlich unsere Beziehungen waren.«
Werfels Frau brachte das Wasser für den Gast.
»Zeigst du Herrn Diogonis die alten Bilder?«
»Es ist ein Teil unseres Lebens«, sagte Werfel. »Zum Anfang der 1980er Jahre war die Volksrepublik Mosambik der stärkste Empfänger des entwicklungspolitischen Engagements der DDR. Hör mal, was in dem Artikel im Neuen Deutschland steht.« Werfel las laut: »Die als wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit bezeichneten Unterstützungsmaßnahmen auf der Basis des gegenseitigen Nutzens beinhalteten unter anderem die Entsendung von Experten und qualifizierten Fachkräften.«
Die Idee war ursprünglich, in der DDR Arbeitskräfte auszubilden, die in den in Mosambik neu zu errichteten Betrieben, zum Beispiel in dem geplanten Textilkombinat von Mocuba, arbeiten sollten. Mit dem Versinken des Landes im Bürgerkrieg und aus falschen Einschätzungen über die Realisierbarkeit heraus wurden diese Großprojekte gegenstandslos. Dadurch war klar, dass es – wie sich nach 1989 auch bestätigte - für die Mosambikaner kaum Perspektiven nach Rückkehr ins eigene Land gab. Andererseits jene Mosambikaner, die während der Anfangsjahre wirklich sehr gründliche Berufsausbildungen erfuhren, zum Ende der DDR hin immer mehr als reine Hilfsarbeiter eingesetzt und erhielten nur noch eine rudimentäre Ausbildung.
Werfel machte auf ein Bild aufmerksam, dass einige Männer vor einem Multicar zeigte, drei Farbige mit Maschinenpistolen und einen Weißen in grünem Hemd und Jeans. »Die Beziehungen zwischen unseren Leuten und den Männern in deiner Heimat, Alem, waren zu der Zeit überaus gut. Und dennoch ließen sie die Deutschen im Stich, als es zu einer Schießerei kam.«
Er blätterte die Seite um. Neue Bilder zeigten in einer Gruppe stehend die Fachkräfte aus der DDR, die bis auf einen Mann alle zu Tode kamen.
»Sie sind dem Bürgerkrieg zum Opfer gefallen«, sagte Werfel lapidar. Seine Frau kam herein.
»Wir können jetzt essen«, sagte sie und bereitete den Tisch vor.
Werfel klappte das Fotoalbum zu.
»Wir werden später noch weiter die Bilder anschauen«, sagte Diogonis. »Mich interessiert das sehr.«
Ulrich Werfel gefiel das.
»Nach dem Essen gerne, aber wir wollen auch von dir hören, wie es bei euch zugeht.«
Werfels Frau brachte den Rinderbraten nach Wildbret-Art mit Cranberry-Chutney herein. Die weiße Platte, auf dem die aufgeschnittenen fingerdicken Scheiben lagen, machte etwas her. Am Ende des Fleisches stand ein Schälchen mit dem scharfen Chutney, das sie aus getrockneten Cranberrys und einer roten Pfefferschote selbst hergestellt hatte, und das dem Essen eine bestimmte Note gab. Dazu reichte sie braune Champignons und Salzkartoffeln.
»Guten Appetit«, sagte Frau Werfel.
»Mahlzeit«, sagte auch Ulrich Werfel und legte sich vor.
»Gefällt es Ihnen in der Druckerei«, fragte Elke Werfel zwischen zwei Bissen.
»Es ist ein sehr interessanter Arbeitsplatz. Leider haben wir in meiner Heimat solch beeindruckende Maschinen nicht zur Verfügung. Aber eines Tages werden auch wir moderne Maschinen haben, und dann bin ich gut vorbereitet.«
»Ulrich sagt, Sie wären sehr lernbegierig.«
»So, sagt er das. Ich bin sicher, er flunkert nur«. Alem Manuel Diogonis lächelte die Frau an.
»Er flunkert nie«, sagte sie. »Ulrich ist ein Mann ohne Humor.«
»Na, na, na«, drohte Werfel.
Dem Gast schien das Chutney zu schmecken. Er aß reichlich davon zum Fleisch. Elke Werfel gefiel das.
»Stimmt doch, Ulrich. Gib’s wenigstens zu.«
»Wenn ich dann meine Ruhe habe«, sagte er.
»Aber er hat auch seine guten Seiten.«
Als sie fertig waren, holte Elke Werfel eine Schüssel mit Erdbeeren und kleine Teller aus der Küche.
»Ich kann anbieten Erdbeeren mit Sahne, Erdbeeren mit Vanilleeis oder Erdbeeren pur.«
»Was würden Sie gern als Nachtisch haben?« Sie schaute Diogonis an.
»Vielleicht mit ein wenig Eis.«
»Ulrich?«
»Etwas Sahne …«
Sie stellte die Teller von der Hauptspeise auf das Tablett und ging damit zur Küche. Als sie zurückkam, brachte sie zwei kleinere Schüsseln, eine mit dem Eis und eine mit Sahne.
»Jetzt fehlt nur noch ein Espresso«, sagte Ulrich Werfel, als sie mit dem Nachtisch fertig waren.
Die Frau stand auf, stellte die kleinen Teller zusammen und verschwand in der Küche.
»Wo war ich vorhin stehengeblieben?«, fragte Werfel.
»Dass Leute dem Bürgerkrieg zum Opfer gefallen sind …«
»Ach ja. Es waren einundzwanzig gut ausgerüstete Kämpfer, die zusätzlich zur Gruppe der Entwickler der Landwirtschaft dabei waren. Das war wahrscheinlich der Fehler.«
Als die Frau Werfels mit dem Espresso aus der Küche kam, saßen die beiden Männer auf dem Sofa und hatten das Fotoalbum wieder vor sich.
Werfel blickte kurz hoch. »Danke, Elke.«
Werfels Frau ging in die Küche zurück.
»Sie kann das Elend nicht mehr hören. Mich hat das damals sehr mitgenommen. Bei uns hieß es in der Aktuellen Kamera und im Neuen Deutschland, dass bei einem brutalen Überfall von konterrevolutionären Banden sieben Bürger der DDR heimtückisch ermordet wurden.«
»Mein Großvater hat mir davon erzählt«, sagte Diogonis. »Aber ganz genau wusste er es bestimmt auch nicht. Er meinte, bei uns wären es nur sieben Ostdeutsche gewesen, während seine Kollegen, die in der DDR Arbeit gefunden hatten, von mehrfachen Angriffen auf Wohnorte von Mosambikanern gehört haben. Bestes Beispiel sei der Angriff von dreißig Rassisten auf ein Wohnheim für Mosambikaner in Trebbin bei Potsdam.«
Alem Manuel Diogonis schaute auf eine Fliege, die sich an der Espressotasse Werfels zu schaffen machte. Sie lief direkt bis zu dem Zucker, der sich auf dem Boden der Tasse angesammelt hatte. Zu gern hätte er sie jetzt totgeschlagen. Er empfand es geradezu als einen Hinweis, dass die Fliege Werfels Tasse heimsuchte.
»Davon hat man hier nichts gehört. Da hat wohl die Staatssicherheit dafür gesorgt, dass das unter der Decke gehalten wurde. Genau, wie wir nichts über die Aufklärung der Morde in Unango erfuhren.«
»Man kann sich das gar nicht vorstellen, Ulrich. Selbst bei uns in der Savanne hat sich der Überfall auf die Kolonne vor Unango rumgesprochen. Obwohl damals der heftige Bürgerkrieg zwischen Frelimo und Renamo tobte. Da waren Gräueltaten von ganz anderem Ausmaß an der Reihe. Und dennoch konnte mir mein Großvater davon erzählen.«
Eine Weile schwiegen die beiden Männer.
Ulrich Werfel dachte daran, dass er alles, was er über die Ermordung der Aufbauhelfer aus der Republik in Mosambik wusste, erst peu à peu und auch erst nach dem Untergang der DDR in den letzten Jahren über das Internet gefunden hatte. Eine genaue Aufklärung der Ereignisse in Unango hatte nie stattgefunden. Das Ministerium für Staatssicherheit stellte in seinem Bericht lediglich das kapitulantenhafte Verhalten fast aller Sicherungskräfte fest. Im Obduktionsbericht des Gerichtsmedizinischen Instituts der Charité in Berlin wurde vermerkt, dass die tödlichen Projektile aus Waffen vom Typ Kalaschnikow aus sowjetischer Bauart verschossen worden wurden. Und das waren die Waffen der marxistischen Frelimo, also jener Männer, die die landwirtschaftlichen Aufbauhelfer der DDR eigentlich schützen sollten. Wer aber glaubt, dass Renamo nicht in der Lage gewesen wäre, für einen solchen Einsatz Kalaschnikows aus Erbeutungszügen zu benutzen, irrt.
Alem Manuel Diogonis dachte an seinen Großvater, der sein Wissen aus den Reden aus der DDR zurückgekehrter Arbeiter erfahren hatte. Und dann dachte er an seinen Vater, der nicht nur einer derjenigen Menschen war, die in der DDR ihr Leben gelassen haben; er war derjenige, der am grausamsten umgebracht wurde.
»Wollen wir aufhören, Bilder anzuschauen?«, fragte Werfel.
»Nein, warum?«
»Wir werden das Rätsel nicht lösen, das andere, sogar einige Historiker, versucht haben zu ergründen. Es gibt die wahnwitzigsten Schlussfolgerungen, die so abstrus sind, dass man sie nicht allein als unwissend, sondern als Fälschung bezeichnen muss.«
»Was waren das für Leute in der DDR, die Mosambikaner jagten?«, fragte Diogonis.
»Auch davon hast du hier bei uns nichts erfahren. Aber nachdem, was ich recherchiert habe, waren das verwirrte Menschen, Nazis halt, die mit fremden Kulturen nichts haben anfangen können.«
Ulrich Werfel zeigte noch einige Bilder, die ihn mit farbigen Männern zeigte. Alles schien in Ordnung zu sein, bis Ulrich Werfel ein Foto mit einer Gruppe junger Männer zeigte.
»Das ist ein Bild einer Jugendgruppe«, sagte Werfel. »Kennen Sie den?«. Er zeigte auf einen der jungen Männer.
Diogonis tat, als wisse er das nicht. Aber da es das gleiche Bild war, das er aus dem Netz gezogen und Werfel bereits erkannt hatte, war es keine allzu große Überraschung. Der einzige Unterschied zwischen beiden Bildern war, dass das im Netz gefundene die Männer mit dem Hitlergruß abgebildet hatte.
»Wir waren eine Gruppe, die sich ab und zu am Wochenende getroffen hat, um einige Stunden gemeinsam zu verbringen. Das Bild ist an der Ostsee entstanden.«
»Aber lange her, wenn Sie das auf dem Bild sind«, sagte Diogonis.
»Das ist es wohl, und dennoch haben wir uns nicht aus den Augen verloren. Bis auf zwei. Der…«, er zeigte auf einen der Männer, der rechts neben ihm auf dem Bild stand. »Der ist verstorben, Krebs. Und der Dicke hier, Marcel, ist nach der deutschen Vereinigung ausgewandert. Australien. In der ersten Zeit hat er sich noch zwei, dreimal per Brief gemeldet. Doch letztlich ist der Kontakt abgebrochen.«
»So ist das Leben«, sagte Diogonis. »Die Menschen kommen und gehen.«
»Aber einige bleiben«, sagte Ulrich Werfel. »Wenn du willst, kannst du sie kennenlernen. Wir haben unser vierteljähriges Treffen in der nächsten Woche.«
»Ja, das würde mich interessieren. Ich schätze es, wenn Menschen treu sind«, sagte Diogonis.