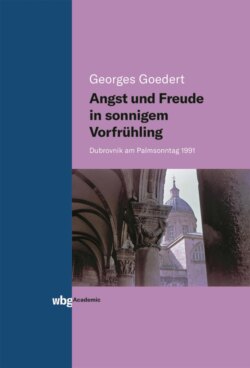Читать книгу Angst und Freude in sonnigem Vorfrühling - Georges Goedert - Страница 10
IV. Die Last der Geschichte
ОглавлениеEs war am 24. März 1991. Das Datum spricht Bände. Dunkle Wolken zogen damals auf am politischen Horizont Kroatiens – der Republik Kroatien, die einen wesentlichen Teil des damaligen Jugoslawiens bildete. Man befand sich im Vorfeld kriegerischer Auseinandersetzungen, ohne dass dieser Zustand aber für den Besucher deutlich zutage getreten wäre. Gerne würde ich den französischen Ausdruck „veillée d’armes“ gebrauchen, wenn er mir nicht für die damalige Situation unpassend erscheinen würde. Er erinnert an ein hohes mittelalterliches Ideal – an die Nachtwache, die früher im Gebet verbracht wurde von den Anwärtern, die am folgenden Tag zu Rittern geschlagen wurden.
Jugoslawien hatte einen Siedepunkt erreicht, ähnlich einem Dampfkessel, der Gefahr läuft, jederzeit auseinanderzubersten. Kundgebungen, gewaltige, bedrohliche, hatten gerade die Stadt Belgrad erschüttert. Die Lage war konfus – man verstand sie kaum, obschon bereits seit Tagen die internationale Presse regelmäßig darüber berichtete. Sie machte den Eindruck eines unentwirrbaren Imbroglios, eines schrecklichen gordischen Knotens, ohne dass man am Horizont einen vom Beistand der Göttin Fortuna begünstigten Alexander hätte kommen sehen, der fähig gewesen wäre, ihn zu durchschlagen. Das Erbe Titos ging offensichtlich verloren – seine Auflösung begann. Hatte nun die Stunde geschlagen, da man sich auf bewaffnete Konflikte einstellen musste? Diese wichtige Frage beschäftigte viele Menschen, auch die Beobachter im Ausland.
Heute nun, da die offenen Feindseligkeiten längst ein Ende gefunden haben, allerdings ohne dass die Spuren davon verschwunden wären, ist es möglich, diese Märztage 1991 zu analysieren und besser zu verstehen. Sie waren in der Tat das Präludium zu den kriegerischen Handlungen, die bald das Land blutig heimsuchen sollten, die Teilrepubliken, die Provinzen, eine nach der anderen. Die Kundgebungen in Belgrad, der sowohl serbischen als auch föderalen Hauptstadt, brachten tiefe innere Uneinigkeiten an den Tag, die nicht allein auf die Republik Serbien begrenzt waren, sondern mittels eines Schneeballeffektes sich über die ganze jugoslawische Föderation erstreckten. Auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet lebten Rivalitäten wieder auf, beseelt von Hass und Groll nationalistischen Charakters, die sich in der geschichtlichen Entwicklung über Jahrhunderte angestaut hatten.
Bürgerkriege? Bruderkämpfe? Ich zögere. Diese Begriffe sind nämlich nicht absolut passend. Zwar muss man eingestehen, dass es sich um Feindschaften handelte, die als einander entgegengesetzte Kräfte innerhalb ein und desselben Staates in Erscheinung traten, doch entstammen diese Bezeichnungen zu sehr einer bloß politisch-allgemeinen Sichtweise. Sie benennen Streitigkeiten innerhalb eines Staates, nicht zwischen Staaten. Sie sind abstrakt und sagen nichts aus über die einzelnen Völkerschaften, ihre Geschichte und ihre Zielsetzungen. Außerdem müssen wir fragen, ob man tatsächlich berechtigt ist, von einem jugoslawischen Volk zu sprechen, einem einzigen, wohlverstanden? Gab es damals unter den Einwohnern dieses Landes wenigstens die Andeutung eines Gefühls von nationaler jugoslawischer Identität und Selbständigkeit? Da antworten wir natürlich mit einem klaren Nein. Einige gemeinsame politische Institutionen genügen nicht, um die Bevölkerung eines Staates zu einem Volk werden zu lassen, viel weniger noch zu einer Nation. Die Einführung einer kommunistischen Republik 1945 mit der mächtigen Figur des Marschalls Tito an ihrer Spitze, begleitet von der Abschaffung der Monarchie der Karadjordjević, hat ebenfalls keine bemerkenswerte und tiefere Veränderung hervorgebracht was diese Spaltungen mit ihren vielfältigen Aspekten betraf, die das Resultat waren von so häufigem Zerfall und Auseinandergehen. Sie sind ein beständiges politisches Risiko geblieben, eine Art Zeitbombe, ein Damoklesschwert für dieses Stück europäischer Erde, das schon so manches Martyrium erlitten hatte, für den Balkan, für Europa, ja sogar für die ganze Welt.
Die Konstruktion dieses Staates war nie genügend gefestigt, auch nicht unter der autoritären Herrschaft von Titos Sozialismus. Selbst wenn es um die politische Strukturierung ging, war es mit der Einigkeit schlecht bestellt. Diese gab es kaum, obgleich unter Tito eine Reihe von Änderungen der Verfassung vorgenommen wurden. Es waren eigentlich Anpassungen mit dem Ziel, den Forderungen der verschiedenen Völker Rechnung zu tragen. Man darf zweifellos behaupten, dass das immer stärker werdende Streben nach Föderalismus bereits eine Art Zerfall war, der sich langsam, aber unaufhaltsam fortsetzte und letztlich, in den neunziger Jahren, sich des jugoslawischen Bundesstaates in seiner Gesamtheit bemächtigte. So ist es gekommen, dass wir heute nur noch von einem Ex-Jugoslawien sprechen. Die Zerstörungen der diversen Kriege haben diese seit Beginn labile politische Konstruktion dann dem Untergang preisgegeben. Sie war einfach nicht imstande, der Zusammensetzung der Völker, die sie umfasste, ihren Lebensweisen und ihren ehrgeizigen Zielen gerecht zu werden.
Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien bestand aus Nationen und nationalen Minderheiten. Ein wahres ethnisches Mosaik, in dem aber zwei große Völker dominierten: die Serben und die Kroaten. Es gab sechs Nationen oder Teilrepubliken, nämlich Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Montenegro und Mazedonien. Hinzu kamen zwei kleinere Nationen, von denen jede einer autonomen Provinz innerhalb der serbischen Teilrepublik angehörte. Die Autonomie wurde ihnen bestätigt durch die Verfassung von 1974: der albanischen Nation im Kosovo und der ungarischen in der Vojvodina. Diese Verfassung Jugoslawiens enthielt im Übrigen eine Reihe von Elementen, die eher konföderativ als bundesstaatlich waren.
Auf dem Papier, so darf man ergänzen, galt es, noch ein gutes Dutzend nationale Minderheiten zu berücksichtigen: Zigeuner, Türken, Slowaken und andere. Sie waren fast überall verstreut. Die serbische Nation und die kroatische umfassten zusammen zwei Drittel der Gesamtbevölkerung des Landes, dessen Territorium sie mehr als zur Hälfte einnahmen. Unglücklicherweise sind diese zwei Nationen untereinander völlig verschieden was ihre jeweilige Zivilisation betrifft. Die Kroaten gehörten seit den ersten Jahrhunderten nach Christus in den lateinischen Einflussbereich und sind sehr früh christianisiert worden, wohingegen Serbien sich später formierte, in die von Byzanz beherrschte Sphäre geriet und seit dem 9. Jahrhundert unter der Autorität der orthodoxen Kirche stand.
So war denn der jugoslawische Staat ein künstliches Gebilde, zusammengesetzt aus vielen Völkerschaften, die nicht imstande waren, sich genügend zu vertragen, um in einer einzigen politischen Gemeinschaft aufzugehen und zu handeln. Die geschichtliche Vergangenheit war von Volk zu Volk zu sehr verschieden, ebenso die Religion, die Sprache, die Wirtschaft, Vergessen wir auch nicht die geographischen Differenzen, deren Bedeutung in diesem gebirgigen und von einer zerklüfteten Küste gesäumten Land nicht zu vernachlässigen war.
Die Gründung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen am 1. Dezember 1918 bedeutete für unser altes Europa die Entstehung der Hypothek eines schlecht geordneten und ungenügend ausgeglichenen staatlichen Systems. Es war ein missglücktes Unternehmen, das zugunsten von Peter I. Karadjordjević erfolgte, ohne dass es den beteiligten Parteien gelungen wäre, über fundamentale Fragen eine Einigung herzustellen. Die Grenzen wurden um 1919 und 1920 festgelegt durch die Verträge von Neuilly-sur-Seine, Saint-Germain-en Laye, Trianon und Rapallo. Doch der mit mangelndem Geschick aus der Euphorie der Siegermächte hervorgegangenen verpfuschten Errichtung eines Staates fehlte es einfach an innerer Kohäsion, was übrigens bei so manchen anderen Arrangements nach dem Ersten Weltkrieg der Fall war. Diese Vereinigung der Slawen im südöstlichen Europa, mit Ausnahme Bulgariens, sollte Serbien nach Kriegsende belohnen für seinen Beitrag zur Niederlage des Österreichisch-Ungarischen Reiches. Doch es ist ihr leider nie gelungen, eine solide und zuverlässige politische Institution zu bilden.
Politisch gesehen war die Struktur dieses neuen Staates das Hauptproblem. Sie wurde beherrscht vom Gegensatz zwischen Zentralismus und Föderalismus. Die Serben, die schon über eine starke Hegemonie verfügten, bevorzugten natürlich eine Zentralisierung. Ihre Politik wurde unterstützt von den Slowenen. Die Kroaten dagegen, mit ihrer ebenfalls sehr reichen Vergangenheit, die aber sehr verschieden war von der serbischen, machten sich zu leidenschaftlichen Verteidigern einer Föderation, um nicht von ihren mächtigen Nachbarn einverleibt zu werden. Es war schließlich die Zentralisierung, die sich durchsetzen konnte, und, wie zu erwarten war, erfolgte eine wachsende „Serbisierung“, die hauptsächlich in den dreißiger Jahren einen beängstigenden Verlauf nahm. Dabei wurden die führenden kroatischen und slowenischen Persönlichkeiten außer Gefecht gesetzt. Das Land änderte auch seinen Namen. Am 3. Oktober 1929, unter der Herrschaft des autoritären Königs Alexander I., nahm es den Titel eines Königreichs Jugoslawien an. In der Benennung ließ man somit die Nationalitäten unberücksichtigt. War das ein Verzicht seitens der Serben? Nicht im Geringsten. Da ihrer Ansicht nach Serbien vor Jugoslawien kam, konnten sie ihre Bestrebungen fortan als übereinstimmend darstellen mit den Ambitionen des Königreichs in seiner Gesamtheit. Es kam dann der Zweite Weltkrieg, der das Ende des ersten Jugoslawiens bedeutete. Da entwickelte sich eine wahre Gier nach Annexionen und Besetzungen: Die Deutschen und ihre Verbündeten teilten das Land unter sich auf. Unter den Ereignissen mit schwerwiegenden Konsequenzen für die Zukunft Jugoslawiens gab es nicht nur den erbitterten und zähen Widerstand Titos – vergessen wir nicht, dass Josip Broz, genannt Tito, ein Kroate war – und seiner Partisanen, sondern auch die Errichtung eines angeblich unabhängigen kroatischen Staates unter der Diktatur des obersten Chefs der Ustaschen („Aufständischen“), Ante Pavelić, der ein Pro-Nazi Regime einführte. Seit dem 7. Januar 1929 hatten die Ustaschen, mit Pavelić an der Spitze, eine Bewegung der Kroaten gebildet, die separatistisch und antijugoslawisch war.
Die Ustaschen begingen empörende Gewalttaten und abscheuliche Verbrechen unter der serbischen Bevölkerung, soweit sie sich ihrer bemächtigen konnten. Dies geschah mit dem schamlosen und entehrenden Beistand eines Teils des katholischen Klerus. Man spricht davon, dass somit etwa 750000 Serben umgekommen seien, unerbittlich niedergemetzelt, oft zuvor noch gefoltert. Man muss den Opfern hier Tausende Juden und Zigeuner hinzufügen. Um die auf den von Pavelić kontrollierten Gebieten angesiedelten Serben zu „kroatisieren“, blieben Weihwedel und Gewehr nicht müßig. Zu Kroatien gehörten damals noch ein Stück Serbiens sowie Bosnien-Herzegowina, nicht aber Dalmatien, das den Italienern unterstand. Nicht zu vergessen ist aber, dass 230000 Kroaten an der Seite Titos kämpften: 66000 von ihnen sind gefallen im Widerstand gegen die Besatzer, das heißt gegen die Deutschen und die Italiener mitsamt ihren Mitläufern, also im Besonderen auch gegen die Ustaschen.
Der antifaschistische Rat für die nationale Befreiung Jugoslawiens ernannte am 29. November 1943 Tito, den Anführer der kommunistischen Partisanen, zum Marschall der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien und stattete ihn mit sämtlichen Vollmachten aus. Das war praktisch das Todesurteil für die Monarchie. Als das Ende der Feindseligkeiten gekommen war, verhielt sich Tito als ein umsichtiger, aber unbeugsamer Politiker: Er handelte schneller als vorauszusehen war, wobei er nicht davor zurückschreckte, es im Juni 1948 zum Bruch mit Stalin kommen zu lassen. Nach der Proklamation der Republik im November 1945 führte er eine brutale Säuberung unter den kroatischen Ustaschen sowie unter den Gegnern des neuen Regimes durch, sowohl den aktiven als auch den bloß mutmaßlichen.
Tito ließ seinen großen Rivalen, den General Draža Mihailović, einen antikroatischen und antikommunistischen Serben, hinrichten. Während des Krieges hatte dieser den Anordnungen der Regierung Folge geleistet, die nach London geflüchtet war, wo sich ebenfalls der serbische König Peter II. aufhielt, dem er die Treue bewahrt hatte. So hatte er die royalistischen und antikommunistischen Widerstandskämpfer der Serben angeführt, die sich die Tschetniks nannten. Man beschuldigte ihn, mit dem Feind paktiert zu haben. Das Todesurteil beruhte aber nicht auf einem wahren Schuldigsein, sondern auf innenpolitischen Erwägungen. General de Gaulle – es ist sicherlich nicht uninteressant, diese Einzelheit festzuhalten, die allein schon ein Dementi darstellt – weigerte sich dauerhaft, Tito zu begegnen, weil er ihn als verantwortlich ansah für die Hinrichtung seines Freundes Mihailović.
Das kommunistische Regime mit zentraler Planwirtschaft wurde ab 1950 umgewandelt in ein dezentralisiertes, auf Selbstverwaltung gegründetes sozialistisches System. Fortan durften sich die Arbeiter selber bemühen um ihr berufliches und soziales Leben. Diese Entwicklung war natürlich insofern vorteilhaft, als sie mehr persönliche Freiheit und Initiative einzubringen erlaubte. Die staatliche Gesellschaftsordnung konnte gelockert und vom Stalinismus und dessen sozialistischer Bürokratie losgelöst werden. Doch dieser Vorteil förderte zugleich in den Teilrepubliken und Provinzen ein Trachten nach Autarkie, zuerst auf wirtschaftlichem Gebiet, dann aber auch auf sozialem und politischem. Letztlich begünstigte er die Bestrebungen nach Unabhängigkeit.