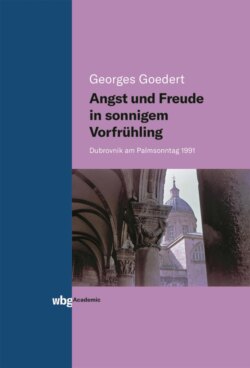Читать книгу Angst und Freude in sonnigem Vorfrühling - Georges Goedert - Страница 7
I. Palmsonntag
ОглавлениеEs ist wiederum Palmsonntag. Viele Jahre sind vergangen seit meinem Besuch in Dubrovnik. Ich sitze zuhause an meinem Schreibtisch. Ein regnerischer Vormittag. Das Stück vom Wohnviertel, mit seinen Häusern und Gärten, das ich vor meinem Fenster erblicke, ist überzogen vom trüben Schleier eines kaum sichtbar zu Boden gehenden feinen Sprühregens. Ein gleichmäßiger, einfarbig bleichgrauer Himmel wölbt sich über der Stadt. Es wird heute der Sonne kaum gelingen, diese Wolkendecke zu durchdringen.
Vor Kälte schaudern in den Gärten die Kirschbäume, bereits übersät von ihren feinen, zartrosigen Blüten, und die Magnolien sträuben sich sichtlich, jetzt schon pomphaft in Erscheinung zu treten: Noch leuchten sie nicht in ihrem prunkvollen Kleid aus Weiß und Lila, nicht gewillt, ihren üppigen Schmuck zu entfalten, weil die Unbilden der Witterung ihn verunstalten könnten. Die Forsythien, die bereits mit ihrer tief gelben Blütenpracht auftrumpfen, machen den Eindruck, sie hätten sich in der Zeit geirrt, inmitten von Sträuchern, die noch kahl sind und gerade erst begonnen haben, Knospen zu treiben. Sie bräuchten den Kontrast eines blauen Himmels und die Strahlen einer wärmenden Sonne. Bereits aufgeblühte Tulpen, eine Seltenheit noch, beugen, beschwert von der Feuchtigkeit, ihre faltenreichen, farbigen Köpfe, während die Narzissen, goldgelb oder weiß – die weißen tragen bekanntlich den schönen Namen „Poeten-Narzissen“ –, deren Blütenblätter die weit geöffneten, mit feinen Krausen geschmückten Kelche umrahmen, sich den Anschein geben, mit größerem Elan gegen das nasse Grau anzukommen.
Palmsonntag, von den Franzosen auch „fête des Rameaux“ genannt, wohingegen die Engländer bescheidener, wie die Deutschen, von einem „Palm Sunday“ sprechen. Ich mag hier das Wort „fête“ nicht besonders, da ich nur schwerlich als „Fest“ einen Tag bezeichnen kann, der die Karwoche einleitet. Zwar gebe ich gerne zu, dass man die Freude des Osterfestes vorwegnehmen kann, indem man des triumphalen Einzugs Jesu in Jerusalem gedenkt. Das hindert aber nicht daran, dass die Reihe der Gottesdienste, die mit diesem Sonntag eröffnet wird, eigentlich ernsten Gedanken dienen soll, einer inneren Sammlung, einer Meditation, die sich nicht selten als Gebet herausstellt. Dazu gehört zweifellos ein gewisser Ernst, wenn nicht sogar eine Neigung zur Trauer. Die Passion weist den gläubigen Menschen hin auf die Erlösung, sicher, denn sie geht der Botschaft von der Auferstehung voraus. Zunächst aber verleiht sie die durchaus realistische Darstellung von Christi Leiden und Tod, die es vermag, unser Mitleiden zu erregen und uns zugleich nachdenklich zu stimmen in Bezug auf das letzte Stück unseres eigenen Weges durch die Zeit.
Eine festliche Atmosphäre herrschte allerdings, als Jesus einst, kurz vor seiner Passion, in Jerusalem von einer jubelnden Menschenmenge empfangen wurde. So berichten es die Evangelien. Das Volk aber, bei dieser Gelegenheit so beflissen, seine Kleider auf dem Weg auszubreiten, den Christus auf einem jungen Esel sitzend nahm, Palmenzweige zu schwenken und ihm „Hosanna dem Sohn Davids!“ zuzurufen, wird ungefähr auch dasjenige sein, das ihn bald darauf verhöhnt und ihn, aufgebracht und grausam, der Kreuzigung preisgibt, indem es von Pilatus das Leben des Verbrechers Barabbas fordert und nicht das seine. Zu den körperlichen Torturen, von denen die Passionsgeschichte berichtet, sind zweifellos bittere seelische Qualen hinzugekommen. Allerdings schweigt darüber die Schrift. Gefühle gelangen in ihr nur selten zur Sprache, aber es dürfte uns nicht schwerfallen, gerade auch diese seelische Folter zu erahnen, ja sogar nachzufühlen, die von solcher Wankelmütigkeit hervorgerufen wurde. Undank kann sehr verletzend sein. Das muss hier der Fall gewesen sein insofern, als die Tragödie der Passion auch nach rein menschlichen Gesichtspunkten auszulegen ist, nicht nur nach übernatürlichen.
Also ein regnerischer Vormittag Anfang April, bei mir zuhause, an meinem Schreibtisch. Die Stimmung ist alles andere als freudig. Es herrscht zu dieser frühen Stunde eine Stille, deren Wirkung eher belastend ist als wohltuend. Ein paar schwarze Raben kreisen in der Luft mit ihrem widrigen Krächzen. Angenehmer dagegen klingt das unaufhörliche Gezwitscher der Amseln, die eine Art Konferenz abhalten, indem sie sich von einem Garten zum andern Rede und Gegenrede schicken. Einige Wagen fahren vorbei, fast geräuschlos. Ich nehme sie kaum wahr. Dagegen wird die Ruhe des Himmels hie und da gestört durch das brausende Eindringen eines Flugzeugs, das plötzlich den sonntäglichen Frieden mit dem Dröhnen seiner Motoren zerreißt.
Ganz in meiner Nähe ragt der Glockenturm der dem heiligen Pius X. geweihten Pfarrkirche des Wohnviertels Belair empor, mit dem regelmäßigen Schlag seiner Uhr, die mit ihrem metallischen Klang unerbittlich den Fluss der Zeit skandiert. Wenn die Stunde des Hochamtes naht, vermag der sich so stolz erhebende Bau, dieser mit seiner prächtigen Verkleidung aus Stein und Glas versehene Wächter, ein Wahrzeichen der Stadt für den Reisenden, der sich ihr von Süden nähert, nur ein paar schüchterne und schwächliche Töne zu erzeugen, die mit einer geradezu kleinlichen Knickrigkeit von der letzten noch diensttuenden Glocke gespendet werden. In der Tat bleiben fortan die drei Schwestern verstummt, die mit ihr getauft und installiert wurden vor fast schon einem halben Jahrhundert. Die Glocke, die ich wahrnehme, ist augenblicklich die letzte, der es noch gelingt, sich zu behaupten. Sie ist nun allein gelassen – fast dauert sie mich –, sie ist die einzige, der noch erlaubt wird, sich hören zu lassen, weil der Turm wegen seiner inneren Mängel und Schäden nichts anderes mehr duldet als dieses schäbige, stammelnde, ärmliche Geläute. An diesem so wenig einladenden Vormittag im April klingt es wie eine geradewegs zu Herzen gehende Klage, die nichts mehr gemeinsam bat mit dem lebhaften Schwung von früher, an dem mindestens zwei Glocken beteiligt waren. Der Kirchturm, schlank und elegant, jedoch am Ende seiner Kräfte, wartet auf die Restaurierung, fast wie ein Kranker, der sich danach sehnt, seine Gesundheit wiederzuerlangen.
So ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass ich in einem derartigen Ambiente dazu neige, mich ganz auf mich selbst zurückzuziehen. Innerlich betrachte ich die Bilder, die allmählich reihenweise aus den nebeligen Gründen des Gedächtnisses spontan zu meinem bewussten Denken emporsteigen.
Sie sind in Bewegung, zeichnen sich ab, bilden sich aus, vermehren sich. Zuerst zögernd, verschwommen, unscheinbar, schwer zu ergreifen und zu fixieren, immerfort bereit, wieder in das Labyrinth des Vorbewussten unterzutauchen, werden sie allmählich kraftvoller, eindringlicher, in dem Maße, wie es mir mittels bewusst herbeigeführter Anstöße meiner Gedanken gelingt, sie zu vereinen und für sie einen Platz zu finden in der immer kohärenter werdenden geistigen Vernetzung. Palmsonntag – was gibt es da nicht alles an Erinnerungen, die auftauchen, sich überstürzen, wieder verschwinden, sich durchdringen und verknüpfen, sich gegenseitig ergänzen? Fetzen, Fragmente streiten sich um den Brennpunkt des Bewusstseins, steigern sich plötzlich und verlieren dann schnell an Kraft. Die allmählich sich ausweitende Reflexion schält den inneren Kern heraus. Sie wird mehrfach getragen durch emotionale Zustände, die teils schläfrig sind und verschwommen, teils aber lebhaft, ja sogar schmerzlich, wenn sie sich beherrschen lassen von der Sehnsucht nach dem Vergangenen, die sich mit den heraufbeschworenen Bildern vorübergehend einstellt.