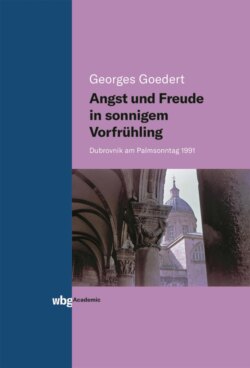Читать книгу Angst und Freude in sonnigem Vorfrühling - Georges Goedert - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Bilder von einst
ОглавлениеErinnerungen an Palmsonntage, ja, da gibt es bei mir deren viele, auch weithinaus über den Aufenthalt von 1991 in Dubrovnik. Alle sind sie geprägt von der so charakteristischen Atmosphäre dieses Tages, da in der Kirche die Liturgie bestimmt ist von Trauer und Hoffnung. Ergreifend erinnert sie an die Überwindung der Finsternis. Sie weist hin auf den Glauben an das Licht, an das Leben, der stärker sein soll als alle Bedrängnis. Die Nacht vergeht, wenn der Tag erscheint. Verirrung droht nicht mehr, da der Morgen langsam dämmert und die Dunkelheit vom Wege des aus dem Reich des Schattens kommenden Pilgers weicht, wenn sich vor dessen staunendem Auge bleiche Streifen am Horizont bilden im aufgehenden Licht der sich nahenden Sonne.
Bilder von einst – sie entstammen einer längst vergangenen Zeit. Ich denke an meine Kindheit im Bahnhofsviertel meiner Heimatstadt Luxemburg, an den Palmsonntag in der Pfarrkirche Herz Jesu, sowohl im Krieg noch als auch in der Nachkriegszeit. Ich kann mich gut in die Atmosphäre von damals zurückversetzen. So öffne ich denn gedanklich die Pforte, die in das Land meiner Erinnerungen führt und für die ich allein den Schlüssel besitze. Jeder Mensch hat seine eigene Pforte zwecks Zulassung zur Vergangenheit.
Besser kann seine Individualität sich wohl kaum unter Beweis stellen als durch seine Erinnerungen. Er allein ist es, der in der Welt gelebt hat, zu der sie Eingang verleihen. Für jeden von uns tragen die eigenen Erinnerungen in ihren Verknüpfungen das unverwechselbare Kolorit individueller Perspektiven, Gedanken, Gefühle, Wünsche, Begierden – dank den ihnen zugrundeliegenden Umständen, die sich im Laufe seines Lebens eingestellt haben. Das verleiht ihnen einen streng persönlichen Charakter. Dabei gibt es sogar die Möglichkeit, sich an Erinnerungen zu erinnern. Das vertieft noch deren Einzigartigkeit.
Jedes menschliche Leben hat seine eigene Geschichte, die nie identisch sein kann von einem Menschen zum anderen. Es gibt also keine zwei Schlüssel für ein einziges Portal, die absolut dieselben wären, denn jeder ist einmalig und wird nur von demjenigen Menschen verwendet, dem er gehört: Er ist nicht übertragbar auf andere. So kann er auch nicht einem Erben hinterlassen werden. Bis in die kleinste Einzelheit hinein gilt die Singularität, was sowohl auf gedankliche, wie auf emotionale und biologische Fakten zurückzuführen ist. Kommunikation ist eigentlich nur dadurch möglich, dass ähnliche Bewusstseinsinhalte beim Mitmenschen bestehen oder geweckt werden. Von all diesen einzelnen Schlüsseln verliert jeder beim Tod seines Besitzers seine Funktion: Das Schloss, auf das er passt, kann nicht mehr geöffnet werden, jedenfalls nicht in einer diesseitigen Optik.
Erinnerung: Einst nahm ich als Ministrant teil an dem Hochamt mit Palmsegnung, der für uns Katholiken den Einzug in die Karwoche bedeutet. Zusammen mit zahlreichen Kameraden wurde ich beordert, die kleinen Dienste in der Liturgie zu verrichten. An ernsthafter Beflissenheit fehlte es uns nicht, denn wir fanden, das alles gehöre zur Feierlichkeit des Tages. Ich kann mich noch bestens an unsere kardinalroten Tuniken erinnern. Sie waren verschönert durch ein weißes, mit Spitze bordiertes Chorhemd und an Hals und Schultern bedeckt mit einem breiten, aus demselben roten Stoff geschnittenen Kragen. Wir trugen kein Käppchen. Überhaupt kamen unsere Herren Geistlichen nicht auf die Idee – ich möchte sagen: glücklicherweise –, uns wie kleine, werdende Domherren zu kostümieren. Wir fühlten uns sogar ein wenig stolz auf unser Kleid.
Es war stets eine eindrucksvolle Zeremonie, eine weihevolle Stunde. Beim Hochamt am Palmsonntag war für uns Jungen das markanteste Ereignis weniger die Segnung der Buchszweige als der Vortrag der Matthäus-Passion, natürlich in lateinischer Sprache. Es war ja noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Drei Zelebranten nahmen daran teil, unterstützt durch die Einlagen des Chores, der sich auf der Empore befand. Man sprach von dem „langen“ Evangelium. Indessen hatte man in der damaligen Zeit nichts dagegen einzuwenden. Es gab da keinen Grund, ungeduldig zu werden. Die Aufführung, das habe ich behalten, entbehrte weder der Schönheit noch der Feierlichkeit. Sie zu kürzen, kam überhaupt nicht infrage. Das hätte man damals als ein Sakrileg empfunden. Man begann mit dem Anfang des Kapitels 26, an der Stelle, wo der Text uns berichtet, wie Jesus seinen Jüngern verkündigt: „Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Paschafest ist; da wird der Menschensohn ausgeliefert und gekreuzigt werden.“ Die Leidensgeschichte nimmt dann ihren Lauf: Die Obersten der Priester und die Ältesten des Volkes versammeln sich im Palast des Hohepriesters Kaiphas und schmieden ihr Komplott.
Muss man nicht bedauern, dass inzwischen das Passionsevangelium gekürzt wurde? Die Zeiten haben sich natürlich geändert. Es fehlt uns heute stets an Zeit. Selten trifft man noch einen Menschen an, der, seinen Verpflichtungen nachgehend und überhaupt seinen Beschäftigungen, sich nicht darüber beklagen würde, er habe nie Zeit. Wir knausern mit der Zeit wie Harpagon, Molières Geizhals, mit seiner Kassette. Wir fürchten, sie zu verlieren oder sie aufzuwenden, ohne dafür einen passenden Gegenwert zu erhalten. So hat man sich denn genötigt gefühlt, den Text des für die Messe am Palmsonntag bestimmten Matthäusevangeliums stark zu kürzen. Er wird auch nur noch wenig gesungen: Man hält sich an Lektoren. Heißt das, dass es im Klerus an fähigen Sängern mangelt? Das mag natürlich sein, doch vor allem geht es mit der einfachen Lektüre viel schneller. Von den Leuten wird heutzutage überall Geschwindigkeit verlangt. Sie wird bevorzugt selbst in Situationen, die sich naturgemäß mit einer gewissen Langsamkeit entwickeln müssten. Auch könnten sie der Seele wenigstens hie und da die Möglichkeit bieten, sich von den Strapazen zu erholen, an denen das Leben in unserer modernen Gesellschaft ja so überreich ist. Richtig rezipieren, heißt das nicht, Vorstellungen in aller Ruhe auf sich wirken zu lassen?
Man möge sich vorstellen, dass in den Kirchen Leipzigs zur Zeit Johann-Sebastian Bachs die Karfreitagsvesper, die jeweils auch die Aufführung einer Passion enthielt, schon um Viertel nach eins begann. Es kam vor, dass sie einen ganzen Nachmittag einnahm. Natürlich denken wir hierbei ganz speziell an die Matthäus-Passion, dieses großartige Werk, das immer wieder erneut zutiefst bewegend ist, besonders natürlich in der Passionszeit. In seinem Genre ist es zweifellos das berühmteste. Seine erste Aufführung fand am Karfreitag des Jahres 1729 statt. Es ist aus zwei Teilen zusammengesetzt, die anfangs dazu dienten, die Predigt zu umrahmen.
Unsere heutige Einstellung zum Leben wird beherrscht von einer sich als immer rationeller erweisenden Organisation unseres Tagesablaufs, die sich eingeschlichen hat bis hinein in unsere Freizeitgestaltung. Der Stress wächst in dem Maße, wie sich immer mehr aus der Zeit Geld schlagen lässt. Es zeigt sich eine Tendenz zu einer allgemeinen Kommerzialisierung. So erleben wir eine Tyrannei der Zeit, die Drangsal der in Rechnung gestellten Minuten, als ob das Kalkül, die pure Quantifizierung, auch nur im geringsten die Güte und Schönheit derjenigen Augenblicke ersetzen könnte, die dank ihrer Qualität die Dimension unseres Intellekts übersteigen und uns an die Grenzen des Unsagbaren führen. Die mechanische Zeit ist tatsächlich zu einer unerbittlichen „peau de chagrin“ geworden (einem harten Chagrinleder, wie der Franzose Balzac es nannte): je mehr wir sie nutzen wollen, desto knapper wird sie. Deswegen unser Eindruck, an Geschwindigkeit noch zu verlieren, anstatt zu gewinnen.
Das erinnert mich an den Spruch, den ich in Metz entdeckt und schon so oft gelesen habe, und zwar auf dem Platz vor der Kirche Notre-Dame de Metz, deren Berühmtheit daher rührt, dass in ihr 1844 der Dichter Paul Verlaine die Taufe empfangen hatte. Viele kennen diesen schmucken kleinen, vom Sonnenlicht überfluteten Platz – rechts, wenn man die alte Rue de la Tête d’or hinuntergeht – mit fast südlichem Charakter. Einige erst vor kurzem gepflanzte Lindenbäume sorgen für Verschönerung. Wenn sie einige Jahre gewachsen sind, werden sie im Sommer erholsamen Schatten spenden und die Nächte mit ihrem wunderbaren Duft erfüllen. Der Platz wird überragt von der breiten Barockfassade der Kirche mit ihrem mirabellgelben Anstrich. Schräg gegenüber steht ein sichtlich neugestaltetes altes Haus mit Eingang an der vorderen Seite, die am Rande des Platzes liegt und einen rechten Winkel bildet mit der Rue de la Chèvre. Auf einer Mauerfläche, unter einer hübschen Sonnenuhr, kann man dort in einem etwas holperigen Französisch folgende Inschrift lesen: Passant, prends le temps, sinon il te prend – „Passant, nimm dir die Zeit, sonst nimmt sie dich.“