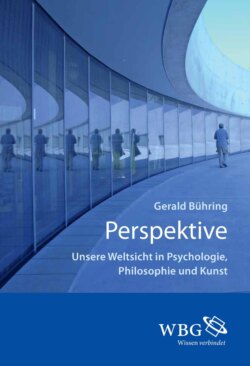Читать книгу Perspektive - Gerald Bühring - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kulturelle Verschiedenheiten
ОглавлениеIndes erklärt das dreistufige Entwicklungsmodell »Animismus → Ästhetizismus → Realismus« nicht allein die Entdeckung der Zentralperspektive. Zu bedenken ist auch, dass die einzelnen Völker völlig verschiedene Sprachen, Sitten, Gebräuche, Wahrnehmungen etc. ausbildeten. Zum Beispiel heißt es von den alten Griechen: »Was ist unser Geschwätz von den Griechen! Was verstehen wir denn von ihrer Kunst, deren Seele – die Leidenschaft für die männliche nackte Schönheit. Erst von da aus empfanden sie die weibliche Schönheit. So hatten sie also für sie eine völlig andere Perspektive als wir. Und ähnlich stand es mit ihrer Liebe zum Weibe. Sie verehrten anders, sie verachteten anders« (Nietzsche 1976b, S. 145f.). Und weil die Wahrnehmung aufs Engste mit der Kunst verwoben ist, müssen auch hier kulturelle Unterschiede bestehen. Das erkannte auch Ernst Große (1862–1927), als er schrieb, dass die »Ostasiaten die Dinge nicht bloß anders beurtheilen als Europäer, sondern auch anders sehen. Sie richten den Blick auf Theile und Seiten der Erscheinungen, die wir zunächst kaum oder gar nicht bemerken, während sie wiederum andere übersehen, die sich unserem Auge vor allen aufdrängen. Nirgends offenbart sich diese Verschiedenheit so grell als in der Auffassung des menschlichen Körpers. Man erstaunt immer von Neuem darüber, wie stumpf der Blick des Japaners für den Bau des Leibes und der einzelnen Glieder in seiner feinen für das Individuum charakteristischen Ausbildung ist: er erfaßt alle Formen, sogar die Gesichtszüge, nur im Allgemeinen. Aber derselbe Mann überrascht uns nicht minder durch die wunderbare Schärfe und Feinheit seiner Wahrnehmung für Bewegungen« (Große 1900, S. 205). Wenn also die Ostasiaten auf Bewegungen achten, so haben die Europäer offenbar größere Chancen gehabt, die Zentralperspektive zu entdecken, und zwar deshalb, weil sich die »ars perspectiva« nicht von der dynamischen, sondern von der statischen Sichtweise herleitet.
Es bedarf noch eines weiteren Aspektes. Wie anderenorts schon erwähnt, muss nämlich der künstliche Raum samt seiner Gegenstände gekonnt verzerrt werden, um ein echtes Raumgefühl zu ermöglichen. Verzerrungen von Linien gehen jedoch häufig mit »geometrisch-optischen Täuschungen« einher. Außerdem gilt, dass bei zweidimensionalen Darstellungen der Täuschungsgrad geringer ist als bei dreidimensionalen. Warum das so ist, erklärt Barbara Gillams (1935–1996) in »funktionale Wahrnehmungstheorie«. Wahrnehmungstäuschungen haben demnach die funktionale Bedeutung, Raumtiefe zu signalisieren. »Die auf der Entschlüsselung perspektivischer Elemente beruhende funktionale Theorie der optischen Täuschungen findet eine Stütze in der Beobachtung, dass Figuren, die perspektivische Elemente enthalten, auf Menschen, die nicht an rechtwinklig gebaute Räume, Häuser und Städte gewöhnt sind, weniger täuschend wirken« (Gillam 1986, S. 112). Beispielsweise trifft dies auf die »Kreiskultur« der südafrikanischen Zulus zu. Sie leben in runden Hütten mit runden Türen und pflügen krumme Furchen in ihre Felder. Rechtwinklige Begrenzungen wird man nur selten auf ihren Besitzungen finden. Sie leben in einer aperspektivischen Welt.
Wie wir inzwischen wissen, braucht es nicht unbedingt die Zentralperspektive, um räumliche Eindrücke zu erzeugen. Auch Überschneidungen, Texturen, Farbunterschiede, Licht und Schatten indizieren Raumtiefe. Mit solch relativ einfachen Mitteln haben es die japanischen Künstler verstanden, »wunderbar große, perspectivische Wirkungen hervorzubringen, – und zwar schon lange, bevor sie bei den Holländern in die Schule gegangen waren« (Große 1900, S. 219). Desgleichen suggerieren ältere chinesische Tuschezeichnungen räumliche Sujets, welche durch geschicktes Nuancieren von Licht- und Farbgebung zustande kommen. Obschon künstlerisch vollkommen, wirken sie für europäische Augen dennoch etwas flächig.
Natürlich hat auch die chinesische Malerei eine lange Tradition vorzuweisen. Ihre Anfänge reichen vermutlich bis 1500 Jahre vor die Zeitrechnung zurück. Ähnlich wie in der abendländischen Malerei favorisieren die Chinesen um 600 n. d. Zr. vorwiegend religiöse Themen. Während der Tangdynastie (618–907 n. d. Zr.) erblühte die Landschaftsmalerei. Charakteristisch für diese Epoche ist der »sogenannte ›Blaugrün-Stil‹ des Malers Li Sixun und seines Sohnes Li Zhaodao« (http://de.org/wiki/ChinesischeMalerei/Zugriff: 08.07.2013). Bekannt ist den Chinesen auch die Fresco-Malerei, die im 8. Jahrhundert ihren Höchststand erreichte. Vergleicht man die europäische Landschaftsmalerei mit der chinesischen, so hat man den Eindruck, dass auf naturgetreue Darstellung kein Wert gelegt wird. Wichtig sind vielmehr Idylle, Stimmung und Bewegung. Räumliche Entfernungen werden mittels Farbgebung, undeutliche Umrisse und Nebelschleier kenntlich gemacht, indes die Figuren klar umrissen und farbig voneinander abgesetzt sind sowie bedeutungsperspektivische Muster aufweisen.
Eine erhebliche Rolle spielen schließlich die unterschiedlichen Wertorientierungen. Völker unterscheiden sich in ihren Lebensgewohnheiten, der Art und Weise, die Dinge zu sehen, zu abstrahieren und zu bewerten. So zeugen etwa die naturalistischen Tierdarstellungen der San, Inuits und Tchukchis von einer erstaunlichen Beobachtungsgabe. Ihre groben Figuren spiegeln eine Lebensechtheit wider, schreibt Ernst Große, welche manche kunstvoll ausgeführten Entwürfe in höheren Kulturen vermissen lassen. Nichtsdestotrotz sind die perspektivischen Kenntnisse der Jäger und Sammler mangelhaft; denn man findet bei den San lediglich das Prinzip der »Verkleinerung« (vgl. Große 1928, S. 184). Offenbar scheint ihnen – wie den paläolithischen Schamanen – eine detaillierte Abbildung des Jagdwildes wichtiger zu sein als die künstlerische Perspektive.
In Anbetracht dessen scheint es opportun, von einem »zweckdeterminierten Kunstbegriff« zu sprechen; denn der einen ethnischen Gruppe dient die Malerei dem forcierten Jagdglück, der anderen der Beschwörung und Heiligung von Naturgöttern, einer dritten der Erzählung von Geschichten, einer vierten dem ästhetischen Kunstgenuss, einer fünften dem Bedürfnis, naturalistisch zu zeichnen und einer vierten der Selbst- und Machtverherrlichung, während dem modernen kosmopolitischen Menschen der Sinn nach allen möglichen Kunstrichtungen steht. Künstlerische Entwicklungen und Darstellungen sind also relativ zu bewerten.
Man denke zum Beispiel an die unselige Gleichschaltung der Kunst im Dritten Reich und die sogenannte »sozialistische Malerei« in der Deutschen Demokratischen Republik zum Zwecke verherrlichender Prestigegelüste.
Fassen wir kurz zusammen, welche phylogenetischen Aspekte zur Entwicklung der perspektivischen Anschauung beigetragen haben: 1. der menschliche Funke des Bewusstseins 2. die Einübung der Zeichenkunst 3. die Hinwendung zur sogenannten »Wie-Facette« 4. der Einfluss rechtwinkliger Raumstrukturen 5. die Erfindung der Verzerrungstechnik 6. die statische Sichtweise 7. die Empfänglichkeit für geometrisch-optische Täuschungen 8. im Falle der Bedeutungsperspektive die Ideologisierung der Kunst.