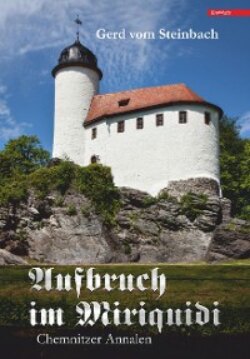Читать книгу Aufbruch im Miriquidi - Chemnitzer Annalen - Gerd vom Steinbach - Страница 8
Der Zug zum Miriquidi
ОглавлениеLangsam und undeutlich, wie durch einen Pelz gedämpft, dringt unverständliches Gemurmel an seine Ohren, welches die Nervenstränge mühevoll in das Gehirn leiten, wo es hundertfach von pulsierendem Schmerz bedrängt und ganz schwach als Wahrnehmung registriert wird. Gleich einer Gebirgsquelle sprudeln die Eindrücke allmählich immer zügiger und finden endlich ihren Ausdruck im Erkennen.
„Mein Gott, das hätte schlimm ausgehen können!“
„Es ist schlimm ausgegangen! Sieh doch mal die linke Seite an, er blutet wie ein gerissenes Schaf.“
„Hoffentlich ist im Inneren noch alles an seinem Platz.“
„Gebe es Gott, dass es ihm nicht geht wie …“
„Lass mal gut sein, Wiprecht“, wirft Frieda ein, „niemand weiß, ob er später lahmen wird, auch wenn er allemal – genau wie sein Vater und seine Brüder – keine Rücksicht gegen sich selbst kennt!“
„Über diese Härte ist eure Mutter fast zerbrochen!“ Wiprecht ist nicht bereit, so schnell Frieden zu geben.
„Also los, du Eisenmann, steh auf!“
Als Rudolf, dem Schmerz ausweichend, sich nach rechts abstützt, um auf die Beine zu kommen, gebietet Hildburga mit einem energischen Handzeichen zu verharren.
„Nicht so schnell, erst sehe ich mir die linke Seite an. Wenn Schmutz in die Wunde dringt, kann du dir den Wundbrand holen oder eine Blutvergiftung.“ Ohne auf seine Abwehr zu achten, hilft ihm die Alte, den Kittel abzustreifen. Hautabschürfungen ziehen sich von der Achsel bis zur Taille, wo sie in eine klaffende Wunde übergehen. Die Blutung hat inzwischen nachgelassen.
„Na ja, direkt lecker sieht es ja nicht aus“, meint Wiprecht, „aber richtig ausgewaschen und mit ein paar Kräutlein darauf, sollte es schnell heilen.“
Sogleich hat Frieda ein Läppchen hervorgekramt und eilt hinüber zum Bach, es zu nässen. Währenddessen sucht Wiprecht in seinem Beutel, der mit den verschiedensten Kräutern gefüllt ist. Im Verlaufe der Fahrt und insbesondere bei den Aufenthalten hat er sie am Wegrand und an den Rastplätzen gesammelt, so wie er es seit eh und je hält.
Nachdem Frieda die Wunde gründlich gesäubert hat, legt Wiprecht die Blätter und Kräuter auf, die ihm geeignet und hilfreich erscheinen. Hildburga reißt Stoffbahnen und legt endlich dem Verletzten einen Wickel an.
Nachdem Rudolf seinen Kittel übergestreift hat, erhebt er sich ächzend. Während Wiprecht seine Sachen zusammenpackt, fragt er die alte Helferin mit hochgezogenen Brauen:
„Warum hast du das nicht allein erledigt, Mutter Hildburga? Du kennst dich doch nicht schlechter aus als ich. Deine Mutter war schon eine geschickte Heilerin, so wie auch deren Mutter und ebenso könntest du es nicht minder sein. Warum willst du keine Heilerin sein?“
Traurig schüttelt die Alte den Kopf. „Es ist heute besser, nicht zu viel preiszugeben. Auch du hast es wohl bemerkt, dass mich der Pater zu Hause nicht litt. Als Ungläubige und Götzendienerin hat er mich beschimpft und die Leute gegen mich aufgehetzt. So wird es mir und allen Heilerinnen immer gehen, ja, es wird noch schlimmer werden. Die Kirche hat Angst vor unseren alten Göttern und vor unserem alten Wissen. Deshalb nehme ich die Qual dieser Reise auf mich. Habe ich jemals etwas Böses getan? Trotzdem werde ich angefeindet, wenn ich vor Unheil warne, wird mir gar die Schuld daran zugeschoben.“
„Wird es dort besser sein, wo wir hinwollen?“ Wiprecht schüttelt den Kopf. „Mönche und Priester verkünden überall den rechten Glauben – sagen sie.“
Hildburga nickt lächelnd. „Das mag schon stimmen, aber wir ziehen in die Wildnis und dort hat die Kirche noch nicht recht Fuß gefasst. Die Gegend heißt Fegunna – Waldgebirge. Hier lebten in Vorzeiten schon einmal unsere Ahnen, doch weiter im Norden, am Rande des endlosen Waldes. Sie nannten ihn Eichenwald, die Römer übersetzten den Namen in ihre Sprache als Arkynia. Keiner traute sich tief hinein und schon gar keiner hindurch. Unsere Ahnen nannten sich damals Hermunduren. Deren Mutigste waren immerhin soweit nach Süden vorgedrungen, dass sie auf die schroffen Berge stießen, deren Unterholz dichten Hecken glich. Es war eine besonders reiche Jagdgegend. Und sie kannten schon die Höhlenberge, die nun unser Ziel sind.“
Wiprecht krault sich nachdenklich den Bart: „Woher willst du das wissen, Alte? Du denkst dir doch nur Geschichten aus.“
Stolz wirft Hildburga den Kopf nach hinten, drückt den gekrümmten Rücken etwas durch. „Im Gegensatz zu denen, die nur über andere tratschen, wurden bei uns abends Geschichten über unsere Vorfahren und unser einst so mächtiges Volk erzählt. So haben wir unser Wissen bewahrt. Da ich aber nun die Letzte in der langen Reihe meiner Familie bin, wird all das Wissen mit mir untergehen. Nur ein paar Brocken bleiben bei dir und den anderen, bis auch diese verbleichen. Aber eines erhoffe ich mir: keine garstigen Anfeindungen mehr von Priestern des neuen Glaubens.“ Damit dreht sich die Alte um und stapft davon.
Wiprecht hebt die Schultern und wendet sich an seine Frau: „Wo soll das nur hinführen? Da hat jemand so viel Wissen in seinem Kopf und will es doch nur um seiner eigenen Sicherheit willen verbergen.“ Frieda legt ihm die Hand auf den Arm. „Ach, Wiprecht, sorge dich nicht. Mutter Hildburga wird ihren Frieden finden. Vielleicht sollten wir uns mehr um sie kümmern und vor allem ihr reiches Wissen zu erringen suchen.“
„Da magst du wohl recht haben“, Wiprecht legt seine Hand fest auf die ihre, „mit jedem Stück Wissen, das verloren geht, wird die Menschheit ein Stück zurückgeworfen. Wenn wir altes Wissen mit neuen Erfahrungen vereinen, kommen wir mit Riesenschritten voran.“
Rudolf hat inzwischen den Wagen umrundet. Der Anblick seines Gefährtes stimmt ihn nicht froh. Beide Vorderräder sind zerbrochen und die Naben sitzen auf dem Boden auf. Speichen säumen die Fahrspur, als hätte jemand Runen geworfen. Vor den Hinterrädern erhebt sich eine rundgewaschene Steinschwelle, als wolle sie jegliche Passage verhindern. Das Ladegut hat sich verschoben und drückt gegen den derben Stoff der Plane. Es mutet wie ein Wunder an, dass die Spriegel gehalten haben. Die Ochsen ruhen stoisch an der Deichsel und knappern an den letzten Blättern eines Astes, der ihnen direkt vor dem Maul hängt. Hinter dem Wagen spannt sich eine Kette straff vom Wagenboden in das hohe Gras, wo sie am längs liegenden Bremsbalken endet. Die zweite Kette, die den Balken quer zur Fahrtrichtung hielt, baumelt zerrissen herab.
„Nun weißt du, wie es zu dem Unfall gekommen ist.“ Die kräftige Stimme von hinten reißt Rudolf aus seinen Betrachtungen. „Auf halber Höhe hat sich der Bremsbalken an einem Baumstamm verfangen. Darum ist die Kette gerissen und der Wagen hat die Rindviecher ungebremst ins Tal geschoben. Nur gut, dass sie sich nicht die Knochen gebrochen haben. Schlimm nur, dass die Räder hinüber sind.“ Reinhold, der aufgrund seiner Erfahrungen als Fuhrmann eine wichtige Stütze für Hildebrand ist, pendelt seit Jahren als Händler zwischen Rhein und Sorbenmark. Für Hildebrand, den Kolonnenführer, war es ein Glücksfall, dass Reinhold mit dem Handel kein hinreichendes Auskommen mehr fand und bereit war, sich mit seiner Familie dem Treck anzuschließen. Nicht nur sein Geschick als Fuhrmann, auch seine Stärke und die Gewissheit, dass er die Sprache der Sorben versteht, machen ihn für die Kolonne unersetzlich. „Gottlob konnten wir die nachkommenden Gespanne im Bogen herunter führen. Es hätte leicht Schlimmeres passieren können. Aber komm jetzt, Hildebrand hat die Wagenführer zusammengenommen. Wir müssen beraten.“
Die schweren Planwagen bilden auf der langgezogenen Lichtung entlang des Bachlaufes einen weiten Kreis, in dessen Zentrum Schieferplatten das Gras unterbrechen. Die weiße Herbstsonne senkt sich bereits hinter die Wipfel der alten Eichen, deren kahle Äste bizarre Muster auf die Lichtung malen. Die kraftlosen Sonnenstrahlen erwärmen kaum noch den Boden, doch die fröstelnd hochgezogenen Schultern einiger Männer lässt auch ihre Gemütslage ahnen. Um vieles lieber würden sie jetzt um das Herdfeuer ihrer Hütte sitzen als hier im Freien zu hocken. Bald schon wird der Frost den Boden aushärten und an ein festes Dach über den Kopf ist noch lange nicht zu denken. Eigentlich ist es die denkbar ungünstigste Zeit für eine Umsiedlung in ein unbekanntes, unerschlossenes Land. Sie hätten warten sollen, bis die schlimmsten Fröste vorüber sind, und den Neubeginn im Frühjahr wagen sollen. Aber die Reise ins Ungewisse entsprang nicht allein ihrem Willen. Wie der Dorfschulze in der alten Heimat hat erkennen lassen, soll wohl ein Befehl König Heinrichs schuld gewesen sein, dass sie zu so unbilliger Zeit aufbrechen mussten.
Der Anführer Hildebrand sticht heraus unter seinen Männern. Nicht nur, dass er bereits in der Blüte seines vierten Lebensjahrzehnts steht, was man ihm auch ansieht, auch sein Selbstbewusstsein und seine Autorität spiegeln unverkennbar seine anerkannte Führerrolle wider.
„Hört gut zu“, beginnt er, als alle beisammen sind. „Der Unfall von Rudolf ist eine ernste Angelegenheit, die uns gehörig zu schaffen macht. Doch gibt uns diese unerwartete Atempause auch die Möglichkeit, unser weiteres Vorgehen zu beraten.“
Die Blicke der Fuhrleute hängen gespannt an seinen Lippen, über die besonderen Gründe für ihre mühevolle Reise wüssten sie gern mehr. Aber so beschwerlich die Wanderung auch sein mag – wie auch die Entscheidung, die Heimat zu verlassen, keinem leicht gefallen war –, so nehmen sie die Strapazen doch gerne auf sich, denn hier gelten sie was. Das war freilich zu Hause im Thüringischen anderes. Dort waren sie die Kleinsten der Kleinen, die Überzähligen. Die Äcker der Eltern vermochten sie nicht mehr zu ernähren und es bestand keinerlei Aussicht, ein eigenes Gut zu erwerben. Aber – und darum sind sie in die Wildnis aufgebrochen – hier sind sie die Erschaffer neuen Lebensraumes. Hier sind sie wer und niemand schaut voll Verachtung auf sie herab. „Ja, letztlich kommt uns der Unfall gar nicht ungelegen“, fährt Hildebrand fort, „denn wir müssen dringend den Zug neu ordnen.“
„Ja freilich, was dein Liebling auch anstellt“, gellt eine schrille Stimme aus der hinteren Reihe, „es ist immer zu unserem Vorteil. Wir hätten noch gut eine Weile fahren können und wären dann sicher aus diesem schaurigen Wald heraus!“ Beifallheischend schaut Heribert mit hochrotem Gesicht in die Runde. „Geheuer ist es hier nämlich nicht. Ganz gewiss wimmelt es von bösen Geistern. Vorhin am Hang haben mich grauenvolle Augen angestarrt, die waren halb so groß wie Wagenräder und ganz starr!“
„Halte doch dein verdammtes Maul, du Schisshase!“, wirft der Hüne Johannes ein. „Starrende Augen sind wohl immer starr, du Dummkopf. Warum bei allen Göttern hast du nicht gleich gesagt, dass wir beobachtet werden? – Wenn es überhaupt so ist!“ Die Männer stoßen sich untereinander an, denn Heribert ist in der Gemeinschaft der Pickel auf der Nase. Seinen geringen Wuchs versucht er beständig mit Streitsucht und Prahlerei auszugleichen.
„Lass gut sein“, wirft Hildebrand ein, „wir alle kennen Heribert. Er mag so manchen Mann reizen und das stört gewiss. Aber wir brauchen ihn, gerade jetzt!“ Die Worte lassen den Kleinen um eine Handbreite wachsen, das hat der Wichtigste unter ihnen gesagt, dass er – Heribert – gebraucht wird! Hildebrand holt tief Luft. „Auch ich habe die Augen gesehen, allerdings nicht so groß, und es war da noch ein Mann dran.“
Überraschung malt sich auf die Gesichter der Männer und so manche Hand greift zur Axt am Gürtel. „Ihr wisst, dass wir hier mit den Sorben rechnen müssen, denn wir sind in ihr Gebiet eingedrungen. Der Beobachter wird vielleicht ein Jäger gewesen sein. Trotzdem müssen wir unsere Aufmerksamkeit verstärken, denn es werden noch andere auf uns stoßen und wer weiß schon, ob wir bei allen willkommen sind!“
Heribert, der eben noch stolz dreinblickte, dreht nun furchtsam das Gesicht in alle Richtungen, als fürchte er den jähen Angriff wilder Horden. Unruhig rutscht sein Gesäß auf dem weichen Boden hin und her.
Hildebrand ruft ihn mit einem strengen Blick zur Ruhe und setzt fort: „Jetzt besteht noch keine Gefahr, denn der Fremde muss es erst seinen Leuten melden, aber Warnsignale hat es bisher nicht gegeben. Bis morgen werden wir wohl Ruhe haben. Aber ab sofort wird das Lager streng gesichert. Die Frauen und Kinder bleiben in der Wagenburg. Heribert wird ab dem Morgengrauen nicht mehr sein Gespann führen, sondern auf dem ersten Wagen als Beobachter mitfahren, er hat die schärfsten Augen. So Gott will erreichen wir schon morgen mit Sonnenuntergang unser Ziel. Wir werden bei den Höhlenbergen nicht die Ersten sein, denn aus unserem Volk haben sich dort bereits Soldaten festgesetzt. Ihnen bringen wir Verpflegung und Utensilien für den Winter. Wir werden dort bleiben und als Bauern im nächsten Jahr für die Beköstigung sorgen, damit unsere Krieger ihre Aufgaben erfüllen können, allenfalls werden wir selbst in den Krieg ziehen.“
Ungläubig schauen ihn die Fuhrleute an. Dass sie ein Wagnis eingegangen sind, als sie sich auf den Treck begaben, war ihnen immer bewusst, aber dass sie als friedliche Bauern einmal die Kriegsreserve bilden sollen, scheint ihnen ungeheuerlich.
„Soll das heißen, dass wir die Sorben erst verjagen müssen, um deren Höfe zu besetzen?! Ich bin Bauer und kein Krieger!“, empört sich der Rotschopf Georg und die anderen schmunzeln ob seines gütigen Selbstbildnisses, denn gerade Georg neigt gern zu Raufereien und vermag durchaus mehrere Männer in Bedrängnis zu bringen.
Hildebrand lacht leise und antwortet dem Empörten: „Die Sorben lassen wir hübsch in Frieden. Sie sind hier nur vereinzelt und lassen uns ausreichend Platz. Ihre Siedlungen liegen weiter im Norden. Doch haben sie einen großen Verdruss mit uns gemein. Denn jedes Jahr kommen die Panonier über die Berge. Niemand kennt ihre Wege durch den Urwald. Urplötzlich sind sie da, ziehen durch die Sorbengau und brennen unsere Heimat. Nun sind aus mehreren schwer zugänglichen Gegenden unsere Leute auf dem Weg, um diesen Teufeln auf ihren kleinen struppigen Pferden Fallen zu stellen und sie zu überwältigen. Wenn es gelingt, sie zu bezwingen oder in die Flucht zu schlagen, gewinnen wir dadurch gleichzeitig unser Siedlerland. Wenn alles gut geht, stehen wir bald besser da denn je.“
Die Männer nicken zustimmend. Obgleich sie noch keinen dieser Krieger aus dem Süden gesehen haben, ist ihnen doch schon so manche ihrer Gräueltaten im Saaleland zu Ohren gekommen. – Hildebrand trägt ihnen ruhig seinen weiteren Plan für die voraussichtlich letzte Etappe bis zum Ziel vor.
***
Über Nacht ist es kalt geworden. Als der Morgen anbricht, überzieht Raureif die Wiese mit den Wagen, die im Nebel nur undeutlich auszumachen sind. Die umstehenden Baumriesen wirken wie bizarre Gebilde, die eine scheinbar milchiggraue Unendlichkeit stützen. Kein Laut tönt über das leise Knistern des Feuers auf der Felsenplatte, dessen rötlichgelber Schein sich mühsam seinen Weg durch die Schwaden bahnt. Als wolle die Natur die Strapazen der Reisenden vor den Blicken Fremder verbergen, hat sie ein Wolkenband gnädig auf die Ruhenden gesenkt. In jeder Himmelsrichtung lehnt ein Wachposten am Wagen und starrt angestrengt in die trübe Dämmerung, mehr den Ohren als den Augen trauend, denn der Nebel lässt die seltsamsten Gebilde erscheinen. Endlich durchbricht das tiefe Brummen eines Ochsen die geisterhafte Stille und gleich darauf beherrscht ein reges Leben das Lager.
Die Frauen bereiten das Morgenmahl, die Kinder toben schon bald zwischen den Wagen herum. Die Männer, sofern nicht mit der Sicherung des Lagers betraut, entladen Rudolfs Wagen, um die zerschlagenen Räder zu wechseln. Rudolf selbst vermag mit seiner Verwundung die schweren Kisten und Säcke nicht zu bewegen und so ließ er sich von Hildebrand zur Wache einteilen.
„Dieses Wetter ist nur gut für böse Geister! Alles ist klamm, man sieht die Hand vor Augen nicht und draußen schart sich das Böse um uns!“, zetert Johanna und rumort mit dem irdenen Geschirr im Bach. „Und damit alles zusammenkommt, wird es bald aus Kübeln gießen!“ Ihre von der Kälte geröteten Hände ziehen den Krug so heftig durch das Wasser, dass er fast an die Steine schlägt.
Gerlinde steht neben ihr, sie schaut auf die Wütende herab und entgegnet spöttisch: „Du scheinst mir die rechte Wetterfee zu sein! Mit dem Nebel kennst du dich gut aus, he? Du wirst noch in deiner Rage den Krug zerschlagen und dann wird dich dein Gerhard schon Maß nehmen!“ Johanna zwingt sich, ihren Zorn zu mäßigen. Ein zerbrochener Krug wäre, wenn schon keine Katastrophe, so doch ein ziemliches Unglück. Wo bekäme man in der Wildnis hier einen neuen her? Ihr zappeliger Gerhard ist gewiss nicht der Mann, der töpfern kann. Gunhild hat beim Näherkommen die Kabbelei verfolgt, begütigend wirft sie ein:
„Der Nebel ist nicht das Schlechteste was uns widerfährt, er verbirgt uns vor neugierigen Blicken. Wenn ihr aber weiter schreit, weiß bald das gesamte Sorbenland, dass wir hier sind. – Warte nur, Johanna, hat sich der Nebel erst gehoben, werden wir den schönsten Sonnenschein bis zum Abend haben.“
„Was denn, noch ein Wetterprophet?“, mengt sich Else ein und schiebt sich zwischen die anderen. Die rundliche Frau tritt barfüßig und forsch in das eisige Wasser. Die Derbheit ihrer plumpen Füße, ihr fester Tritt und ihre Leibesfülle gestatten es ihr, der Strömung standzuhalten und ohne Mühe auf dem glitschigen Gestein einen festen Halt zu finden. „Was interessiert das Wetter? Ändern können wir es ohnehin nicht. Ich wasche mich lieber einmal richtig kalt und bin den ganzen Tag warm und gut durchblutet.“
„Und wir trinken dein Waschwasser, du Ferkel!“, ärgert sich Gunhild.
„Drei Schritte weiter kannst du gern ein Bad nehmen!“
„Lieber nicht“, Gerlinde kann sich die Boshaftigkeit nicht verkneifen, „dann steht ja gleich die ganze Aue unter Wasser.“
Sicher wäre es zu einem handfestem Streit zwischen den Frauen gekommen, wenn nicht just Hildebrands Stimme herübergedrungen wäre:
„Ihr könnt von mir aus noch bis heute Mittag hier herumtoben und ganze Bärenfamilien in die Flucht schlagen! Aber wenn nicht ganz schnell das Essen fertig ist, geht es mit leerem Magen weiter!“
Hastig kommt seine Frau herübergelaufen. Gerfriede behauptet unter den Frauen ihre Führungsrolle mühelos, was sicher auch von der Stellung ihres Mannes herrührt. Doch auch ihr hohes Alter, ihre Klugheit und ihr bestimmtes Auftreten verleihen ihr eine nicht zu übersehende Geltung. „Jetzt lasst das Gezänk, ihr Weibsbilder! Für Rangeleien ist keine Zeit, wir müssen uns beeilen!“ Diese Mahnung weckt schließlich ihre Vernunft und rasch gehen die Frauen an ihr Tagewerk. Wie sie es seit Beginn der Fahrt gewohnt sind, teilen sie sich in die Aufgaben, denn eine Haushaltung wie am festen Wohnsitz wäre viel zu aufwendig. Außerdem schweißen die gemeinsamen Erlebnisse die Familien trotz aller Unterschiede fest zusammen.
Als die ersten Sonnenstrahlen, ganz nach Elses Worten, zaghaft durch den Nebel finden, sind die Wagen beladen und die Ochsen stehen im Geschirr. Peitschenknallen und schallende Ho-ho-Rufe künden lautstark vom Aufbruch. Ein paar ältere Jungen und Mädels gehen der Kolonne voran und schlagen das störende Geäst von der Trasse, die von der Spur der Vorhut markiert wird.
Ein gutes Stück weiter, doch immer noch in Sichtweite, schreitet Reinhold voraus, die Befahrbarkeit des Bodens prüfend und die Sicherheit der Kolonne in Fahrtrichtung im Auge haltend. Sein Fuhrwerk hat er Ludwig, seinem ältesten Sohn anvertraut, der mit seinen sechzehn Jahren schon recht geschickt den Wagen zu führen weiß. Da das Tempo des Zuges von den trottenden Rindern bestimmt wird, fällt es Reinhold nicht schwer, die Trasse festzulegen und gleichzeitig das Umfeld gründlich auszuspähen. Doch ist der Wald zu dicht, als dass ein einzelnes Augenpaar alles überblicken könnte. Freilich wäre es zweckmäßiger, würden Späher im weiten Umkreis die Beobachtung übernehmen, aber dafür sind sie zu wenige Leute.
Hildebrand hat diese Sorge deutlich aufgezeigt, aber eine andere Lösung als die jetzige konnten sie nicht finden, schließlich sind sie kein Heerwurm, sondern Siedler auf dem Treck.
„Ohne Risiko kommen wir nicht weiter, wir müssen auf Gott vertrauen!“, hatte er seine Unterweisung beendet. Nur gut, dass die Halbwüchsigen die Fahrt als ein Abenteuer betrachten und entlang der Schneise mehr oder weniger aufmerksam spähen. Doch wenn die Kolonne wieder in den Wald eintaucht, ist die Beobachtung kaum noch möglich und es wird sehr auf das scharfe Auge von Heribert ankommen, der von seinem Gespann aus, das an zweiter Stelle rollt, die Schatten der riesigen Bäume mit seinem Adlerblick zu durchdringen vermag.
Am Schluss des Wagenbandes wachen der kleinwüchsige Matthias und seine nicht minder große Frau Sabina mit höchster Aufmerksamkeit. Beide sind keineswegs ängstlich und Hildebrand hatte keine Mühe, als er ihnen diesen besonders gefährdeten Platz zuwies. Reinhold stellt sich vor, wie verzwickt die Lage im Falle eines Angriffs von hinten für sie wäre. Die vorn können weiter vor oder zur Seite flüchten, aber das letzte Fahrzeug wird vom vorherfahrenden blockiert und seine Fuhrleute können nichts anderes tun, als sich dem Kampf zu stellen. Reinhold schrickt auf und ruft einen der Burschen herbei.
„Lauf hinter zu Meister Hildebrand. Er soll die Abstände zwischen den Fuhrwerken auf zwei bis drei Gespannlängen vergrößern lassen, damit sie bei Gefahr reagieren können!“ Der Junge flitzt los und kurz darauf bekunden die Rufe von Fahrzeug zu Fahrzeug, dass der Gedanke aufgegriffen wurde und umgesetzt wird.
Als die Sonne langsam sich ihrem niedrigen Zenit nähert, hat sich die Bachaue gleich einem Trichter so sehr verengt, dass gerade noch zwei Wagenbreiten das sprudelnde und gurgelnde Wasser von dem Pfad trennen, der mit seinen sumpfigen Grasnarben einen halsbrecherischen Saum bildet. Die Mäander zwingen die Ochsen, ihre schwere Last in häufigen Bögen einmal durch weichen Grund, dann wieder über scharfkantige Steine zu ziehen. Das weiße, kraftlose Sonnenlicht ringt mit den schweren Schatten der kahlen Eichen und malt auf den sich stetig wandelnden Boden ein wirres Muster aus Streifen und Linien. Selbst am hellerlichten Tage bereitet die schwarze Tiefe des Waldes den Reisenden Unbehagen, was durch das Krächzen der Rabenvögel noch verstärkt wird, wenn diese plötzlich scharenweise aufsteigen.
Besorgt schaut Rudolf zum Himmel. „Die Luft ist zu klar, kein Wölkchen ist zu sehen und außer dem Gekrächze ist kein Ton zu vernehmen. Das sieht mir sehr nach Frost und Schnee aus!“ Mühsam versucht er trotz seines straffen Verbands sich zur Seite zu beugen, um am vorausfahrenden Fahrzeug vorbeizuschauen. Ein stechender Schmerz in der Hüfte lässt ihn schnell wieder lotrecht und steif wie ein Wurfspieß sitzen.
„Ist wohl noch nichts mit Tanz und galanten Verbeugungen vor den Schönheiten, wie?“, kichert die alte Hildburga an seiner Seite. „Bleib nur ruhig sitzen, mein Jungchen. Um das Wetter muss dir nicht bange sein. Heute noch erreichen wir das alte Kastell auf dem Höhlenberg und werden es dort sicher schön warm haben.“
Überrascht blickt Rudolf in das runzlige Gesicht seiner Begleiterin. „Welches Kastell, Alte? Waren hier etwa auch die Römer mit ihren Heerlagern? Wieso willst du überhaupt davon wissen, wenn du noch nie hier gewesen bist?“
Ein überlegenes Lächeln erhellt ihre von zahllosen Erfahrungen gezeichneten Züge. Wie sollen die jungen Leute je ihre Ahnungen begreifen, wenn selbst Alte sich ihnen in Befangenheit des stumpfen Alltagsdenkens versperren? Zu sehr ist die Gewohnheit verbreitet, das Unerklärliche als unmöglich abzutun. „In meiner Familie wurde das Wissen immer weitergegeben. Meine Großmutter hat mir in meiner Kindheit schon von meiner Urgroßmutter erzählt, dass deren Vater als junger Krieger in den fernen Osten aufgebrochen war, um in der Wildnis des Waldgebirges den Sorben zu trotzen. Sie errichteten am Eingang eines riesigen Talkessels auf einem Bergsporn eine Burg, auf die sie sich zurückziehen konnten, wenn Gefahr drohte. Entlang eines Flüsschens hatten sie Felder im Tal angelegt. Im Berg gab es Höhlen, in denen sie die Ernte aufbewahrten. Es wird wohl ein halbes Menschenleben vergangen sein, ehe mein Vorfahr wieder heimgekehrt ist.“ Rudolf imponiert die Geschichte. Mutter Hildburga versteht es, fesselnd zu erzählen.
„Aber das ist so lange her. Warum hat dein Ahn nicht die Familie nachgeholt und das urbare Land erweitert?“ Die Alte schüttelt den Kopf.
„Die Zeit war noch nicht reif. Wer zieht schon in die Ferne, wenn zu Hause alles friedlich ist. Die Sorben siedelten sich weiter im Norden an. Nur wenige kamen zu den Unseren. Eine Besiedlung der Wildnis erschien unserem Volk nicht mehr sinnvoll. Als ein gewaltiges Hochwasser das Flüsschen zum reißenden Strom anschwellen ließ und die gesamte Erne verdarb, kehrten die Männer schließlich zurück.“
„Woher weißt du aber, dass wir in eben diese Gegend ziehen?“, fragt der junge Fuhrmann skeptisch. „Dass wir an jenen unheilvollen Ort reisen, wo aus einem mageren Bächlein plötzlich ein mächtiges Flutwasser wird?“
„Wirst es schon sehen, du Schlaubart. Unser Ziel sind doch die Höhlenberge, und wo hatten unsere Ahnen ihre Ernte gelagert? So viele Höhlenberge gibt es nicht. Und sie waren am Eingang eines riesigen Talkessels. Sieh doch, die Höhen wenden sich mehr und mehr gen Süden, vor uns liegt fast nur noch flaches Land.“
„Aber, Mutter Hildburga“, lacht Rudolf, „in einem Gewässerlauf – und sei es ein noch so mager – erhebt sich niemals ein Berg. Wenn du meinst, dass sich die Berge zurückziehen, können sie sich doch schon bald wieder unserem Pfad zuwenden. Nur verwehrt uns der Wald den Blick darauf.“
„Warten wir es ab, die Zukunft wird zeigen, wer im Recht ist.“ Die Alte ist sichtlich pikiert. „Man sollte durchaus auf die Geschichten, die am heimischen Herd erzählt werden, vertrauen, aber dafür habt ihr jungen Leute keinen Sinn! Nur was ihr greifen könnt, lasst ihr als wahr gelten. Ihr würdet gar den Wind leugnen, weil der nicht zu fassen ist.“
„Mütterchen“, lenkt Rudolf ein, „so war das nicht gemeint. Ich will dir die Geschichte glauben, aber wer sagt, dass wir am gleichen Wege sind?“
Gerade will Hildburga zu einer weiteren ihrer uralten Geschichten anheben, als von hinten die sich vor Panik überschlagende zitternde Stimme Heriberts an ihr Ohr dringt:
„Aufgepasst, da drüben am Bach sind sie!“ Ruckartig fliegen die Köpfe der Fuhrleute herum und stieren angestrengt in die angegebene Richtung. Aufgeregte Eltern beordern die spähenden Jungen an die Wagen. Doch keiner vermag das Objekt von Heriberts Erregung auszumachen. Besorgte Worte schwirren von Wagen zu Wagen und tragen doch zu keiner Beruhigung bei. Endlich entschließt sich Hildebrand, die Fahrt zu unterbrechen.
Während die Männer mit geschärften Sinnen, die Faust fest um den Axtstiel geschlossen, aufmerksam in den Wald starren und die Frauen mit den Kindern hastig unter den Planen verschwinden, eilt Hildebrand nach vorn zu Heribert, der noch immer todbleich und mit zitterigen Händen in das Dickicht weist.
„Da … da …“, stammelt er und kann kein klares Wort hervorbringen. Aus seinem Wagen dringt ein angstvolles Wimmern, das dem Mann erst recht die Knie schlottern lässt.
Nun verliert der Kolonnenführer die Geduld. Er fasst den Kittel des Stotternden, zieht ihn mit einem Ruck zu sich herunter und gleich darauf lässt eine schallende Ohrfeige den Stammelnden verstummen. Selbst Mathildes Greinen findet in einem langgezogenen „Iihh …“ sein Ende.
„Jetzt sag endlich, was du gesehen hast, du Jämmerling!“ Die kraftvolle Stimme steigert sich innerhalb dieser wenigen Worte zu einem wahren Donnern. Noch immer vor Angst schlotternd, jedoch vom jähen Angriff zur Bewegung befähigt, würgt der schmächtige Mann hervor:
„Da war er wieder, der weiße Riese mit den Glotzaugen. Dort zwischen den Bäumen stand er und hat zu uns herüber gesehen. Ihm zur Seite waren mindestens fünf Männer, die ihm gerade bis an die Hüfte reichten.“ Heribert blick scheu hinüber und fügt zögerlich hinzu: „Es werden noch mehr werden und dann machen sie uns den Garaus!“ Wie um seinen Worten Gewicht zu verleihen, lässt er seinen Finger bedeutungsvoll über die Kehle gleiten. Als Hildebrand finster die Brauen zusammenzieht und einen Knurrlaut ausstößt, zuckt der Feigling und versucht, dem festen Griff zu entkommen. Gleichzeitig erhebt sich wieder das kreischende Gejammer aus dem Wagenkasten.
„Jetzt ist es gut, schweigt!“ Ruhig und kaum hörbar, aber in seinem kalten Zischen umso bedrohlicher, herrscht der Anführer sie an. Heinrich, der ebenfalls herbeigeeilt ist, greift nach dem Arm des Wütenden. „Den änderst du nimmer. Seine Beine werden immer braun bekleckert sein. Ob dort nun jemand war oder nicht, jetzt weiß jedenfalls auf sieben Meilen jeder, dass wir hier sind!“ Der Ältere nickt bedauernd. „Ja, eine Überraschung sind wir nicht mehr, wenn wir es denn je waren. Doch wir müssen wissen, woran wir sind! Schau nach, ob du Spuren findest und nimm dir Theobald zur Sicherung mit!“
Eilig läuft der mittelgroße, etwas schlaksig-verwegene Mann los, um seinen älteren und bereits ergrauten Freund vom hinteren Teil des Trosses zu holen. Bald sieht man die beiden in das Unterholz des Waldes eintauchen. Geschickt winden sie sich, einander sichernd, durch das dichte Gestrüpp. Wäre nicht das unvermeidbare Rascheln des Laubes zu hören, man hätte sie glatt für Schattenhalten können. Mit geradezu geisterhafter Beweglichkeit nähern sie sich im großen Bogen dem beschriebenen Platz. Jetzt dauert es nur wenige Augenblicke, bis die Gefährten auf direktem Weg zurückkehren.
„Es sind tatsächlich Spuren im Laub zu sehen. Einer wird auf dem schräg liegenden Stamm gehockt haben und andere standen darum. Vielleicht so fünf Männer können es gewesen sein.“ Heinrich nickt seinem Freund zu.
„Theo versteht etwas vom Spurenlesen.“
Hildebrand will just sein Wort erheben, als von der Spitze der Kolonne ein schriller Pfiff sein Ohr erreicht. Die aneinander gereihten Tonhöhen verkünden eine Besonderheit am Weg, ohne auf Gefahr zu verweisen. Überrascht wenden die Männer ihre Blicke in Fahrtrichtung, vermögen jedoch nichts Ungewöhnliches zu erkennen.
Aus dem Schatten der Bäume löst sich die Gestalt eines Jungen, dessen nackte Waden eilig das frostblasse Gras teilen. Die Spuren der Vorhut missachtend, sucht der kleine Läufer die Bögen auszusparen und den kürzesten Weg zu nehmen. Die angewinkelten Arme schwingen im Takt seiner Schritte, das schulterlange zerzauste Haar flattert im Wind, sein Gesicht ist vor Kälte und Anstrengung gerötet. Als er auf Rufweite herangekommen ist, tönt seine Knabenstimme dünn herüber:
„Meister Hildebrand, komm schnell, da vorn ist …“, noch bevor er den Satz beenden kann, strauchelt er und ist im gleichen Augenblick in einer Senke verschwunden. Statt seiner stiebt ein grauer Schatten zur Seite, doch noch ehe ein Blick ihn klar erfassen kann, ist er wieder fort.
„Das war doch Bernhard!“, krächzt Heribert und hat mit einem Schlag all seine Angst vergessen. „Mein Sohn, was ist mit dir?“ Von Sorge getrieben, springt er vom Bock, eilt zu der Stelle, wo er den Jungen zuletzt gesehen hat. „Bernd!“, gellt sein Ruf ihm voraus. Wenn das ein Wolf gewesen ist oder eine anderes wildes Tier?!
Da erscheint wie herbeigezaubert zwischen den welken Gräsern das Knabengesicht. „Ist nichts passiert, Vater. Nur mein Knie blutet.“ Gleich darauf kommt der kleine Held humpelnd bei seinem Vater an, der ihm erleichtert den Arm um die Schulter legt und den Jungen an sich drückt.
„Mein Gott, Junge“, würgt er hervor, „jage uns nur nicht solche Schrecken ein!“ Wenngleich dem Halbwüchsigen die liebevolle Geste gut tut, ist sie ihm doch angesichts der Zuschauer recht peinlich. Sich straffend dreht er sich aus der väterlichen Umarmung.
„Ich bin doch nur in einen Karnickelbau getreten und im Fallen auf einen Ast aufgeschlagen. Es war gar nichts!“ Damit wendet er sich wieder seinem Ziel zu und erreicht gleich darauf mehr hinkend als gehend die Wartenden.
„Na, du Bote Hinkebein, was hast du mir zu melden?“ Hildebrand hütet sich, sich zu dem Jungen herunter zu beugen, das hätte diesen sicher in seinem Stolz verletzt, wo er doch gewiss von seinen Freunden beobachtet wird. Und tatsächlich erwidert Bernhard ernsthaft und gar nicht kindlich wirkend:
„Bei Reinhold sind fünf Fremde. Sie sprechen gar seltsam, aber er kann sie wohl verstehen. Er spricht mit ihnen, aber ich höre nur itschzitschkitsch. Er hat gesagt, dass das Sorben wären und dass von ihnen keine Gefahr ausginge. Du sollst zu ihm kommen, die Sorben hätten einen Vorschlag.“
Hildebrand hebt die Schultern und streicht sich über den Bart. „Und? Was meint ihr dazu?“, wendet er sich an Heinrich und Theobald. Die beiden schmunzeln zwar noch versteckt über den Kleinen, scheinen aber dennoch unsicher zu sein. Schließlich meint Theobald:
„Wenn Reinhold das sagt, kann man dem trauen. Er kennt das Volk der Sorben schon. Aber du solltest nicht allein unterwegs sein, sonst verlieren wir im unglücklichen Falle womöglich unsere erfahrensten Leute.“
Mechthilde, die inzwischen vom Wagen geklettert und zu ihrem Sohn getreten ist, mischt sich in das Gespräch der Männer:
„Nimm doch Johannes mit. So groß und kräftig wie der ist – der nimmt es mit zwanzig Sorben auf.“ Lachend stimmt Hildebrand zu und wendet sich an Bernhard, der immer noch ganz stolz neben seinem Vater steht:
„Ich denke, trotz deiner Verwundung kannst du immer noch unser flinker Bote sein, oder? Laufe also zum sechsten Wagen, Johannes soll kommen und seine Axt mitbringen. Lasst euch aber nicht von den Sorben sehen!“ Noch ehe er den Satz beendet hat, saust der kleine Blondschopf los wie Hermes der Götterbote.
„Von wem er das wohl hat? Der Bursche scheint weder Angst noch Schmerz zu kennen.“ Bedeutungsvoll nickt Hildebrand Heribert und Mechthild zu. Heribert entgeht die Anspielung auf seine Ängstlichkeit nicht.
„Vielleicht war ich auch einmal so?! Es gab den Jungen noch nicht, als wir damals kurz hintereinander erst in die Hände der Sachsen und dann in die der Franken fielen. Da kann man schon etwas von seinem Mut einbüßen“, murmelt er beschämt.
Hildburga steht plötzlich bei ihnen, sie mag diese Seitenhiebe nicht, die in der Gesellschaft gern gegen die Schwächen Einzelner geführt werden.
„Was müsst ihr immer nach dem Popel in der Nase der anderen suchen? Jeder hat seine guten und seine schlechten Seiten. Nur die guten Seiten aller machen uns stark, wenn wir sie richtig nutzen. Wenn wir die Mischung richtig vornehmen, spielen die Nachteile keine Rolle. Das ist wie beim Kräuteraufguss.“
„Ist ja gut, Alte“, wendet Theobald begütigend ein, „wir wollen ja gar nicht zanken. Aber den Kleinen loben wird man noch dürfen?“
„Ach, ihr Mannsbilder, doch nicht, indem ihr Vater und Mutter schmäht!“ Sie wendet den Männern den Rücken zu und schlurft zu ihrem Wagen zurück.
Hildebrand schmunzelt in seinen Bart.
„Das Weib ist schlau. Eine Schande, dass sie von den Schwarzkitteln gescholten wird. In einem hat sie besonders recht: Wir müssen die Stärken des Einzelnen nutzen.“
„Hast du mich deswegen rufen lassen?“, mischt sich unversehens eine brummige Stimme ein. Johannes baut sich in seiner Hünenstatur vor Hildebrand auf und lässt die Axt auf die Handfläche klatschen. Trotz des kühlen Wetters trägt er einen ärmellosen Kittel, sein protziges Muskelspiel imponiert den Männern gehörig.
„Wo steht die tausendjährige Eiche, die uns den Weg versperrt?“
Der Herkules muss der einzige Mann in der Kolonne sein, der nicht die Ursache des Stopps erkannt hat.
„Du hast wohl geschlafen, du Goliath?“, fährt ihn Heinrich an, den das Protzen des Dicktuers beträchtlich stört, da es sich doch immer wiederholt. „Wir sind auf die Sorben gestoßen!“
„Ha, die sollen nur kommen, denen schlage ich auf den Wanst, dass sie noch bis übermorgen laufen!“ Der Riese schaut selbstüberzeugt in die Runde.
„Keinen sollst du prügeln“, beendet Hildebrand die Kraftmeierei und lässt seine flache Hand derb auf den nackten Oberarm des großen Kerls sausen, „wir wollen jemandem vorführen, dass wir nicht unbewehrt sind. Deshalb wirst du jetzt mit mir gehen, aber immer fünf Schritte hinter mir bleiben, und auf gar keinen Fall auch nur ein Wort sagen. Ist das klar?“ Darauf dreht sich der Älteste um und stapft davon. Johannes hat zwar das Gesagte verstanden, nicht aber recht den Sinn begriffen. Da ihm das Denken ein wenig schwerfällt, zuckt er nur mit den Schultern und folgt in angewiesenem Abstand.