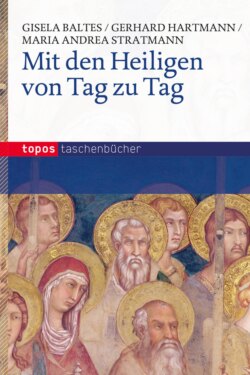Читать книгу Mit den Heiligen von Tag zu Tag - Gerhard Hartmann - Страница 8
Оглавление1. März
Suitbert (Swidbert) von Kaiserswerth
Suitbert (Swidbert) von Kaiserswerth (7. Jh.–713) wurde in England geboren und in York von Egbert von Irland ausgebildet. Mit zwölf Gefährten kam er 690 unter Willibrord [7. 11.] in das südliche Friesland, die ihn 692/693 zum Bischof bestimmten. Nach seiner Weihe durch Wilfrid von York begab er sich zur Mission in das Gebiet von Ruhr und Lippe. Als er dort von den Sachsen bedrängt wurde, gründete er 695 auf einer ihm von Pippin dem Mittleren geschenkten Rheininsel das Benediktinerkloster Swidbertswerth, das später in Kaiserswerth unbenannt wurde. Nach seinem Tod bildeten sich um den bald als heilig verehrten Suitbert zahlreiche Legenden. Seine Gebeine liegen in der Stiftskirche in Kaiserswerth. Der Gedenktag in den Bistümern Köln und Essen ist der 4. September. (H)
Felix II. (5. Jh.–492) – Albinus (Aubin) von Angers (um 496–554) – Rude-
sindus (Rosendo) von Dumio (von Celanova) (907–977) – Johanna Maria Bonomo (1608–1670)
2. März
Agnes von Böhmen
Agnes (tschech. Svatá [heilige] Anežka Česká) (wohl 1211–1282) wurde als Tochter des Königs von Böhmen Ottokar I. Přemysl und der Constanze von Ungarn geboren. Schon als Kind wurde sie aus politischen Gründen zweimal verlobt. Diese Verlobungen wurden jedoch jeweils gelöst, sodass sie sich einem asketischen Leben nach dem Vorbild von Franz von Assisi [4. 10.] und Klara von Assisi [11. 8.] verschrieben hatte. Ebenso war die hl. Elisabeth von Thüringen [19. 11.] für sie nacheifernswert. Als man sie erneut verheiraten wollte, wurde sie 1234 Klarissin. In der Folge setzte sie ihr Vermögen für die Errichtung von Kirchen und zur Unterstützung von Klöstern ein. Die „Kreuzherren mit dem roten Stern“ (Ordo Crucigorum cum rubea stella), ein genuin tschechischer Orden, wurden von ihr ebenfalls initiiert. Nach ihrem Tod soll es auf ihre Fürsprache hin bereits zu vielen Wundern gekommen sein. (H)
Karl von Flandern (um 1084–1127) – Angela de la Cruz (Maria de los Angeles) Guerrero Gonzalez (1846–1932)
3. März
Liberat Weiß
Johannes Laurentius Weiß (1675–1716) wurde in Konnersreuth geboren und trat 1693 in den Franziskanerorden ein, wo er den Ordensnamen Liberat annahm. 1698 erhielt er die Priesterweihe und war zuerst in der Seelsorge in Langenlois (Niederösterreich) und Graz tätig. Liberat Weiß beschloss 1703, in die Äthiopien-Mission zu gehen, um die Vereinigung der koptisch-äthiopischen Kirche mit der katholischen Kirche vorzubereiten. Nach einem gescheiterten Versuch gelangte er zusammen mit zwei Mitbrüdern erst 1712 nach Äthiopien. Dort erfuhren sie zuerst Unterstützung. Ein neuer König ließ die drei Franziskaner jedoch vor Gericht stellen. Dieses verurteilte sie zum Tod durch Steinigung. (H)
Theresia Eustochium Verzeri
Ignatia Eustochium Verzeri (1801–1852) wurde in Bergamo geboren. Als junges Mädchen trat sie in ein Benediktinerinnenkloster jeweils dreimal ein und dreimal aus (verur-
sacht durch epileptische Anfälle und Depressionen). Dabei nahm sie den Ordensnamen Theresia an. 1831 gründete sie dann in Bergamo die „Verzeri Suore“, die Kongregation der „Töchter des Heiligsten Herzen Jesu“. Diese machte sich die Erziehung junger Mädchen zur Aufgabe und hatte am Anfang viele Schwierigkeiten zu überwinden. Dabei bewies Theresia Eustochium Verzeri Geduld und Durchhaltevermögen. (H)
Camilla (5. Jh.–457) – Anselm von Nonàntola (8. Jh.–805) – Friedrich von Mariengaarde (12. Jh.–1175) – Petrus Renatus Rogue (1757–1796) – Innozenz von Berzo (1844–1890) – Katherine Maria Drexel (1858–1955)
4. März
Kasimir von Polen
Kasimir (1458–1484) ist der Schutzpatron Polens und Litauens. Er war ein Sohn des polnischen Königs Kasimir IV. und der Habsburgerin Elisabeth, einer Tochter König Albrechts II. 1471 wurde er von den ungarischen Adeligen zum König gewählt, konnte sich aber nicht gegen seinen Gegenkandidaten Matthias Corvinus durchsetzen. Von 1479–1483 führte er in Vertretung seines in Litauen weilenden Vaters in Polen dessen Regierungsgeschäfte. Schon bald achtete das Volk ihn wegen seiner Sittenstrenge und Gerechtigkeit. Kasimir war ein großer Marienverehrer. Da er Keuschheit gelobt hatte, lehnte er eine Heirat mit Kunigunde, der Tochter Kaiser Friedrichs III., ab. Er starb auf einer Reise nach Litauen an der Schwindsucht. (B)
Placida Viel
Viktoria Viel (1815–1877) wurde in Val Vacher/Quettehou (Normandie) geboren. In der Familie wurde sie mit ihren zehn Geschwistern zu Arbeit, Hilfsbereitschaft und tiefer Frömmigkeit erzogen. Mit 18 Jahren trat sie in die Ordensgemeinschaft „Arme Töchter der Barmherzigkeit“ (heute „Schwestern der hl. Maria Magdalena Postel“, SMMP) in Saint-Sauveur-le-Vicomte (Normandie) ein und erhielt den Ordensnamen Placida. Sehr früh schon wurden ihr, nach einer pädagogischen Ausbildung, die Leitung des Noviziates und die Aufgaben einer ersten Assistentin anvertraut. Nach dem Tod von Maria Magdalena Postel [17. 7.] 1846 wurde Placida mit 31 Jahren zu ihrer Nachfolgerin im Amt der Generaloberin gewählt. Als vier deutsche Lehrerinnen Anschluss an eine religiöse Gemeinschaft suchten, wurde 1862 die erste deutsche Niederlassung in Heilbad Heiligenstadt (Thüringen) gegründet. Ungeachtet der politischen Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich, sorgte Placida Viel in gleicher Weise für ihre Schwestern auf beiden Seiten. Mit ihrer vorurteilsfreien Güte wirkte sie dem Hass entgegen, der die Völker trennte. Verehrt und geliebt als Mutter der Armen und Kranken, starb Placida Viel in Saint-Sauveur-le-Vicomte. (S)
David (AT) – Basin von Trier (7. Jh.–um 705) – Humbert (Umberto) III. von Savoyen (um 1126–1189)
5. März
Lucius I.
Über das Leben von Lucius I. (3. Jh.–254) ist nicht viel bekannt. Seine Wahl zum Bischof von Rom wird mit 25. Juni 253 angegeben. Vorher war er unter der Verfolgung von Kaiser Trebonianus Gallus verbannt und durfte nach dessen Tod wieder nach Rom zurückkehren. Ein Brief von Cyprian von Karthago an ihn ist erhalten geblieben. In der Bußpraxis vertrat er die Linie seines Vorgängers Cornelius [16. 9.]. (H)
Jeremia(s) (AT) – Oliv(i)a von Brescia (2. Jh.) – Theophilos von Cäsarea (2. Jh.–195) – Phokas der Gärtner (3. Jh.–305) – Gerasimos vom Jordan (5. Jh.–475) – Meinwerk von Paderborn (um 970–1036) – Jeremias von der Walachei (Johannes Kostist) (1556–1625) – Joseph vom Kreuz (Carolo Gaetano) Calosirto (1654–1734)
6. März
Fridolin von Säckingen
Fridolin (5. Jh.–538?) stammte nach der von dem Säckinger Mönch Balther um 1000 verfassten legendenhaften Lebensgeschichte aus Irland. Von dort soll er als missionierender Wandermönch nach Gallien gekommen sein. In Poitiers fand er das Grab und die Kirche des von ihm verehrten hl. Hilarius [13. 1.] zerstört vor. Er bestattete die unter dem Schutt gefundenen Gebeine des Heiligen und erbaute darüber eine neue Hilariuskirche und ein Kloster, dessen Abt er wurde. Er zog weiter in den alemannischen Raum und baute dort Klöster und Kirchen zu Ehren des hl. Hilarius. Der Legende nach soll ihn der hl. Hilarius im Traum dazu veranlasst haben, das Hilarius-Kloster auf der Rheininsel Säckingen zu bauen, wo Fridolin später bestattet wurde. Er ist Patron des Kanton Glarus und der Schneider. (B)
Quiriacus von Trier (3. Jh.–4. Jh.) – Julianus von Toledo (um 652–690) – Chrodegang von Metz (8. Jh.–766) – Rosa von Viterbo (1233–1252) – Coleta (Nicolette) Boillet (1381–1447)
7. März
Perpetua und Felizitas
Perpetua und Felizitas (2. Jh.–202/203) gehören zu den ältesten zuverlässig bekundeten Blutzeugen. Perpetua stammte aus einer vornehmen Familie, Felizitas war ihre Sklavin. Beide bereiteten sich auf die Taufe vor und wurden deshalb verhaftet: Perpetua mit ihrem kleinen Sohn, Felizitas hochschwanger. Sie empfingen im Kerker die Taufe und ließen sich weder durch Gewalt noch durch Überredung vom Glauben abbringen. Kaiser Septimius Severus ließ sie schließlich mit weiteren Christen wilden Tieren vorwerfen. Sie wurden schwer verletzt und schließlich mit einem Dolch getötet. Bis zur Liturgiereform von 1969/70 war der 6. März ihr Gedenktag. (B)
Volker (11. Jh.–1135) – Teresia Margareta vom Heiligen Herzen Jesu (Anna Maria) Redi (1747–1770)
8. März
Johannes von Gott
Johannes (1495–1550) trug zur Reformierung der Krankenpflege bei. Bemerkenswert waren insbesondere seine Behandlungsmethoden für psychisch kranke Menschen, mit denen er seiner Zeit weit voraus war. Johannes wurde in Portugal geboren. Als Achtjähriger lief er von zu Hause fort (möglicherweise wurde er auch entführt) und lernte bei einem Hirten lesen und schreiben. Da sein Familienname unbekannt war, nannte man ihn „Johannes von Gott“. Sein weiteres Leben war sehr bewegt, bevor eine Predigt des
hl. Johannes von Ávila [10. 5.] eine grundlegende Änderung auslöste. Von nun an widmete er sich mit großer Hingabe der Krankenpflege. 1540 gründete er in Granada ein Krankenhaus. Viele junge Leute schlossen sich ihm an. Daraus entstand der Orden der „Barmherzigen Brüder“ (Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo). Er ist Patron der Krankenhäuser. (B)
Bermund (Veremundus) (11. Jh.) – Stephan (Étienne) von Aubazine (11. Jh.–1159) – Gerhard von Clairvaux (12. Jh.–1177) – Vinzenz (Wincenty) Kadłubek von Krakau (um 1150–1223)
9. März
Bruno von Querfurt
Bruno (um 974–1009) stammte aus einem sächsischen Adelsgeschlecht und wurde an der Domschule von Magdeburg erzogen. Als Hofkaplan begleitete er Kaiser Otto III. nach Rom. Dort trat er in ein Kloster ein und legte 999 die Mönchsgelübde ab. Später ging er mit Abt Romuald [19. 6.] in eine Einsiedelei bei Ravenna. 1002 betraute ihn Papst Silvester II. mit der Mission im Osten. 1004 wurde er zum Missionsbischof ernannt. Er missionierte in verschiedenen Gebieten des Ostens, besonders in Polen. Anfang 1009 wurde er mit 18 Gefährten auf einer seiner Reisen im heidnischen Preußen gefangen genommen und enthauptet. (B)
Franziska von Rom
Franziska (1384–1440) war eine fromme, mystisch begabte Frau. Sie stammte aus einer römischen Adelsfamilie. Schon als Kind wäre sie gern ins Kloster gegangen. Doch ihr Vater vermählte sie mit elf (oder zwölf) Jahren mit dem Römer Lorenzo de Ponziani. Aus dieser glücklichen Ehe, die vierzig Jahre dauerte, gingen sechs Kinder hervor. Neben ihren häuslichen Aufgaben kümmerte sie sich aufopferungsvoll um Arme und Kranke. 1425 gründete sie eine Vereinigung der „Benediktineroblatinnen“, deren Mitglieder sich zu einem gemeinsamen Leben im Dienst am Nächsten zusammenschlossen. Nach dem Tode ihres Mannes (1436) trat Franziska in diesen von ihr gegründeten Orden ein und übernahm bald dessen Leitung. (B)
Die vierzig Märtyrer von Sebaste (3./4. Jh.–320) – Katharina von Bologna (1413–1463) – Dominikus Savio (1842–1857)
10. März
Johannes Ogilvie
Johannes (John) Ogilvie (um 1580–1615) wurde in Schottland als Sohn eines Calvinisten geboren, der Hofbeamter bei Maria Stuart war. Er konvertierte mit 17 Jahren, studierte in Olmütz und trat 1599 den Jesuiten bei. Danach hielt er sich zehn Jahre in Wien und Graz auf. 1610 wurde er in Rom zum Priester geweiht und konnte ein Jahr später heimlich in seine Heimat Schottland zurückkehren. Dort gab er Unterricht und besuchte gefangene Katholiken. 1614 wurde er verraten und verhaftet. Im Gefängnis wurde er gefoltert. Darüber verfasste er einen Bericht, den er herausschmuggeln konnte. Johannes Ogilvie lehnte es standhaft ab, dem katholischen Glauben abzuschwören, sodass er zum Tode verurteilt wurde. In Glasgow wurde er öffentlich erhängt. (H)
Makarios I. von Jerusalem (3. Jh.–334) – Simplicius von Rom (5. Jh.–483) – Johannes de Cellis (um 1310–um 1396) – Maria Eugenia von Jesus (Marie-Eugénie Milleret de Brou) (1817–1898)
11. März
Johannes Baptista Righi
Johannes Baptista Righi (1469–1539) wurde in Fabriano (nahe Ancona) als Sohn einer adeligen Familie geboren. Bereits in jungen Jahren entsagte er dem weltlichen Leben, wurde mit 15 Jahren zum Priester geweiht und trat in den Franziskanerorden ein. Doch befriedigte ihn nicht das Klosterleben, sodass er in einer Höhle in der Nähe von Cupramontana bei Ancona als Einsiedler lebte. Dort wirkte er auch als Seelsorger und pflegte Kranke. Nach seinem Tod sollen auf seine Fürsprache hin Wunder geschehen sein, sodass er bald verehrt wurde. Seine Einsiedelei wurde später ein Kloster und ist heute ein internationales Zentrum für kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen. (H)
Rosina (Rosamunde) vom Allgäu (?) – Sophronius I. von Jerusalem (um 550–638) – Eulogius von Córdoba (?–859)
12. März
Innozenz I.
Innozenz (4. Jh.–417) soll der Sohn seines Vorgängers Anastasius I. gewesen sein und wurde 401 zum Bischof von Rom gewählt. Er zählt zu den markantesten frühen Papstgestalten und versuchte teilweise mit Erfolg, die Vorrangstellung des Bischofs von Rom auszubauen. So verlangte er, dass alle wichtigen Fälle vor den römischen Stuhl gebracht werden müssen. Den britannischen Asketen Pelagius, der der Meinung war, der Mensch könne aus sich heraus sein Heil erlangen, exkommunizierte er. Vergeblich versuchte er 403, die Absetzung von Chrysostomus [13. 9.] als Patriarch von Konstantinopel durch den oströmischen Kaiser zu verhindern. Ebenso gelang es ihm 410 nicht, die Plünderung Roms durch den Westgoten-König Alarich I. abzuwenden. Der ursprüngliche Gedenktag war der 28. Juli, der jetzige ist sein Todestag. (H)
Maximilian (3. Jh.–295) – Petrus Diaconus (6. Jh.–um 605) – Almut (10./11. Jh.) – Fina (1238–1253) – Angela (Aniela) Salawa (1881–1922) – Luigi (Aloisius) Orione (1872–1940)
13. März
Leander von Sevilla
Leander (um 540–600) wurde als Sohn einer römischen Familie im damals byzantinischen Cartagena (Südspanien) geboren und war der ältere Bruder des Isidor von Sevilla [4. 4.]. Er trat in Sevilla in ein Kloster ein und übte großen Einfluss auf den westgotischen Königssohn Hermengild aus. Als dieser von Leander getauft wurde, hat ihn der König 581 außer Landes gewiesen. Er hielt sich in Konstantinopel auf und konnte 583 zurückkehren. Bereits 584 wurde er zum Erzbischof von Sevilla gewählt. In seiner Amtszeit gelang es ihm, viele Westgoten zum Christentum zu bekehren und den Arianismus zurückzudrängen. Er verfasste u. a. eine Nonnenregel in 21 Kapiteln. (H)
Gerald von Mayo (um 642–732) – Guntmar (Gummar) von Nivesdonck (um 710–um 775) – Roderich (9. Jh.–857)
14. März
Mathilde
Mathilde (um 895–968) war mit dem späteren König Heinrich I. (876-936) vermählt. Aus dieser Ehe gingen fünf Kinder hervor, darunter der spätere Kaiser Otto I. und Bruno, der Erzbischof von Köln wurde. Mathilde war ebenso fromm und demütig wie weltoffen und klug. Ihr Leben war ausgefüllt mit Werken tätiger Nächstenliebe. Auf ihre Stiftung gehen die Klöster Pölde, Engern, Nordhausen und Quedlinburg zurück, wo sie starb und begraben wurde. (B)
Leobin von Chartres (6. Jh.–557) – Einhard (um 770–840) – Pauline von Thüringen (11. Jh.–1107) – Eva von Lüttich (um 1190–1265)
15. März
Louise de Marillac
Louise de Marillac (1591–1660) wurde in Paris geboren und war zuerst verheiratet. Nach zwölf Jahren Ehe starb ihr Mann, und sie lernte als Witwe Vinzenz von Paul [27. 9.] kennen, der sie stark beeinflusste. Durch ihn wurde ihr der Weg zu einem karitativen Leben gewiesen. Zusammen mit ihm gründete sie 1633 in Paris die Kongregation der Barmherzigen Schwestern (Vinzentinerinnen, Filiae caritatis), die heute eine der größten religiösen Frauengemeinschaften ist. Louise de Marillac stand der Kongregation 27 Jahre lang in aufopfernder und zeitaufreibender Tätigkeit im Dienste des Nächsten vor. (H)
Klemens Maria Hofbauer
Klemens Maria Hofbauer (1751–1820) war einer der ersten deutschsprachigen Redemptoristen. Er wuchs in armen Verhältnissen auf und arbeitete zunächst als Bäckergeselle. Erst spät ließ sich sein Wunsch, Priester zu werden, durch die Unterstützung großzügiger Menschen verwirklichen. Nach seinem Eintritt ins Kloster und seiner Weihe (1785) schickten ihn die Redemptoristen als Seelsorger für die deutsche Bevölkerung nach Warschau. Dort betreute er insbesondere streunende und verwaiste Kinder und richtete für sie eine Armenschule ein. 1808 wurde er aus Warschau vertrieben. Sein neuer Wirkungskreis war nun Wien, wo er sich als Seelsorger aller Bevölkerungskreise, Künstler und Gelehrter („Hofbauer-Kreis“) ebenso wie sehr einfacher Menschen, vor allem der Armen, bewährte. Er bemühte sich besonders um die Individualseelsorge und führte Hausbesuche als neue Form der Seelsorge ein. Er ist der Patron Wiens. Sein langjähriges Wirken dort trug ihm den Beinamen „Apostel von Wien“ ein. (B)
Zacharias von Rom (7. Jh.–752) – Lukretia (Leocritia) (?–859)
16. März
Heribert von Köln
Heribert von Köln (970–1021) wurde in Worms als Sohn eines Grafen geboren und wurde bereits 994 für Kaiser Otto III. Kanzler für Italien, 998 dann für Deutschland. Bereits im Jahr 995 zum Priester geweiht, wurde er 999 durch entsprechenden Einfluss seines Freundes Otto III. zum Erzbischof von Köln gewählt. Als der Kaiser 1002 in Italien starb, brachte Heribert den Leichnam sowie die Reichsinsignien nach Aachen. Das Verhältnis zum nachfolgenden Kaiser Heinrich II. war nicht so gut. Obwohl Heribert aus politischem Kalkül Erzbischof wurde, wird von ihm berichtet, dass er von besonderer Frömmigkeit gewesen war und Klöster und kirchliche Einrichtungen unterstützte. Auf ihn geht die Heribert-Kirche in Köln-Deutz zurück, wo er seine Ruhestätte fand. Im Erzbistum Köln ist sein Gedenktag der 30. August, der Tag der feierlichen Erhebung seiner Gebeine. (H)
Hilarius von Aquileja (3. Jh.–284) – Julian von Tarsus (3. Jh.–305/11)
17. März
Patrick
Patrick oder Patricius (385–461), der Glaubensbote und Nationalheilige Irlands, wuchs im römischen Britannien als Sohn eines christlichen Beamten der römischen Besatzungsmacht auf. Mit 16 Jahren wurde er nach Irland verschleppt, als Sklave verkauft und musste dort als Hirte dienen. Während dieser schweren Zeit festigte sich sein Glaube. Nach sechs Jahren gelang ihm die Flucht. 432 jedoch kehrte er als Priester und Missionar nach Irland zurück, wo er Nachfolger des ersten Iren-Bischofs Palladius wurde. Bei seiner schweren Aufgabe half ihm der Umstand, dass er während seiner Gefangenschaft die dortige Sprache erlernt hatte. Außerdem sollen seine Predigten sehr anschaulich gewesen sein. So soll er z. B. die Dreifaltigkeit anhand eines dreiblättrigen Kleeblatts, des späteren Symbols Irlands, erklärt haben. All das hat wohl dazu beigetragen, dass seine Verkündigung bei den Iren auf fruchtbaren Boden fiel und zu einer tiefen Verwurzelung führte. (B)
Gertrud von Nivelles
Gertrud (626–659) war Tochter Pippins des Älteren und der hl. Iduberga (Ida). Mit 14 Jahren trat sie in das von ihrer Mutter gestiftete Kloster Nivelles (südlich von Brüssel) ein und wurde dort nach dem Tode der Mutter (652) zur Äbtissin gewählt. Die hochgebildete und belesene Frau war eine hervorragende Kennerin der Bibel und zeigte besonderes Interesse für die Liturgie. Eines ihrer vornehmlichen Anliegen war die Bildung der weiblichen Jugend. Daneben kümmerte sie sich mit großem Eifer um Arme, Kranke und Sterbende, Witwen, Pilger und Gefangene. Sie starb – erschöpft und ausgebrannt – schon im Alter von 33 Jahren. (B)
Josef von Arimathäa (1. Jh.) – Konrad von Bayern (um 1105–1154/55) – Johannes Sarkander (1576–1620)
18. März
Cyrill von Jerusalem
Cyrill (um 313–386/387) war ein bedeutender Kirchenlehrer des 4. Jhs. Er wuchs als Sohn christlicher Eltern in Jerusalem auf und wurde um 348/350 Bischof von Jerusalem. Gegen den Arianismus trat er entschieden für das Bekenntnis zur wahren Gottheit Christi ein. Aus diesem Grund mehrfach verbannt, verbrachte er fast die Hälfte seines Episkopats im Exil. Auf dem 1. Konzil von Konstantinopel (381) wurde er endgültig rehabilitiert. Von Cyrill sind 24 große Ansprachen überliefert, in denen er Taufbewerber in die Grundwahrheiten des christlichen Glaubens einführte. Diese Katechesen gehören zu den wichtigsten frühchristlichen Zeugnissen über Taufe und Eucharistie. Dabei gebrauchte er wohl als Erster den Begriff „Wandlung“. 1883 wurde Cyrill von Papst Leo XIII. zum Kirchenlehrer ernannt. (B)
Martha Le Bouteiller
Aimée-Adèle (1816–1883) wurde in La Henrière (Normandie) als drittes von fünf Kindern der Weberfamilie Le Bouteiller geboren. In ihrer Schulzeit erhielt sie eine gute persönliche und geistliche Prägung. Durch jährliche Wallfahrten nach La-Chapelle-sur-Vire lernte sie die dort tätigen Schwestern der hl. Maria Magdalena Postel [17. 7.] aus Saint-Sauveur-le-Vicomte kennen und trat 1841 dort ein. Sie erhielt den Namen Schwester Martha. In ihren vielfältigen Aufgaben verwirklichte sie einfach und liebenswürdig das Ideal der Gemeinschaft, die empfangene Barmherzigkeit Gottes weiterzugeben. Ihr intensives Gebetsleben und ihr lebendiger Kontakt zu den ihr anvertrauten Menschen befähigten sie zu einer guten und verständnisvollen Ratgeberin für viele. (S)
Alexander von Kappadokien (?–251) – Narcissus und Felix von Gerona (3. Jh.–307) – Frigidian (Frigdianus) von Lucca (6. Jh.–588) – Eduard von England (963–978) – Anselm II. von Lucca (um 1035–1086) – Salvator von Horta (1520–1567)
19. März
Josef
Über den hl. Josef berichten die Kindheitsgeschichten bei Lukas und Matthäus jeweils in den ersten beiden Kapiteln. Danach war er der Bräutigam Marias und stammte aus dem Geschlecht Davids. Nach Matthäus (1,16) war er Sohn eines Jakob, nach Lukas (3,23) Sohn eines Eli. Den beiden Verfassern kam es vermutlich hauptsächlich darauf an, dass Josef als gesetzlicher Vater Jesu ein direkter Nachkomme Davids war. Nach der Überlieferung lebte er als Zimmermann in Nazaret und war mit Maria, der Mutter Jesu, verlobt. Matthäus erzählt, dass Josef an entscheidenden Wenden seines Lebens Gottes Weisung im Traum erfuhr und treu befolgte. Er war bei der Geburt Jesu zugegen und floh mit dem Kind und seiner Mutter wegen der Bedrohung durch König Herodes nach Ägypten, um nach dessen Tod zurückzukehren und sich in Nazaret niederzulassen. Nach dem Bericht über die Wallfahrt des zwölfjährigen Jesus mit seinen Eltern zum Tempel nach Jerusalem schweigt die Bibel über das weitere Leben Josefs. Er gilt als der Gerechte, der treu den erkannten Willen Gottes erfüllt und so die Pflichten des Pflegevaters für Jesus übernimmt. Darüber hinaus bleibt seine Gestalt weitgehend im Dunkeln. Die Verehrung des hl. Josef erfolgte im Osten früher als im Westen. Im
12. Jh. taucht erstmals der 19. März als Datum seines Festtages auf. In Österreich war dieser Tag in den Bundesländern Steiermark und Kärnten bis 1938, in Bayern sogar bis 1968 gesetzlicher Feiertag. 1870 ernannte Papst Pius IX. [7. 2.] ihn zum Schutzpatron der gesamten Kirche. Aus diesem Grund gab es bis zur Liturgiereform 1969/70 am dritten Mittwoch nach Ostern das „Hochfest des hl. Joseph“. (S)
Marcel Callo
Marcel Callo (1921–1945), ein katholischer Jugendarbeiter und Gegner des Nationalsozialismus, wird als „Märtyrer der Arbeiterjugend“ verehrt. Er wuchs in Frankreich in einer kinderreichen, sehr religiösen katholischen Arbeiterfamilie auf. Schon früh war er als Ministrant und Pfadfinder aktiv. Mit 13 Jahren trat er der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) Frankreichs bei, wo er bald eigene Jugendgruppen leitete. In dieser Zeit begann er eine Buchdruckerlehre. Nach der Besetzung Frankreichs durch die Deutschen half er vielen Menschen, in den unbesetzten Teil Frankreichs zu fliehen. Im März 1943 wurde er als Fremdarbeiter nach Deutschland deportiert und verzichtete darauf zu fliehen, um seine Leidensgenossen zu unterstützen. Im Arbeitslager Zella-Mehlis (Thüringen) setzte man ihn als Zwangsarbeiter in einer Waffenfabrik ein. Dort gründete er mit jungen Leuten eine Gruppe der Katholischen Aktion, feierte mit ihnen Gottesdienste und betätigte sich als Chorleiter und Krankenpfleger. Aufgrund seines religiösen Engagements wurde er von der Gestapo verhaftet und nach einem Gefängnisaufenthalt in Gotha ins KZ Mauthausen gebracht. Dort starb er an den Folgen von Entbehrungen und schwerster Arbeit. (B)
Isnard von Chiampo (12. Jh.–1244) – Sibyllina (Sibylle) Biscossi (1287– 1367) – Marcus von Montegallo (15. Jh.–1496)
20. März
Baptista Mantuanus
Baptista Mantuanus (1448–1516) wurde in Mantua geboren und trug den bürgerlichen Namen Spagnoli. Bereits mit 16 Jahren trat er in den Karmeliterorden ein. Zwischen 1483 und 1513 war er sechsmal Ordensvikar und 1513 kurz Ordensgeneral. Baptista Mantuanus trat als Verfasser von rund 55.000 lateinischen Versen hervor und wurde oftmals mit dem ebenfalls aus Mantua stammenden Vergil verglichen. Er gilt als Vertreter eines katholischen Humanismus und war auch mit Erasmus von Rotterdam sowie mit Pico della Mirandola befreundet. (H)
Claudia (3. Jh.) – Martinus von Braga (515–580) – Cuthbert (Gisbert) von Lindisfarne (um 620–687) – Wulfram (7. Jh.–720) – Joseph Bilczewski (1860–1923)
21. März
Richeza
Richeza (um 1000–1063) war die Tochter eines Pfalzgrafen von Lothringen und ehelichte 1013 den polnischen König Miesko II. In Polen förderte sie das dort noch junge Christentum. Nach dem Tod ihres Mannes 1034 kehrte sie in ihre Heimat zurück, wo sie sich karitativ und stifterisch betätigte. So gründete sie im Jahr 1048 die westlich von Köln gelegene Abtei Brauweiler. Ihre Reliquien befinden sich im Kölner Dom. Sie wurde und wird im Raum Köln und in linksrheinischen Gebieten als Heilige verehrt. (H)
Serapion der Scholastiker (von Thmuis) (um 300–370) – Absalon (Axel) von Lund (1128–1201)
22. März
Clemens August Graf von Galen
Clemens August Graf von Galen (1878–1946) entstammte einem westfälischen Adelsgeschlecht und wurde auf Burg Dinklage bei Vechta (Oldenburger Münsterland) geboren. Nach dem Abitur 1897 studierte er zuerst Philosophie, Geschichte und Literatur in Freiburg/Schweiz, um sich dann 1898 für den Priesterberuf zu entscheiden. Er absolvierte das Theologiestudium in Münster und empfing dort 1904 die Priesterweihe. 1906 wechselte er im Rahmen einer Unterstützung des Bistums Münster als Pfarrseelsorger nach Berlin, wo er auch den Nuntius Eugenio Pacelli, den späteren Papst Pius XII., kennenlernte. 1929 wurde er zum Pfarrer von St. Lamberti in Münster berufen. Als 1933 die Wahl des Bischofs von Münster anstand, wurde Galen zwar auf die Vorschlagsliste gesetzt, stand aber dann nicht auf der Dreierliste für die Wahl des Domkapitels. Erst als zwei von dieser Liste auf ihre Kandidatur verzichteten, ergänzte Rom mit Galen die Liste. Galen wurde nun als Bischof zu einem Gegner des Nationalsozialismus. In seinen Osterhirtenbriefen der Jahre 1934 und 1935 sowie in seiner Xantener Predigt von 1936 übte er massive Kritik an der NS-Ideologie. An der Textierung der Enzyklika Mit brennender Sorge, die am Palmsonntag 1937 veröffentlicht wurde, arbeitete er wesentlich mit. Auch international bekannt wurde er im Juli/August 1941 mit seinen drei in Münster gehaltenen Predigten, wo er die Klosteraufhebungen und vor allem die Euthanasie scharf kritisierte, die nicht zuletzt deshalb eingestellt wurde. Galen rechnete fest damit, wegen seiner Äußerungen spätestens nach dem „Endsieg“ verhaftet zu werden. Wegen seiner konsequenten Haltung gegenüber dem NS-Regime wurde er am 18. Februar 1946 zum Kardinal kreiert. Etwas mehr als einen Monat später starb er an einem zu spät erkannten Blinddarmdurchbruch. (H)
Lea von Rom (4. Jh.–384) – Benvenuto Scotivoli (von Osimo) (13. Jh.–1282)
23. März
Toribio von Mongrovejo
Toribio von Mongrovejo (1538–1606) ist der Patron von Peru und Lima und war einer der bedeutendsten Kirchenführer Südamerikas. Er studierte Theologie mit dem Schwerpunkt Kirchenrecht und promovierte in Salamanca zum Doktor der Rechte. Von Ende 1573 bis 1580 war er Inquisitor in Granada. 1579/80 wurde er zum Erzbischof von Lima ernannt. Zuvor empfing er die niederen Weihen, die Priester- und die Bischofsweihe. In seiner 26-jährigen Amtszeit als Erzbischof von Lima arbeitete er unermüdlich an der Reorganisation seiner großen Diözese. Er ließ Kirchen und Schulen bauen und gründete Sozialeinrichtungen. Seine besondere Sorge galt der Mission bei den Indianern. Zur Hebung des religiösen und sittlichen Lebens von Klerus und Volk unternahm er ausgedehnte Visitationsreisen und musste dabei gegen große Widerstände ankämpfen. Unter seiner Führung fanden 13 Synoden und drei Konzilien statt. Besondere Bedeutung kam dem Provinzialkonzil von Lima zu (1582/83), das zur geistlichen Grundlage der süd-
amerikanischen Kirche wurde. (B)
Walter (Gualterius) von Rebais (von Pontoise) (um 1030–1095) – Merbod von Bregenz (11. Jh.–1120) – Joseph (José) Oriol (1650–1702) – Rebekka Ar Rayés (1832–1914)
24. März
Katharina von Schweden
Katharina von Schweden (1331–1381) war die Tochter der hl. Birgitta [23. 7.], ihr Geburtsort in Schweden ist nicht überliefert. Bereits mit 14 wurde sie verheiratet, doch die beiden Eheleute gelobten Enthaltsamkeit. Nachdem ihr Ehemann nach sechs Jahren verstorben war, blieb sie bei ihrer Mutter. Nach deren Tod 1373 wurde Katharina Äbtissin des von Birgitta gegründeten Klosters in Vadstena. Im Jahr 1378 wurde der von ihrer Mutter begründete Birgitten-Orden von Rom bestätigt. Katharina wurde in Vadstena beigesetzt. (H)
25. März
Verkündigung des Herrn – Mariä Verkündigung
Das Fest der Verkündigung des Herrn (In Annuntiatione B. M. V.) bezieht sich auf die Ankündigung der Geburt Jesu an Maria durch den Erzengel Gabriel (Lk 1,26–38). Im Laufe der Zeit hat dieses Fest verschiedene Namen gehabt, die es teils als Marienfest (Mariä Verkündigung), teils – so auch heute – als Herrenfest kennzeichnen: Verkündigung des Herrn (anuntiatio Domini). Im Mittelpunkt steht die Menschwerdung Jesu aus Maria. Durch ihre Antwort auf die Engelsbotschaft: fiat mihi, „mir geschehe“ nach deinem Wort, stellt sie sich ganz dem göttlichen Willen zur Verfügung. Mit dem Datum des 25. März, neun Monate vor Weihnachten, ist dieses Fest in der Ostkirche seit dem 5. Jh. bezeugt, im Westen seit dem 7. Jh. Aus dem lukanischen Text der Verkündigung entstand im Mittelalter der „Engel des Herrn“ (angelus), in dem die Gläubigen sich dreimal am Tag, ähnlich dem Stundengebet der Klöster, das Geheimnis der Menschwerdung als Beginn des Erlösungsgeschehens in Erinnerung rufen. In Österreich war dieser Tag bis 1918 gesetzlicher Feiertag. (S)
Dismas
Dismas hieß nach der legendenhaften Überlieferung der sog. „rechte Schächer“. Zu ihm sagte Jesus am Kreuz nach Lk 23, 43: „Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ Dismas wurde daher von Jesus persönlich und noch zu dessen Lebzeiten als Einzigem die ewige Seligkeit versprochen. Er ist der Patron der zum Tode Verurteilten und Gefangenen. (H)
Quirinus von Tegernsee (3. Jh.–269) – Prokopius von Böhmen (um 990–1053) – Eberhard von Nellenburg (um 1010–1078/79) – Margaret Clitherow (um 1556–1586) – Placidus (Thomas) Riccardi (1844–1915)
26. März
Liudger
Liudger oder Ludger (um 742–809) war der erste Bischof von Münster. Er stammte aus einer vornehmen friesischen Familie und war Schüler Gregors in Utrecht und Alkuins in York. 777 wurde er in Köln zum Priester geweiht und kehrte dann als Missionar nach Friesland zurück. Dort erbaute er Kirchen und gründete Pfarreien. Nachdem ihn einfallende Sachsen vertrieben hatten, begab er sich auf eine Pilgerreise nach Rom und in das Kloster Montecassino. 792 übertrug ihm Karl der Große [28. 1.] die Leitung der Friesen- und Sachsenmission. 794 gründete Liudger ein Kanonikerstift, ein Monasterium, den Ausgangspunkt des Missionsbistums Münster, zu dessen erstem Bischof Liudger 804/805 geweiht wurde. Liudger schuf eine vorbildliche Pfarr- und Bistumsstruktur, gründete den Dom und die Domschule, baute weitere Kirchen und Klöster, u. a. in Werden an der Ruhr, wo er später beigesetzt wurde. (B)
Emmanuel (1. Jh.) – Castulus (3. Jh.–um 286) – Larissa (Lara) (4. Jh.) – Petrus von Sebaste (um 345–392)
27. März
Frowin von Engelberg
Frowin von Engelberg (12. Jh.–1178) wurde in St. Blasien (Schwarzwald) geboren, wo er in die dortige Abtei eintrat. Im Jahr 1146 wurde er zum Abt des Klosters Engelberg in der Nähe des Vierwaldstättersees gewählt und gründete dort eine berühmte Mal- und Schreibschule. Frowin trat auch schriftstellerisch hervor, zwei seiner spirituell-theologischen Werke sind erhalten geblieben: De Oratione Domenica (Über das Gebet des Herrn) und De laude liberi arbitrii septem (Sieben Bücher über das Lob des freien Willens). (H)
28. März
Josef Sebastian Pelczar
Josef Sebastian Pelczar (1842–1924) wurde in Korczyna bei Krosno in dem damals zu Österreich gehörenden Königreich Galizien geboren. Das Gymnasium absolvierte er in Rzeszów, die theologischen Studien am Priesterseminar von Przemyśl. Nach seiner Priesterweihe im Jahr 1864 setzte er seine Studien in Rom fort (Dr. theol., Dr. iur. can.) und war ab 1869 Professor am Priesterseminar in Przemyśl. 1877 wurde er dann an die Universität Krakau berufen, deren Rektor er 1882/83 war. 1891 und 1894 gründete er zwei Frauen-Ordensgemeinschaften. 1899 wurde er zum Weihbischof und dann 1900 von Kaiser Franz Joseph I. zum Bischof von Przemyśl ernannt. Pelczar war sehr aktiv in der Armenfürsorge und errichtete Schulen sowie andere Ausbildungsstätten. Desgleichen veröffentlichte er zahlreiche Schriften. Przemyśl wurde 1914/15 durch eine russische Belagerung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die österreichische Armee musste sich im März 1915 ergeben, jedoch wurde die Stadt im Sommer 1915 wieder zurückerobert. (H)
Guntram von Franken (um 525–592)
29. März
Berthold von Kalabrien
Berthold von Kalabrien (12 Jh.–1195) wurde in Salignac bei Limoges (Südwestfrankreich) geboren. Wenige Jahre nach Beendigung des gescheiterten 2. Kreuzzugs ließ sich Bert-
hold um ca. 1055 auf dem Berg Karmel (nahe der heutigen Stadt Haifa) nieder, dort, wo auch Elija/Elias gelebt haben soll. Hier bildete Berthold zusammen mit weiteren Einsiedlern eine Mönchsgemeinschaft. Aus dieser entstanden später die Ordensgemeinschaften der Karmeliter bzw. Karmelitinnen. Damals wurden alle Einwanderer nach Palästina aus Europa als „von Kalabrien“ bezeichnet. (H)
Helmstan (Helmut) von Winchester (9. Jh.–850) – Ludolf von Ratzeburg (um 1200–1250)
30. März
Maria Restituta (Helene) Kafka
Helene Kafka (1894–1943) wurde in Hussowitz (heute ein Teil von Brünn) als Tochter eines Schusters geboren. Als sie zwei Jahre alt war, zogen ihre Eltern – wie viele Brünner damals – nach Wien. Nach Absolvierung der Pflichtschule war sie zuerst Pflegerin im Krankenhaus Wien-Lainz. 1913 trat sie der „Kongregation der Schwestern des III. Ordens des hl. Franziskus von der christlichen Liebe“ (sog. Hartmann-Schwestern) mit dem Ordensnamen Maria Restituta bei und wurde dann Operationsschwester in Mödling bei Wien. Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 machte sie aus ihrer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus keinen Hehl. So weigerte sie sich z. B., im Krankenhaus die Kuzifixe abzunehmen. Als sie für eine Widerstandsgruppe ein Schmähgedicht abtippte, wurde sie von einem Arzt denunziert und am Aschermittwoch 1942 verhaftet. Am 29. Oktober 1942 wurde sie vom Volksgerichtshof Wien zum Tode verurteilt und am 30. März 1943 hingerichtet. Sie war die einzige Klosterschwester des „Dritten Reiches“, die zum Tode verurteilt wurde. In der Erzdiözese Wien ist der Gedenktag der 29. Oktober. (H)
Regulus (Rieul) von Senlis (3. Jh.–4. Jh.) – Johannes Klimakos (6. Jh.–um 649) – Diemut von Wessobrunn (um 1060–1130) – Amadeus IX. von Savoy-
en (1435–1472) – Ludwig von Casoria (1814–1885) – Leonhard (Leonardo) Murialdo (1828–1900)
31. März
Benjamin
Benjamin (um 400–422) war Diakon und in Persien als Missionar tätig. Bei einer Christenverfolgung wurde er gefangen genommen. Er weigerte sich trotz Folterung, den heidnischen Gottheiten zu opfern, und erlag dabei den Verletzungen. (H)
Cornelia (?) – Balbina (2. Jh.) – Agilof von Köln (um 700–751) – Guido von Pomposa (um 970–1046) – Bonaventura Tornielli (von Forlì) (1410–1491)