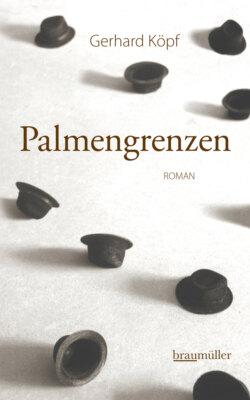Читать книгу Palmengrenzen - Gerhard Köpf - Страница 15
Campodivespe
ОглавлениеGleich nach Abschluss meines Studiums Ende der 60er-Jahre unternahm ich eine Reise in den Süden Italiens und kam auf meinen Wanderungen an der Fußspitze des Stiefels eines Tages in ein Städtchen namens Campodivespe. Zwar habe ich diesen kleinen Ort, der damals nicht mehr als fünfhundert Einwohner gezählt haben mag, nur ein einziges Mal besucht, bin aber später im Leben in Gedanken noch oft an ihn zurückgekehrt.
Campodivespe liegt knapp fünfzig Kilometer nordöstlich von Reggio Calabria an der Nordseite des Aspromonte im Tal des Flusses Torbolo. Die Nachbargemeinden tragen so schöne Namen wie Bagnara Calabra, San Procopio, Sant’Eufemia d’Aspromonte und Seminara.
Die ausgeblutete Gegend ist von großer Armut gezeichnet, und man darf dort außer einer Burg und einem interessant gearbeiteten Taufbecken in der Pfarrkirche keine größeren sehenswerten Kulturdenkmäler oder touristische Attraktionen erwarten. Die vielfachen Entbehrungen und das karge Leben haben die Gesichter der Menschen geprägt, die wie aus grobem Stein gehauen erscheinen und einem eine Ahnung davon geben, wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit ausgesehen haben mögen. So arm diese Menschen aber auch sein mögen, so sehr haben sie eine fast kindlich anmutende, mit anrührendem Pathos unterlegte Achtung vor allem, was mit Kultur, Kunst und Poesie zu tun hat. Und wenn sie darüber wie von etwas Fremdem, ja Unerreichbarem sehnsuchtsvoll sprechen, so eignet ihren Worten bisweilen eine eigenartig getragene Überhöhung, die einem kühlen Nordeuropäer gänzlich fremd erscheint.
Da ich mich von den Strapazen der Wanderung ein wenig erholen wollte, beschloss ich, in Campodivespe Quartier zu nehmen und mietete mich in einem Albergo ein, zu dem im Erdgeschoss auch eine Trattoria namens Pastello gehörte. Kaum hatte ich mein Zimmer bezogen und im Haus meine Mahlzeiten eingenommen, wurde ich von der Wirtin, einer Witwe namens Lucrezia Bordoni, wie ein Familienmitglied umsorgt. Schließlich komme nicht jeden Tag ein Ausländer nach Campodivespe. Ich wurde ebenso geschickt wie ausgiebig über mein Woher und Wohin ausgefragt und stand angesichts der herzlichen Gastfreundschaft gern Rede und Antwort. Zugleich fand ich heraus, dass in Campodivespe fast alle entweder Bordoni oder Sidara hießen. Der Postbote war nicht zu beneiden.
Ein Wort gab das andere, und so erfuhr ich von Signora Bordoni eines Abends eine seltsame Geschichte, die sie mir vermutlich nur deshalb erzählt hat, weil ich ihr etwas verschämt angedeutet hatte, ich sei ein junger deutscher avvocato, der zum ersten Mal nach Italien reise und beabsichtige, darüber zu schreiben. Wenn die Menschen dort so etwas hören, fallen sie sogleich in eine Art Staunen, das getragen ist von der Hoffnung, in dem Buch vorzukommen und dadurch auf geheimnisvolle Weise, wie mit dem Zauberstab im Märchen, von ihrem Elend erlöst zu werden. Und zu diesem Fest, so malen sie sich dann in ausufernden Phantasien gestenreich vor, sängen die Zikaden, und die Eidechsen huschten im Reigen über die heißen Steine.
Ich sei übrigens beileibe nicht der erste Dottore, der sich auf seltsame Weise von Campodivespe inspiriert fühle, denn diese Mauern übten offenbar besonders auf Poeten eine rätselhafte Anziehung aus. Sätze voller Schönheit und Schwermut legten ein beredtes Zeugnis davon ab. Woran das liege, habe sie, ihres Zeichens Lehrerin, Posthalterin und Pensionswirtin, zwar noch nicht herausgefunden, doch sei sie der Sache dicht auf den Fersen und der Lösung des Rätsels nah wie nie zuvor.
Also sprach die Witwe Bordoni, die schon frühmorgens im Nachthemd aus weißem Bauernleinen am Küchentisch saß und las, vormittags die Kinder in der Schule unterrichtete, wegen ihres Fernwehs am liebsten in Geographie, nachmittags das Postamt bediente, abends aber in ihrer bescheidenen Trattoria ihre Gäste umgarnte, aushorchte, mit der Geschwindigkeit eines Lastkahns bediente, einheimische Speisen auftischte und diese mit kreuzqueren Geschichten aus Campodivespe würzte.
Der Wind pfiff um das Haus, es prasselte von den Dächern, irgendwo schlug aufdringlich ein loser Fensterladen, und der dichte graue kalabresische Landregen wollte nicht aufhören, unentwegt gegen die Scheiben zu rauschen. Ich fror. Die Witwe Bordoni legte Holz im Kamin nach und begann mit ihrer Geschichte von Doktor Cataldo Sidara, dem einstmals einzigen Arzt in Campodivespe, der die Armen unentgeltlich behandelte und eigentlich ein weltberühmter Poet habe werden wollen. Aber kein Verlag habe seine Gedichte veröffentlicht. Bis nach Milano hinauf sei er gereist, doch immer habe man ihn abgewiesen oder vertröstet. Sämtliche namhaften Verlage Italiens habe er, Cataldo Sidara, wie ein armseliger Hausierer abgeklappert, doch er sei regelmäßig nicht einmal an der Loge des Pförtners vorbeigekommen. Immer wieder habe man ihn einfach stehen lassen. Kein Mensch könne ermessen, was es für ein Leben sei, ständig auf solche Weise gedemütigt zu werden, denn nichts anderes als eine Demütigung sei es ja, wenn man immer wieder stehen gelassen werde. Und so sei er, einem verarmten und heruntergekommenen Wanderzirkus gleich, eine Zeitlang von Verlag zu Verlag, von Stadt zu Stadt gezogen. Stets mit dem gleichen Resultat. Er kenne sie auswendig, diese dummen und erniedrigenden Sprüche: Der Dottore habe keine Zeit, der Dottore sei verreist, er solle sich schriftlich an den Dottore wenden …
Unverrichteter Dinge sei er wieder nach Campodivespe zurückgekehrt und habe sich dem Gespött der Leute aussetzen müssen. Dabei habe er doch seinen Namen neben dem Dantes in Marmor gemeißelt lesen wollen. Es sei ihm oft wie ein Wunder vorgekommen, dass er, der verkannte Doktor und Poet Cataldo Sidara, überhaupt sein Studium trotz zahlloser Krisen, einer unseligen Liebschaft und tiefer persönlicher Demütigungen und Niederlagen erfolgreich abgeschlossen habe.
Immer wieder einmal habe er in seiner bettelarmen Heimat aus Mitleid für eine kurze Zeitspanne die ärztliche Kunst praktiziert, zumeist mit mäßigem Erfolg und gegen schäbiges Honorar, seine eigentliche, seine höhere Bestimmung, ja Berufung aber unerschütterlich in der Poesie gesehen. In deren Dienst habe er seine ganze Kraft gestellt, an sie habe er geglaubt, aus ihr habe er Halt und Hoffnung bezogen, sie habe ihm den Weg durch sein Leben gewiesen, das einem teuflischen Labyrinth geglichen habe. Zweimal habe er, Cataldo Sidara, Doktor der Medizin, dessen Gedichte ein einziger Hymnus an die Liebe gewesen seien, geliebt. Zweimal vergeblich. Sowohl die Liebe zu einer Literaturstudentin, maßgeblich ausgelebt in einer berauschenden Brieffreundschaft, als auch seine späte Liebe zu einer Krankenschwester seien auf die erbärmlichste und niederträchtigste Weise gescheitert.
Verlässliche Konstanten in seinem Unglück seien einzig verschiedentlich mal kürzere, mal längere Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken sowie die ungezählten vergeblichen Versuche gewesen, als Dichter anerkannt zu werden.
Was ihm geblieben sei? Richtig: Der vollständige Rückzug. Aus allem. Von jedem. Das Reduit des Elternhauses in Campodivespe, am Fuße einer mehr und mehr verfallenden Burgruine, welch ein Symbol für sein eigenes trostloses Dasein, reduziert auf den täglichen Umgang mit Kaffee, Zigaretten und Schlafmitteln.
So wie er zweimal in seinem Leben voll Inbrunst geliebt habe, den Himmeln, Winden, Meeren habe er Liebesbriefe geschickt, die seiner Einsamkeit vorausgeeilt seien, so habe er zweimal versucht, seiner nichtswürdigen Existenz ein Ende zu setzen. Doch selbst dabei habe er sich als Versager erwiesen, ein inetto, ein Untauglicher, ein Nichtswürdiger, eine Niete, eine Null.
Zuletzt habe er, gänzlich vereinsamt, auf seinem Nachttischchen einen Brief hinterlegt, bestehend lediglich aus einem einzigen Satz: Vi prego di non seppellirmi vivo. „Ich bitte euch, mich nicht lebendig zu begraben.“
Schließlich bekräftigte die Witwe Bordoni nach einer Pause: „Cataldo Sidara hat sich sein Lebtag nie als Arzt, sondern immer als Patient verstanden.“
Das schien mir ein Schlüsselsatz für die Geschichte und Identität Italiens zu sein. Er hatte eine Traurigkeit wie Fellinis La Strada.
Kaum hatte die Witwe Bordoni ihre Erzählung beendet, stellte sie eine Flasche Grappa und zwei Gläser auf den Tisch. Erst nach einer Weile feierlichen Schweigens fand die Wirtin wieder zu ihrer Sprache und meinte nebenbei, es handle sich hier zwar nur um den Schnaps kleiner Leute, doch sei das Geheimnis seiner Herstellung, das auf die Kreuzritter zurückgehe, längst nicht so alt wie Armut und Elend jener, die er tröste. Schließlich fügte sie ein wenig kleinlaut mit verlegenem Gesichtsausdruck hinzu, man hätte die Geschichte natürlich noch besser erzählen können.
Mutig von den ersten Schlucken des Tresterbrandes, der in mich eingedrungen war wie Feuer, erhob ich mich und zitierte, so gut ich eben konnte, Joseph Conrad, der einmal gesagt haben soll, alles, was man tue, könne besser getan werden. Aber das sei ein Gedanke, den jemand, der etwas tue, entschlossen beiseitelegen müsse, wenn er nicht wolle, dass seine Idee für immer ein Wunschbild bleiben solle, ein flüchtiges Traumgebilde. Wie damals „mein Italien“.